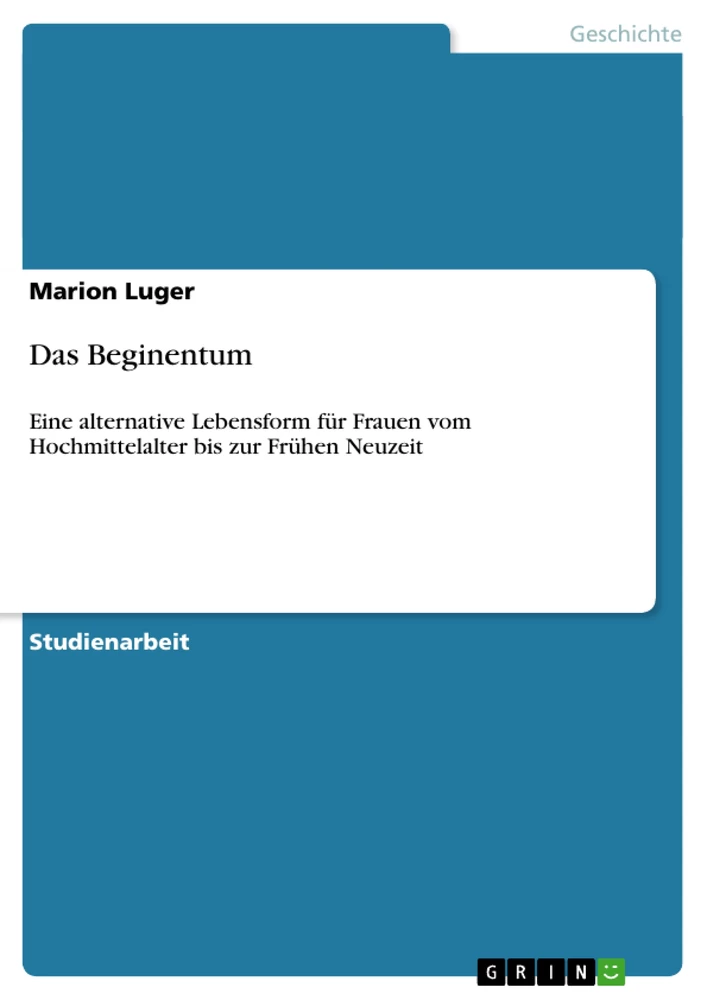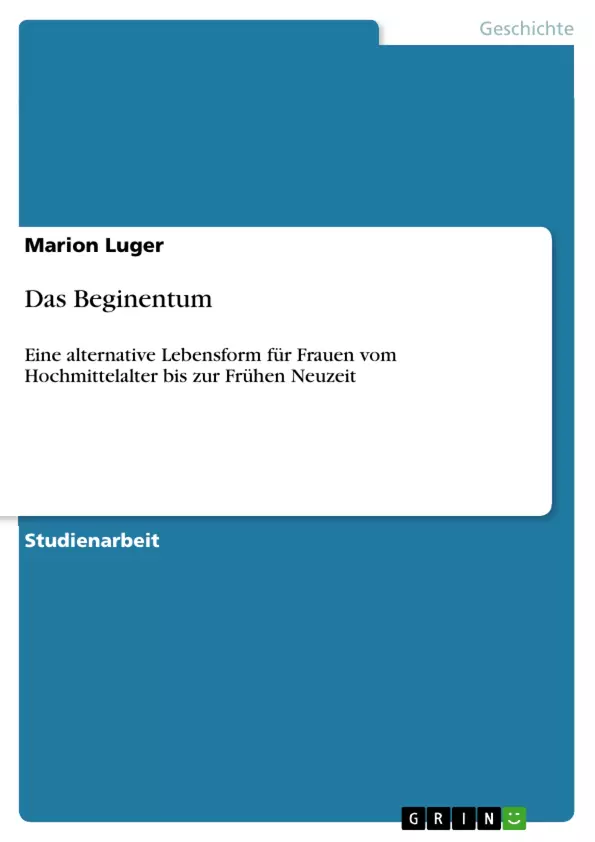Beginen waren vom Mittelalter bis zur Gegenwart Gegenstand zahlreicher Kontroversen – ihre „Unfaßbarkeit“ (im wörtlichen und übertragenen Sinn) kommt allein schon in den unzähligen Bezeichnungen zum Ausdruck, mit denen diese Frauen bedacht wurden. Zugleich bestärken mich die zahlreichen unterschiedlichen zeitgenössischen Termini in meiner Vermutung, daß die heutige Forschung all die Frauen mit dem Ausdruck „Begine“ bedacht hat, deren Lebensweise jene gleichen Komponenten und unterschiedlichen Ausprägungen aufweist, die im Folgenden noch erläutert werden sollen. Als gemeinsamer Konsens läßt sich immerhin der temporale und lokale Rahmen des Auftretens von Beginen festhalten: Ihr Erscheinen erstreckt sich auf einen Zeitraum vom Beginn des 13. Jahrhunderts bis zur Reformation und umfaßt als geographische Schwerpunktregionen die (durch den Reichtum an Städten) kulturell und sozio-ökonomisch wohl fortschrittlichsten Zonen Mittel- und Westeuropas.
Den RezipientInnen muß der Hinweis auf diese knapp umrissene historische und räumliche Verortung genügen, denn die Intention der vorliegenden Arbeit besteht darin, die beginische Lebensform in ihrer Eigenschaft als „geschichtlich eingeübte soziale Verhaltensweise“ einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen. Im Konkreten beschäftigt sich die Untersuchung nach einem tendenziellen Forschungsüberblick (Kapitel II) zunächst mit der Frage, welche charakteristischen Merkmale die beginische Lebensweise auszeichnen und inwiefern sie als Alternative zu den „herkömmlichen“ Möglichkeiten für Frauen des Mittelalters gesehen werden kann (Kapitel III). Kapitel IV versucht herauszufinden, welche Faktoren dieser innovativen Lebensführung für die ZeitgenossInnen Relevanz besaßen und wie die Reaktionen der laikalen und klerikalen Umwelt ausfielen. Danach sollen Kontext und Prämissen der Beginenbewegung aufgezeigt werden, da sie sich für eine adäquate Bewertung des Grades und der Relevanz der Alternativität als unerläßlich erweisen (Kapitel V). In Kapitel VI wird der Frage nachgegangen, welche Konsequenzen die sich wandelnden Beziehungen zwischen Beginen und Klerus bzw. profaner Umgebung für die beginische Lebensformen hatten und in welcher Art und Weise sie die weitere Entwicklung beeinflußten. Abschließend beleuchtet Kapitel VII. die Umstände des Niedergangs der ursprünglichen beginischen Lebensformen an der Wende zur Neuzeit.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Forschungslage
- III. Alternativer Charakter
- IV. Innovation und Reaktion
- V. Entstehungsbedingungen
- VI. Anpassung und Autonomie
- VII. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lebensform der Beginen vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit als historische soziale Verhaltensweise. Sie analysiert charakteristische Merkmale der beginischen Lebensweise, bewertet deren Alternativität zu den traditionellen Möglichkeiten für Frauen im Mittelalter und untersucht die Reaktionen der Gesellschaft darauf. Die Entstehungsbedingungen und die sich wandelnden Beziehungen zwischen Beginen und Klerus/Gesellschaft werden ebenfalls beleuchtet.
- Charakteristische Merkmale der beginischen Lebensweise
- Beginen als Alternative zu traditionellen Frauenrollen im Mittelalter
- Reaktionen der Gesellschaft auf die beginische Lebensform
- Entstehungsbedingungen der Beginenbewegung
- Wandel der Beziehungen zwischen Beginen und ihrer Umgebung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Einleitung führt in die Thematik der Beginen ein und erläutert die Schwierigkeiten bei der Definition und Einordnung dieser Frauen aufgrund der vielfältigen zeitgenössischen Bezeichnungen. Es wird der zeitliche und räumliche Rahmen ihres Auftretens umrissen.
Kapitel II: Forschungslage untersucht verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung der Beginenbewegung, kritisiert bestehende Thesen (Versorgungsthese, Religiositätsthese, Überschußthese) und weist auf deren Schwächen hin.
Kapitel III: Alternativer Charakter (wird im Preview nicht weiter ausgeführt, da der vollständige Text notwendig ist)
Kapitel IV: Innovation und Reaktion (wird im Preview nicht weiter ausgeführt, da der vollständige Text notwendig ist)
Kapitel V: Entstehungsbedingungen (wird im Preview nicht weiter ausgeführt, da der vollständige Text notwendig ist)
Kapitel VI: Anpassung und Autonomie (wird im Preview nicht weiter ausgeführt, da der vollständige Text notwendig ist)
Schlüsselwörter
Beginen, Beginenbewegung, Mittelalter, Frauen, alternative Lebensform, Religiosität, Gesellschaft, Kirche, soziale Verhaltensweise, soziale Strukturen, Frauenrollen, Mittelalterliche Geschichte, feministische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Beginen im Mittelalter?
Beginen waren Frauen, die in religiösen Gemeinschaften lebten, ohne jedoch ein klösterliches Gelübde abzulegen. Sie führten ein eigenständiges, spirituelles Leben.
War das Beginentum eine Alternative zur Ehe oder zum Kloster?
Ja, es galt als innovative Lebensform für Frauen, die weder heiraten noch in ein strenges Kloster eintreten wollten, und bot soziale Autonomie.
In welchen Regionen traten Beginen besonders häufig auf?
Der Schwerpunkt lag in den kulturell und wirtschaftlich fortschrittlichen Städten Mittel- und Westeuropas zwischen dem 13. Jahrhundert und der Reformation.
Wie reagierte die Kirche auf die Beginenbewegung?
Die Reaktionen waren zwiespältig: Einerseits wurden sie geduldet, andererseits gab es Misstrauen und Verfolgung wegen ihrer „Unfassbarkeit“ und fehlenden kirchlichen Kontrolle.
Warum ging das Beginentum Ende des Mittelalters zurück?
Gründe waren der zunehmende Druck der Amtskirche zur Eingliederung in Orden, soziale Umbrüche und schließlich die Reformation.
- Citation du texte
- Marion Luger (Auteur), 2000, Das Beginentum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121944