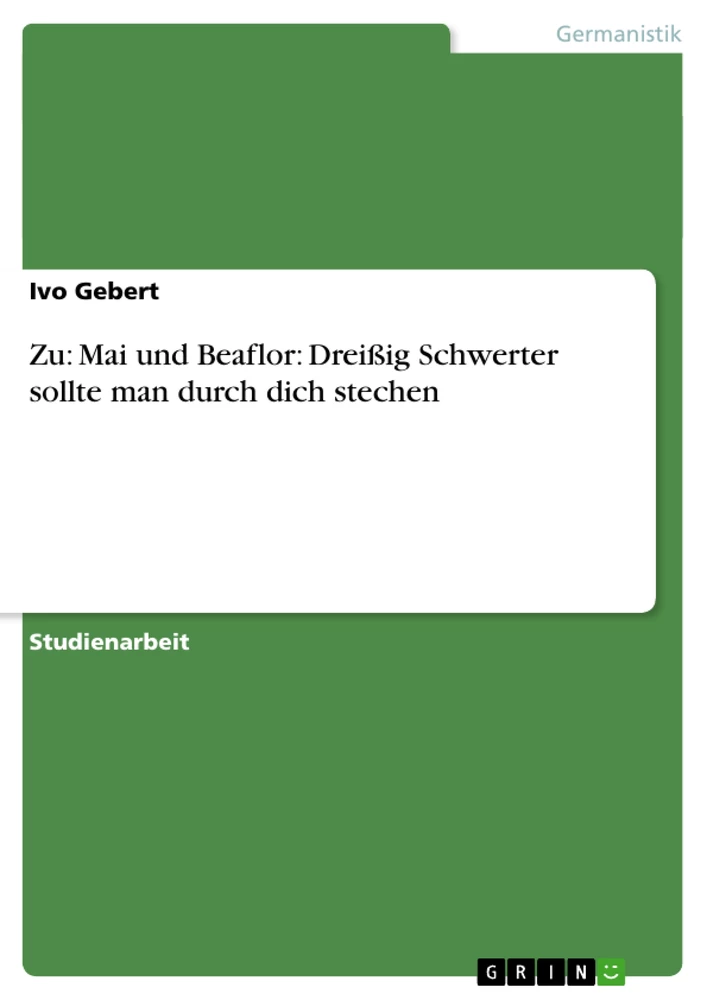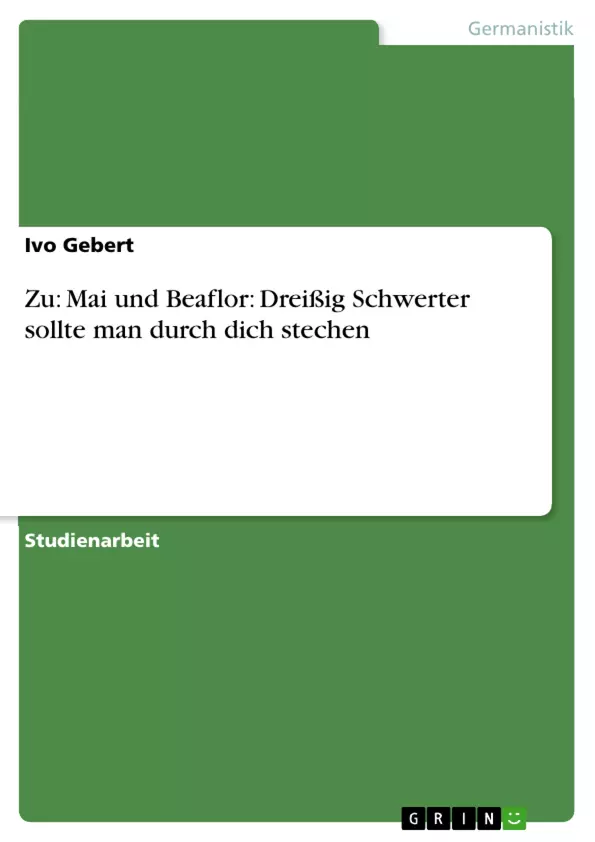'In vino veritas' heißt es, doch schon so mancher wachte nach einer durchzechten Nacht auf und konnte sich nicht mehr an alles erinnern. Auch die Variante, jemanden mit gutem Wein zu traktieren, hat vielfach Anwendung gefunden, zum Beispiel im Roman "Mai und Beaflor" eines anonymen Autors aus dem späten 13. Jahrhundert. Darin macht ein Bote mit Briefen einen verhängnisvollen Umweg und trägt danach ausgetauschte Schreiben mit sich. Dies alles lässt fraglich erscheinen, ob im Wein denn wirklich so viel Wahrheit liege.
Die Arbeit "Mai und Beaflor: Dreißig Schwerter..." beschäftigt sich mit den Gegebenheiten der Fernkommunikation, wie sie in Mai und Beaflor verhandelt werden. Dabei wird nach einigen Bemerkungen zu Text und Edition und einer kurzen Wiedergabe der Handlung der Referenzrahmen beleuchtet, in dem im Roman und der entsprechenden Zeit kommuniziert wurde. Fragen vom Vertrauen, aber auch vom feudalen System und wer darin wie wirkt, sind im Folgenden Gegenstände der Betrachtung. Da der Verfehlung eines Boten eine ganze Kette von tatsächlichen oder beinahe stattfindenden Unglücken folgt, werden die beiden auftretenden Boten in einem eigenen Kapitel ‚gewürdigt’. Aus den beschriebenen Schwierigkeiten der Fernkommunikation im Mittelalter werden anschließend Überlegungen zu Schwierigkeiten und Grenzen der Botschaftsübertragung und den verschiedenen Möglichkeiten der Konfusion abgeleitet. Den Schluss bilden Betrachtungen zum Wandel der Rolle des Boten und der Frage, welchen Effekt der Text beim zumeist adligen Publikum mutmaßlich bewirken sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Werk und Inhalt
- 2.1 Werk und Edition
- 2.2 Die Erzählung
- 3. Der Bezugsrahmen
- 3.1 Die feudale Ordnung und das dreifache Vertrauen
- 3.2 Eine Fremde – das geht doch nicht (Beaflor vs. Eliacha)
- 4. Und dazwischen: Boten
- 4.1 Zwei Boten
- 4.2 Was Boten und Botschaft beeinflussen kann
- 5. Und wozu das Ganze?
- 5.1 Grenzen der Kommunikation und Konfusion
- 5.2 Wandel der Botenrolle
- 5.3 Didaktischer Nutzen
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Fernkommunikation im mittelhochdeutschen Versroman "Mai und Beaflor" anhand der Rolle der Boten und der Auswirkungen fehlerhafter Nachrichtenübermittlung. Der Fokus liegt auf der Darstellung der feudalen Ordnung, des Vertrauens und Misstrauens in verschiedenen Beziehungen, sowie den Herausforderungen der Kommunikation im Mittelalter.
- Die Darstellung der feudalen Ordnung und ihrer Normen in "Mai und Beaflor".
- Die Rolle des Vertrauens und des Misstrauens in den Beziehungen der Figuren.
- Die Herausforderungen der Fernkommunikation im Mittelalter und die Rolle der Boten.
- Die Auswirkungen fehlerhafter Kommunikation und die Entstehung von Konfusion.
- Der didaktische Zweck des Romans und seine Botschaft an das adlige Publikum.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Fernkommunikation in "Mai und Beaflor". Kapitel 2 beschreibt das Werk selbst und seine Entstehungsgeschichte, sowie eine kurze Zusammenfassung der Handlung bis zum Auftreten des ersten Boten. Kapitel 3 beleuchtet den feudalen Kontext und die Bedeutung von Vertrauen innerhalb des Systems, insbesondere im Vergleich zwischen Beaflor und Eliacha. Kapitel 4 analysiert die Rolle der beiden Boten im Roman und die Faktoren, die die Nachrichtenübertragung beeinflussen. Kapitel 5 untersucht die Grenzen der Kommunikation und die Entstehung von Konfusion aufgrund des Botenversagens und der Manipulation von Briefen.
Schlüsselwörter
Mai und Beaflor, mittelhochdeutscher Versroman, Fernkommunikation, Bote, Botschaft, feudale Ordnung, Vertrauen, Misstrauen, Manipulation, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, Konfusion, didaktischer Text, mittelalterliche Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Roman „Mai und Beaflor“?
Es ist ein anonymer Versroman aus dem 13. Jahrhundert, in dem ein Bote durch Weinkonsum aufgehalten wird, was zu einem verhängnisvollen Briefaustausch führt.
Welche Rolle spielen Boten in der mittelalterlichen Fernkommunikation?
Boten waren das zentrale Glied der Kommunikation. Ihr Versagen oder die Manipulation ihrer Botschaften konnte im feudalen System katastrophale Folgen haben.
Was bedeutet „dreifaches Vertrauen“ im feudalen Kontext?
Die Arbeit beleuchtet das Vertrauensverhältnis innerhalb der feudalen Ordnung, das für das Funktionieren von Herrschaft und Kommunikation essenziell war.
Wie wird die Manipulation von Nachrichten im Werk dargestellt?
Durch das Abfangen und Austauschen von Briefen entsteht Konfusion, die die Grenzen der damaligen Kommunikation und die Anfälligkeit des Systems aufzeigt.
Welchen didaktischen Nutzen hatte der Roman für das adlige Publikum?
Der Text sollte vermutlich vor den Gefahren von Nachlässigkeit und Manipulation warnen und Normen des feudalen Zusammenlebens vermitteln.
- Citar trabajo
- Ivo Gebert (Autor), 2007, Zu: Mai und Beaflor: Dreißig Schwerter sollte man durch dich stechen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121952