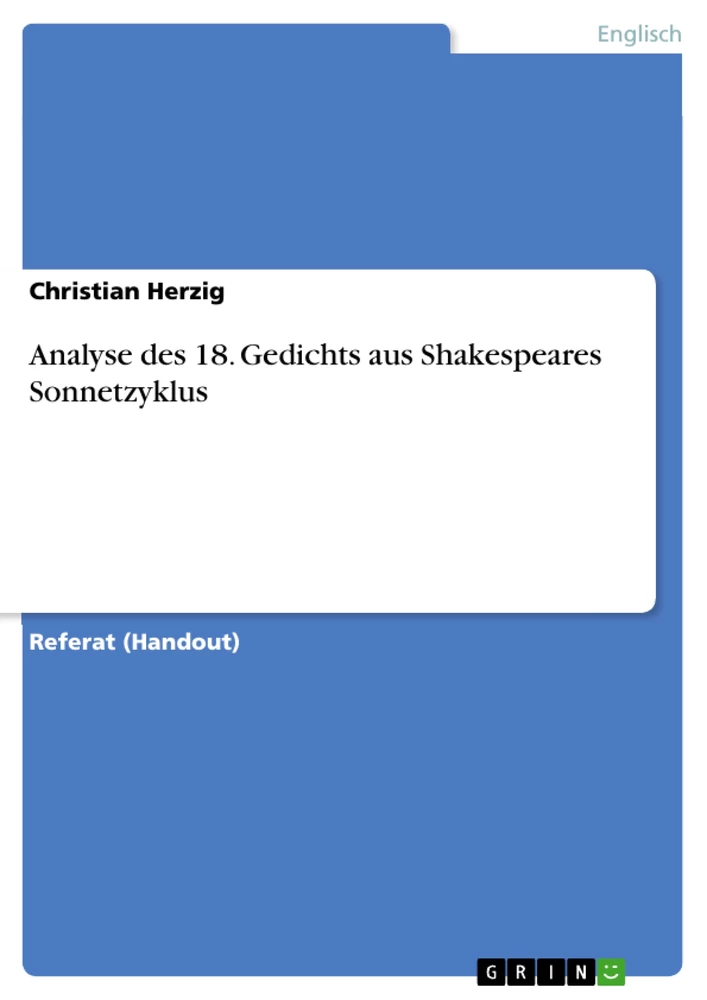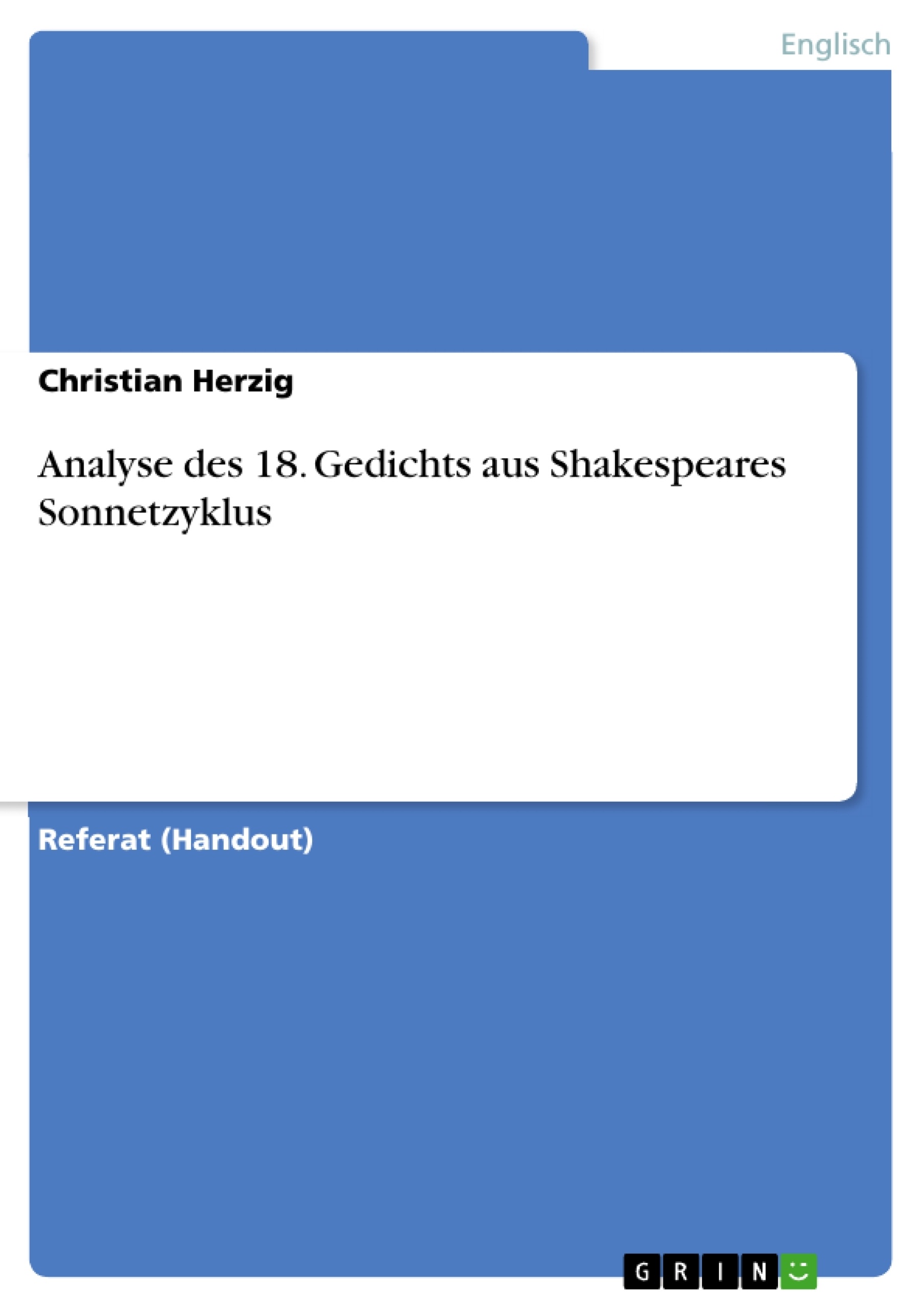1. Einordnung: Sonettzyklus- literaturhistorischer Kontext
Das 18. Sonett von Shakespeare gehört zu einem insgesamt 154 Sonette umfassenden Zyklus. Die Abfolge der einzelnen Gedichte ist nicht gesichert und immer noch Gegenstand einer Diskussion.
Entstanden ist dieses Gedicht nach bestimmter Einschätzung zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Von den verschiedenen Motivgruppen ist es derjenigen zuzuordnen, welche die Vergänglichkeit der Dinge im Gegensatz zum Idealen behandelt, welches in der Lyrik aufzubewahren versucht wird.
Die Tradition der Sonettdichtung hatte sich ausgehend vom Petrarkismus in weiten Teilen Europas verbreitet, so auch in England. Shakespeare entwirft einen eigenständigen Zyklus (keine Nachdichtung o.ä.), welcher bestimmte Elemente in seinen englischen Vorgängern findet (dazu später).
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Formales
- 1. Einordnung: Sonettzyklus- literaturhistorischer Kontext
- 2. Grober formaler Aufbau (Sonett, Struktur, Reim) -> Funktion
- 3. Metrik
- II. Inhaltlicher Aufbau
- 1. Gedankenführung
- 2. Sprechsituation Sprecher - Adressat auf textinterner Kommunikationsebene
- 3. Bild- und Stilebene, Thematik
- 4. Weitere Stilmittel
- III. Deutung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Analyse ist es, Shakespeares 18. Sonett im Hinblick auf seine formale Struktur, seinen inhaltlichen Aufbau und seine Deutung zu untersuchen. Die Analyse beleuchtet den literaturhistorischen Kontext, die sprachlichen Mittel und die zentrale Thematik des Gedichts.
- Formale Analyse des Sonetts (Metrik, Reimschema, Struktur)
- Untersuchung der Gedankenführung und Sprechsituation
- Analyse der Bildsprache, Stilmittel und Thematik (Vergänglichkeit vs. Ewigkeit)
- Deutung des Gedichts im Kontext der Shakespeare’schen Sonette
- Die Rolle der Lyrik als Mittel der Vergegenwärtigung und Bewahrung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Formales: Diese Sektion bietet eine umfassende formale Analyse des 18. Sonetts. Sie ordnet das Sonett in den literaturhistorischen Kontext der Shakespeare'schen Sonette und der englischen Sonnettradition ein, beschreibt den Aufbau des Gedichts (14 Zeilen, Kreuzreim, Couplet), analysiert die Metrik (Zehnsilbler, Betonung, Variationen im Rhythmus) und erörtert stilistische Besonderheiten wie den Umgang mit dem Metrum durch Elisionen und die Abwesenheit von Enjambements. Die formale Analyse legt den Grundstein für das Verständnis der inhaltlichen und interpretativen Aspekte des Sonetts.
II. Inhaltlicher Aufbau: Dieser Abschnitt erörtert den inhaltlichen Aufbau des Gedichts, beginnend mit der Analyse der Gedankenführung. Die Analyse beleuchtet die rhetorische Frage der ersten Zeile und den darauf folgenden Vergleich des Adressaten mit einem Sommertag. Die Unzulänglichkeiten der Natur und ihre Vergänglichkeit werden im Detail beschrieben, wobei der Kontrast zum Ideal des unvergänglichen Adressaten herausgearbeitet wird. Die Sprechsituation wird analysiert, indem die Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und dem Adressaten beleuchtet wird, und die Idealsierung des Adressaten herausgestellt wird. Die Bildsprache und stilistischen Mittel, wie Metaphern und Personifikationen, werden im Detail erklärt und in Bezug auf die Thematik gesetzt. Zu den Stilmitteln gehören Inversionen, Anapher, Parallelismen und Chiasmus, die alle einen Beitrag zum Aufbau des Gedichts leisten und dessen Bedeutung unterstreichen.
III. Deutung: Die Deutung des Gedichts fokussiert auf das zentrale Motiv der Überführung des Endlichen ins Unendliche durch die Lyrik. Shakespeare's Kunstfertigkeit wird als die originelle Reihung der verwendeten Wörter beschrieben, im Gegensatz zu anderen, zeitgenössischen Dichtungen, die anderen Paradigmen folgen. Das Gedicht wird als eine Synthese von Reflexion und bildlicher Darstellung interpretiert, in der das Überzeitliche betont wird, im Gegensatz zu einem selbstbezogenen Spiel der Sprache. Die Analyse betont die einfache Sprache Shakespeares, die dennoch komplexe Themen wie die Vergänglichkeit und die Ewigkeit behandelt.
Schlüsselwörter
Shakespeare, Sonett 18, Sonettzyklus, Formale Analyse, Inhaltliche Analyse, Vergänglichkeit, Ewigkeit, Lyrik, Bildsprache, Stilmittel, Metrik, Reimschema, Rhetorische Figuren, Interpretationsansatz, Literaturgeschichte.
Shakespeare Sonett 18: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was beinhaltet diese HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Analyse von Shakespeares 18. Sonett. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Analyse, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Formaler Aufbau, Inhaltlicher Aufbau, Deutung) und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Aspekte des Sonetts werden in der formalen Analyse behandelt?
Die formale Analyse umfasst die Einordnung des Sonetts in den literaturhistorischen Kontext, den Aufbau (14 Zeilen, Kreuzreim, Couplet), die Metrik (Zehnsilbler, Betonung, Rhythmusvariationen), und stilistische Besonderheiten wie den Umgang mit dem Metrum durch Elisionen und das Fehlen von Enjambements.
Wie wird der inhaltliche Aufbau des Sonetts beschrieben?
Der inhaltliche Aufbau wird durch die Analyse der Gedankenführung, der Sprechsituation (Beziehung zwischen lyrischem Ich und Adressat), der Bildsprache, der Stilmittel (Metaphern, Personifikationen, Inversionen, Anapher, Parallelismen, Chiasmus) und der Thematik (Vergänglichkeit vs. Ewigkeit) beleuchtet. Die rhetorische Frage der ersten Zeile und der Vergleich des Adressaten mit einem Sommertag werden detailliert untersucht.
Worauf konzentriert sich die Deutung des Sonetts?
Die Deutung fokussiert auf das zentrale Motiv der Überführung des Endlichen ins Unendliche durch die Lyrik. Shakespeare's Kunstfertigkeit wird hervorgehoben, und das Gedicht wird als Synthese von Reflexion und bildlicher Darstellung interpretiert, die das Überzeitliche betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Shakespeare, Sonett 18, Sonettzyklus, Formale Analyse, Inhaltliche Analyse, Vergänglichkeit, Ewigkeit, Lyrik, Bildsprache, Stilmittel, Metrik, Reimschema, Rhetorische Figuren, Interpretationsansatz, Literaturgeschichte.
Welche Zielsetzung verfolgt diese Analyse?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung von Shakespeares 18. Sonett hinsichtlich seiner formalen Struktur, seines inhaltlichen Aufbaus und seiner Deutung. Die Analyse beleuchtet den literaturhistorischen Kontext, die sprachlichen Mittel und die zentrale Thematik des Gedichts.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Analyse behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen die formale Analyse des Sonetts (Metrik, Reimschema, Struktur), die Untersuchung der Gedankenführung und Sprechsituation, die Analyse der Bildsprache, Stilmittel und Thematik (Vergänglichkeit vs. Ewigkeit), die Deutung des Gedichts im Kontext der Shakespeare’schen Sonette und die Rolle der Lyrik als Mittel der Vergegenwärtigung und Bewahrung.
- Quote paper
- Christian Herzig (Author), 2002, Analyse des 18. Gedichts aus Shakespeares Sonnetzyklus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1220