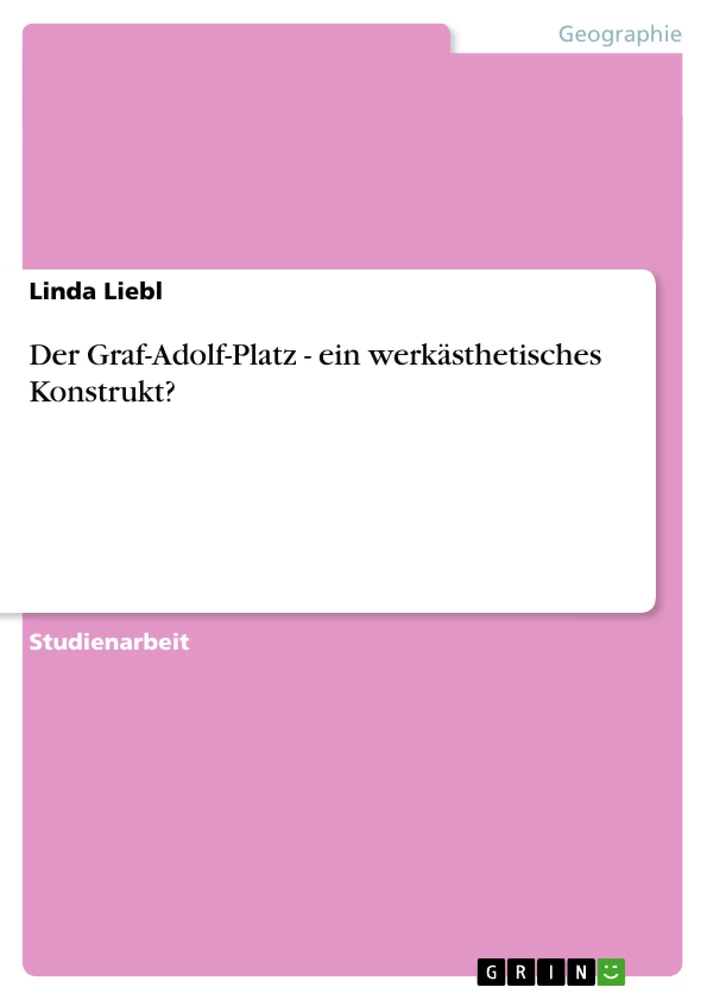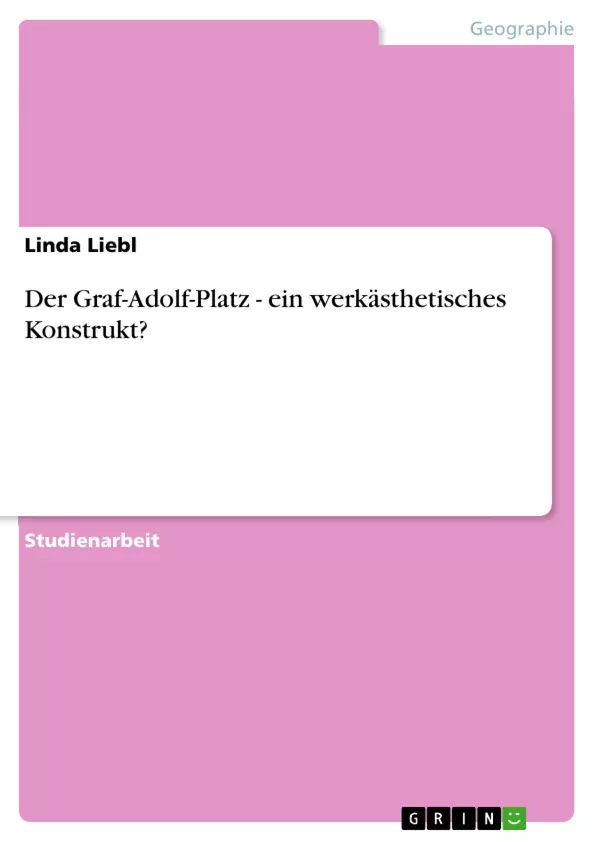Beide, die Werk- und die Rezeptionsästhetik, beschäftigen sich mit der Schönheit von Kunstwerken. Jedoch betrachten sie das Kunstwerk aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Für die Werkästhetik ist die Meinung der Rezeptionsästhetik unwichtig. Das heißt, ein Kunstwerk kann durchaus als wertvoll bezeichnet werden, ohne dass es dem Publikum gefällt. Denn nach Meinung der Werkästhetik zählt nur der objektive Wert. In der Gartenkunst und Landschaftsarchitektur können sich durch diese Meinung große Konflikte ergeben. Es handelt sich um eine zum größten Teil öffentliche Kunst, wenn Parks und Stadtplätze gestaltet werden, die für die gesamte Bevölkerung zugänglich sind.
Teilweise werden starke Proteste laut, wenn zu moderne Gestaltungen umgesetzt werden, ohne die Werkästhetik dadurch erschüttern zu können. Die modernen Kunstwerke werden fleißig in Fachzeitschriften diskutiert und nicht selten sehr gelobt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Lage und Bedeutung in der Stadt
- 2. Geschichte des Platzes
- 3. Umgestaltung des Platzes
- 3.1 Aktion Platzda!
- 3.2 Beschreibung der neuen Gestaltung durch die Landschaftsarchitekten WES & Partner.
- 3.3 Gestaltungsziele und deren Umsetzung
- Exkurs: Werkästhetik und Rezeptionsästhetik.
- 4. Eigene Einschätzung des Platzes
- 5. Bürgerbefragung auf dem Graf-Adolf-Platz
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf unter dem Aspekt der Werkästhetik und Rezeptionsästhetik. Ziel ist es, die Entwicklung des Platzes von seiner historischen Bedeutung bis hin zur jüngsten Umgestaltung zu analysieren und die ästhetische Wirkung auf die Bevölkerung zu betrachten. Die Bürgerbefragung soll Aufschluss über die Akzeptanz der neuen Gestaltung geben.
- Historische Entwicklung des Graf-Adolf-Platzes
- Die Rolle des Platzes als Verkehrsknotenpunkt
- Die Umgestaltung des Platzes und die "Aktion Platzda!"
- Ästhetische Bewertung des Platzes
- Rezeption der Umgestaltung durch die Bevölkerung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Lage und Bedeutung in der Stadt: Der Graf-Adolf-Platz liegt zentral in Düsseldorf, an der Schnittstelle von Karlstadt, Friedrichstadt und Stadtmitte. Seine Bedeutung liegt in seiner Funktion als wichtiger Verkehrsknotenpunkt für den Individual- und öffentlichen Nahverkehr. Die Lage zwischen Kö-Graben und Schwanenspiegel unterstreicht seine Rolle innerhalb des historischen „Grünen Kranzes“ und dessen denkmalgeschützter Grünflächen. Die Bebauung ist von Hotels, Geschäftshäusern und zentralen Einrichtungen geprägt.
2. Geschichte des Platzes: Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Teil der Stadtbefestigung, entwickelte sich der Platz nach deren Schleifung im 19. Jahrhundert zu einem öffentlichen Raum. Die Planung des „Grünen Kranzes“ durch Weyhe und Vagedes integrierte den Platz in ein grünes Ringsystem um die Altstadt. Erweiterungen erfolgten 1891 mit der Verlegung des Zentralbahnhofs und der Namensgebung zu Ehren Graf Adolfs. Die Entwicklung zum Verkehrsknotenpunkt und die Einbeziehung in die städtebauliche Entwicklung des 20. Jahrhunderts, inklusive der Umbenennung und der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, prägten seine Geschichte. Die Umgestaltung in den 1950er und 1960er Jahren mit dem Bau eines Straßenbahnhofs und einer später vernachlässigten Grünanlage führte schließlich zur aktuellen Umgestaltung.
3. Umgestaltung des Platzes: Der Wettbewerb 2005 zur Bebauung des Grundstücks Graf-Adolf-Platz 15 umfasste die Gestaltung des gesamten Platzes. Ziel war die Stärkung der Verbindung zwischen Kö-Graben und Schwanenspiegel. Der Bau eines Hochhauses mit Tiefgarage sollte die Aufenthaltsqualität verbessern und den Verkehr neu ordnen. Der Bebauungsplan sah die Erhaltung und Neugestaltung der öffentlichen Grünfläche als historische Grünverbindung und Parkanlage vor, mit dem Ziel des Rückbaus von Verkehrsflächen und der Betonung städtebaulicher Zusammenhänge.
3.1 Aktion Platzda!: Die Initiative "Platzda!" des Stadtplanungsamtes Düsseldorf förderte die Beteiligung der Bevölkerung an der Neugestaltung der Düsseldorfer Plätze. Ziel war die Steigerung des öffentlichen Bewusstseins und die Akzeptanz von Planungen durch frühzeitige Bürgerbeteiligung. Die Bürger formulierten Änderungsvorschläge, die vor allem die Verkehrsberuhigung, mehr Grünflächen, zusätzliche Angebote (Gastronomie, Trinkwasserbrunnen, Toiletten) und eine verbesserte Sauberkeit betrafen.
Schlüsselwörter
Graf-Adolf-Platz, Düsseldorf, Stadtplanung, Werkästhetik, Rezeptionsästhetik, Grünanlage, Verkehrsplanung, Bürgerbeteiligung, historische Entwicklung, Umgestaltung, Aktion Platzda!, städtebauliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf unter den Aspekten der Werkästhetik und Rezeptionsästhetik. Sie untersucht die Entwicklung des Platzes von seiner historischen Bedeutung bis zur jüngsten Umgestaltung und betrachtet dessen ästhetische Wirkung auf die Bevölkerung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Platzes, seine Rolle als Verkehrsknotenpunkt, die Umgestaltung inklusive der „Aktion Platzda!“, die ästhetische Bewertung des Platzes und die Rezeption der Umgestaltung durch die Bevölkerung. Die Lage und Bedeutung des Platzes in der Stadt, sowie eine Bürgerbefragung zu dessen Akzeptanz werden ebenfalls untersucht.
Wie ist der Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf gelegen und welche Bedeutung hat er?
Der Graf-Adolf-Platz liegt zentral in Düsseldorf an der Schnittstelle von Karlstadt, Friedrichstadt und Stadtmitte. Er ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und befindet sich zwischen Kö-Graben und Schwanenspiegel, wodurch seine Rolle innerhalb des historischen „Grünen Kranzes“ und dessen denkmalgeschützter Grünflächen hervorgehoben wird. Die Bebauung ist von Hotels, Geschäftshäusern und zentralen Einrichtungen geprägt.
Welche historische Entwicklung hat der Graf-Adolf-Platz durchlaufen?
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war der Platz Teil der Stadtbefestigung. Nach deren Schleifung entwickelte er sich im 19. Jahrhundert zu einem öffentlichen Raum, integriert in den „Grünen Kranz“. Die Verlegung des Zentralbahnhofs 1891 und die Namensgebung zu Ehren Graf Adolfs prägten seine Geschichte ebenso wie seine Entwicklung zum Verkehrsknotenpunkt und die städtebauliche Entwicklung des 20. Jahrhunderts, inklusive der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und der Umgestaltung in den 1950er und 1960er Jahren.
Wie verlief die Umgestaltung des Graf-Adolf-Platzes?
Ein Wettbewerb 2005 umfasste die Gestaltung des gesamten Platzes, mit dem Ziel die Verbindung zwischen Kö-Graben und Schwanenspiegel zu stärken und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Der Bau eines Hochhauses mit Tiefgarage sollte den Verkehr neu ordnen. Der Bebauungsplan sah die Erhaltung und Neugestaltung der öffentlichen Grünfläche als historische Grünverbindung vor, mit dem Ziel des Rückbaus von Verkehrsflächen.
Welche Rolle spielte die „Aktion Platzda!“?
Die Initiative „Platzda!“ förderte die Bürgerbeteiligung an der Neugestaltung. Die Bürger formulierten Änderungsvorschläge, die vor allem die Verkehrsberuhigung, mehr Grünflächen, zusätzliche Angebote (Gastronomie, Trinkwasserbrunnen, Toiletten) und eine verbesserte Sauberkeit betrafen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Graf-Adolf-Platz, Düsseldorf, Stadtplanung, Werkästhetik, Rezeptionsästhetik, Grünanlage, Verkehrsplanung, Bürgerbeteiligung, historische Entwicklung, Umgestaltung, Aktion Platzda!, städtebauliche Entwicklung.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Lage und Bedeutung in der Stadt; Geschichte des Platzes; Umgestaltung des Platzes (inkl. Aktion Platzda! und Beschreibung der neuen Gestaltung); Exkurs: Werkästhetik und Rezeptionsästhetik; Eigene Einschätzung des Platzes; Bürgerbefragung auf dem Graf-Adolf-Platz; und Fazit.
- Citation du texte
- Diplom-Ingenieur Linda Liebl (Auteur), 2007, Der Graf-Adolf-Platz - ein werkästhetisches Konstrukt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122069