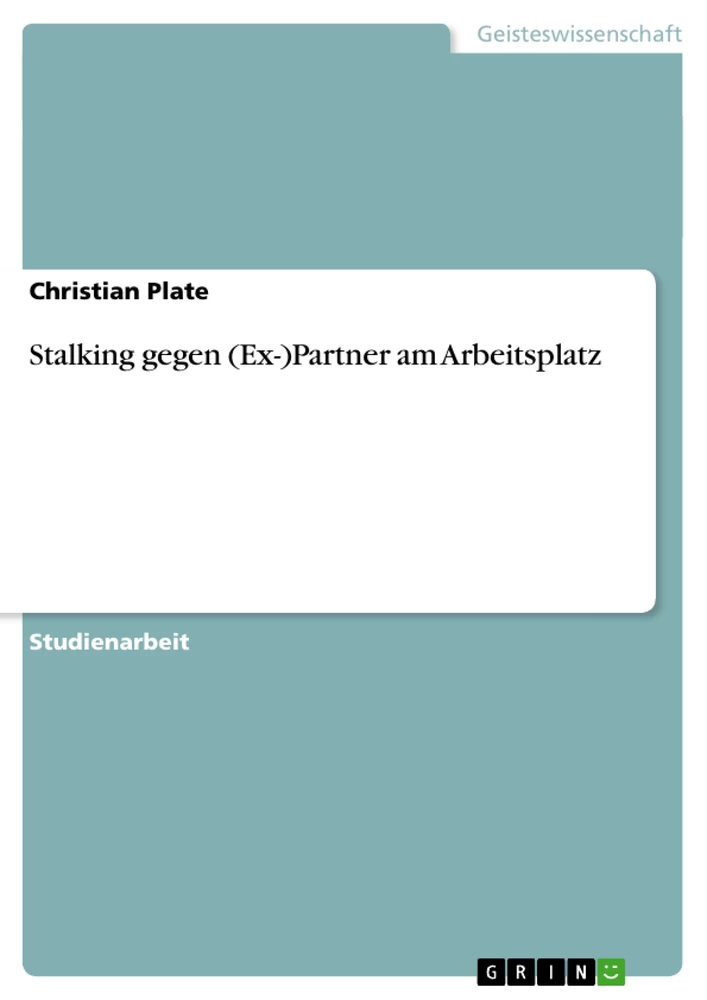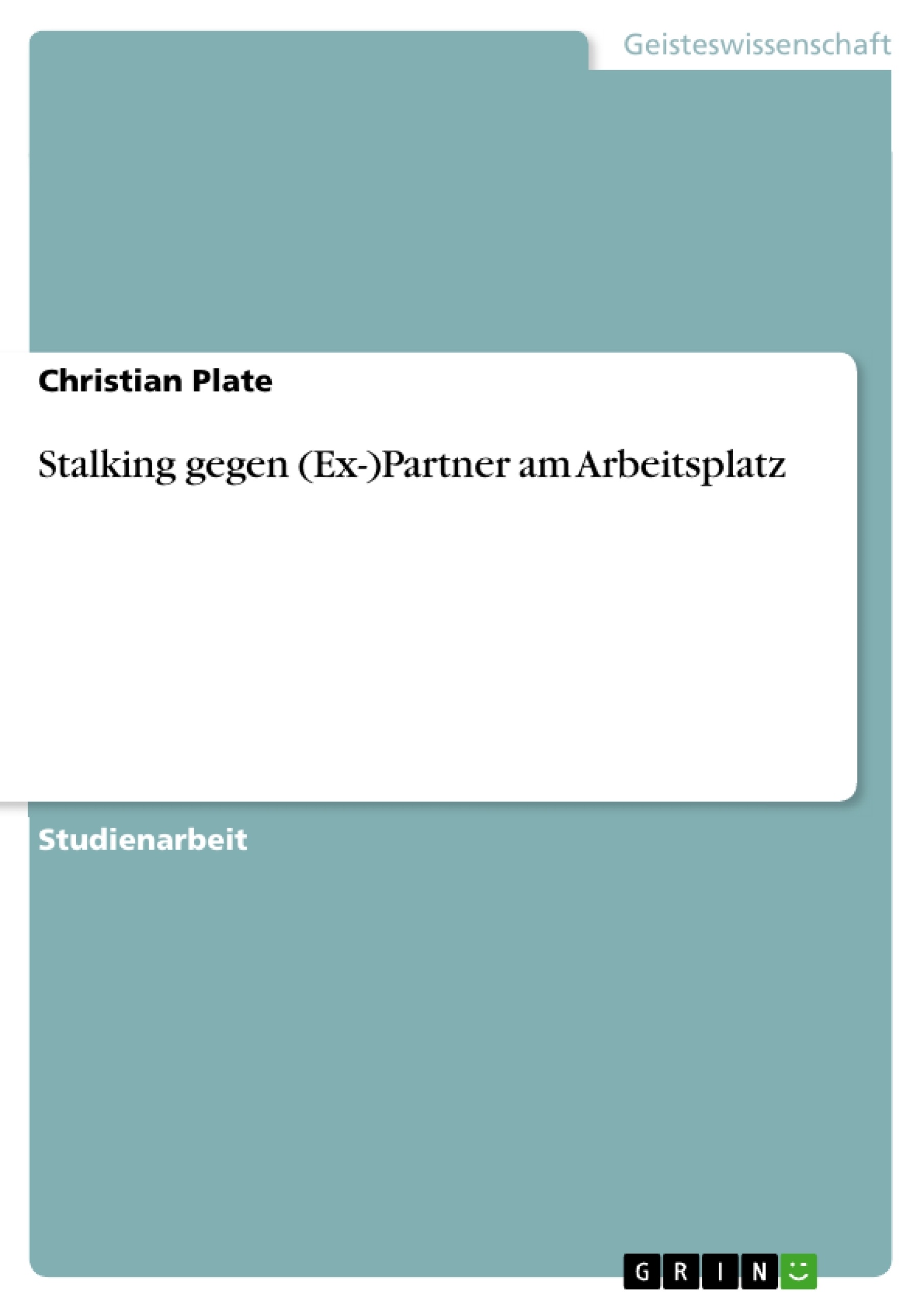Gewalt am Arbeitsplatz hemmt in den meisten Fällen das Wohlbefinden und die Leistungserbringung der Betroffenen. Auf Grund der Aufsichtspflicht jedes Arbeitgebers hat dieser unabhängig von seinem persönlichen Interesse in einem gewissen Maße für einen gewaltfreien Betriebsablauf zu sorgen und sollte daher in der Lage sein über präventive und interventive Maßnahmen entscheiden zu können. Dies gilt insbesondere für gesetzlich verbotene Straftaten.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen Stalking am Arbeitsplatz gegen (Ex-)Partner mit dem Ziel Arbeitgebern, Führungspersonen, Mitarbeitern und Stalking-Opfern in Unternehmen Möglichkeiten der Prävention bzw. Intervention aufzuzeigen. Zunächst wird in einem allgemeinen Überblick eine Definition sowie die geschichtliche Entwicklung des Stalking vorgestellt. Außerdem wird auf Erscheinungsformen und zugehörige Prävalenz eingegangen. Darüber hinaus werden Risiko- und Schutzfaktoren des Stalking dargelegt. Zum Schluss werden mit Hilfe eines Fallbeispiels auf Grundlage eines kurzen Interviews mit einem Stalking-Opfer und unter Hinzuziehen des im Laufe der Hausarbeit erarbeiteten Wissens präventive und interventive Handlungsmöglichkeiten dargestellt. Bei dem Interview wird insbesondere auf die psychische Dynamik, Gefühle und Gedanken des Opfers eingegangen um eventuelle innerbetriebliche Schwierigkeiten der Kommunikation und Zusammenarbeit hervorzuheben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeiner Überblick über das Themengebiet
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Geschichtliche Entwicklung
- 2.3 Phänomenologie und Prävalenz
- 2.3.1 Tätertypologien
- 2.3.2 Arten der Kontaktaufnahme
- 2.3.3 Beziehungskonstellationen
- 2.3.4 Dauer von Stalking-Fällen
- 2.3.5 Daten aus der Polizeilichen Kriminalstatistik
- 3. Risiko- und Schutzfaktoren
- 3.1 Risiko der Abhängigkeit
- 3.2 Risiko der Gewaltbereitschaft
- 4. Fallbeispiel
- 5. Möglichkeiten und Grenzen der Prävention
- 6. Möglichkeiten und Grenzen des Fallmanagements
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen Stalking am Arbeitsplatz, speziell im Kontext von (Ex-)Partnerschaften. Ziel ist es, Arbeitgebern, Führungskräften, Mitarbeitern und Stalking-Opfern Möglichkeiten der Prävention und Intervention aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte, um ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen.
- Definition und geschichtliche Entwicklung von Stalking
- Phänomenologie und Prävalenz von Stalking am Arbeitsplatz
- Risiko- und Schutzfaktoren im Zusammenhang mit Stalking
- Präventive und interventive Maßnahmen
- Fallbeispiel zur Veranschaulichung der Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Auswirkungen von Gewalt am Arbeitsplatz, insbesondere Stalking, auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Betroffenen. Sie hebt die Aufsichtspflicht des Arbeitgebers hervor und begründet die Notwendigkeit präventiver und interventiver Maßnahmen gegen Stalking, welches seit 2007 in §238 StGB als Nachstellung strafrechtlich verfolgt wird. Die Arbeit fokussiert auf Stalking am Arbeitsplatz zwischen (Ex-)Partnern und zielt darauf ab, Handlungsmöglichkeiten für verschiedene Akteure aufzuzeigen. Ein Fallbeispiel, basierend auf einem Interview mit einem Opfer, soll die Problematik veranschaulichen.
2. Allgemeiner Überblick über das Themengebiet: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in das Thema Stalking. Es beginnt mit Definitionen des Begriffs, die unterschiedliche Perspektiven und Interpretationen berücksichtigen, von der jagdlichen Bedeutung bis hin zu umfassenderen Definitionen, die die emotionale Wirkung auf das Opfer miteinbeziehen. Die geschichtliche Entwicklung des Verständnisses von Stalking wird ebenfalls skizziert, sowie dessen Phänomenologie und Prävalenz. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines grundlegenden Verständnisses, welches für die folgenden Kapitel essentiell ist.
Schlüsselwörter
Stalking, Nachstellung, (Ex-)Partnergewalt, Arbeitsplatz, Prävention, Intervention, Risiko- und Schutzfaktoren, Fallmanagement, psychische Beeinträchtigung, Gewalt am Arbeitsplatz, §238 StGB.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Stalking am Arbeitsplatz
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen Stalking am Arbeitsplatz, insbesondere im Kontext von (Ex-)Partnerschaften. Sie untersucht Möglichkeiten der Prävention und Intervention für Arbeitgeber, Führungskräfte, Mitarbeiter und Stalking-Opfer.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und geschichtliche Entwicklung von Stalking, Phänomenologie und Prävalenz von Stalking am Arbeitsplatz, Risiko- und Schutzfaktoren, präventive und interventive Maßnahmen, sowie ein Fallbeispiel zur Veranschaulichung der Thematik. Es werden auch Definitionen, Tätertypologien, Arten der Kontaktaufnahme, Beziehungskonstellationen und die Dauer von Stalking-Fällen beleuchtet. Die Rolle der Polizeilichen Kriminalstatistik wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Ziel der Hausarbeit ist es, ein umfassendes Verständnis von Stalking am Arbeitsplatz zu ermöglichen und Handlungsmöglichkeiten für verschiedene Akteure aufzuzeigen. Sie soll dazu beitragen, Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu verbessern und Betroffenen zu helfen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Allgemeiner Überblick über das Themengebiet (inkl. Definitionen, geschichtlicher Entwicklung, Phänomenologie und Prävalenz), Risiko- und Schutzfaktoren, Fallbeispiel, Möglichkeiten und Grenzen der Prävention, Möglichkeiten und Grenzen des Fallmanagements und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas Stalking am Arbeitsplatz.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Stalking, Nachstellung, (Ex-)Partnergewalt, Arbeitsplatz, Prävention, Intervention, Risiko- und Schutzfaktoren, Fallmanagement, psychische Beeinträchtigung, Gewalt am Arbeitsplatz, §238 StGB.
Was beinhaltet das Kapitel "Allgemeiner Überblick über das Themengebiet"?
Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in das Thema Stalking, einschließlich Definitionen aus verschiedenen Perspektiven, der geschichtlichen Entwicklung des Verständnisses von Stalking und dessen Phänomenologie und Prävalenz. Es legt die Grundlage für die folgenden Kapitel.
Was ist der Inhalt des Kapitels zu Risiko- und Schutzfaktoren?
Dieses Kapitel beleuchtet die Risiko- und Schutzfaktoren im Zusammenhang mit Stalking, beispielsweise das Risiko der Abhängigkeit und der Gewaltbereitschaft.
Welche Art von Fallbeispiel wird vorgestellt?
Die Hausarbeit enthält ein Fallbeispiel, das auf einem Interview mit einem Stalking-Opfer basiert und die Problematik veranschaulicht.
Welche Rolle spielt der §238 StGB in der Hausarbeit?
Der §238 StGB (Nachstellung) wird als rechtlicher Rahmen für Stalking erwähnt und unterstreicht die strafrechtliche Relevanz des Themas. Die Hausarbeit zeigt auf, dass Stalking seit 2007 strafrechtlich verfolgt werden kann.
Wer sind die Zielgruppen der Hausarbeit?
Die Hausarbeit richtet sich an Arbeitgeber, Führungskräfte, Mitarbeiter und Stalking-Opfer.
- Citation du texte
- Christian Plate (Auteur), 2008, Stalking gegen (Ex-)Partner am Arbeitsplatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122077