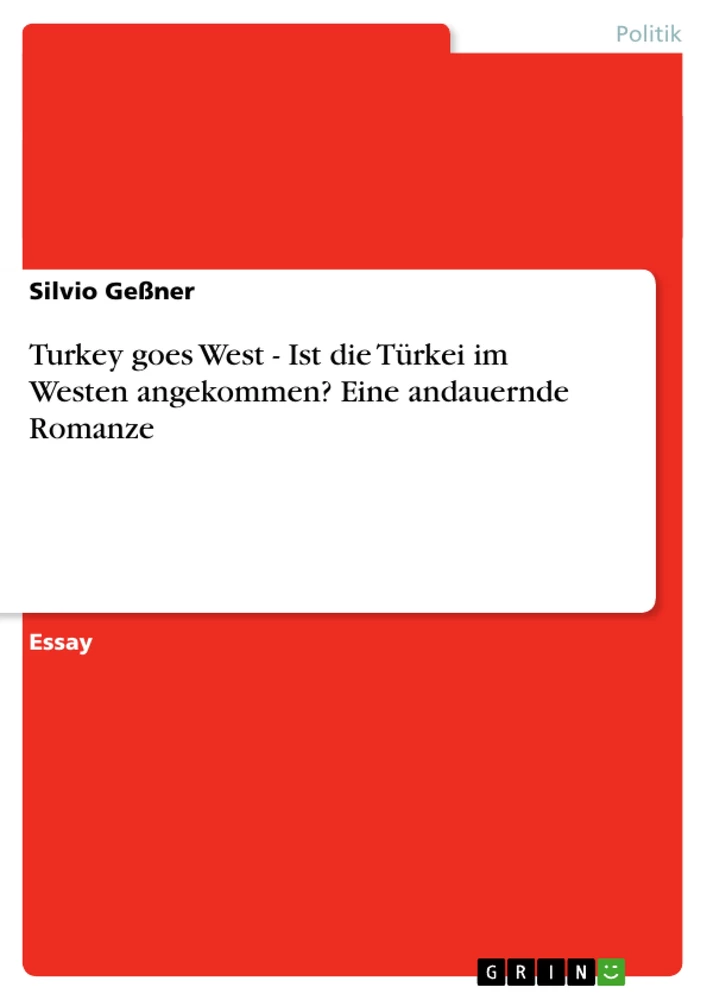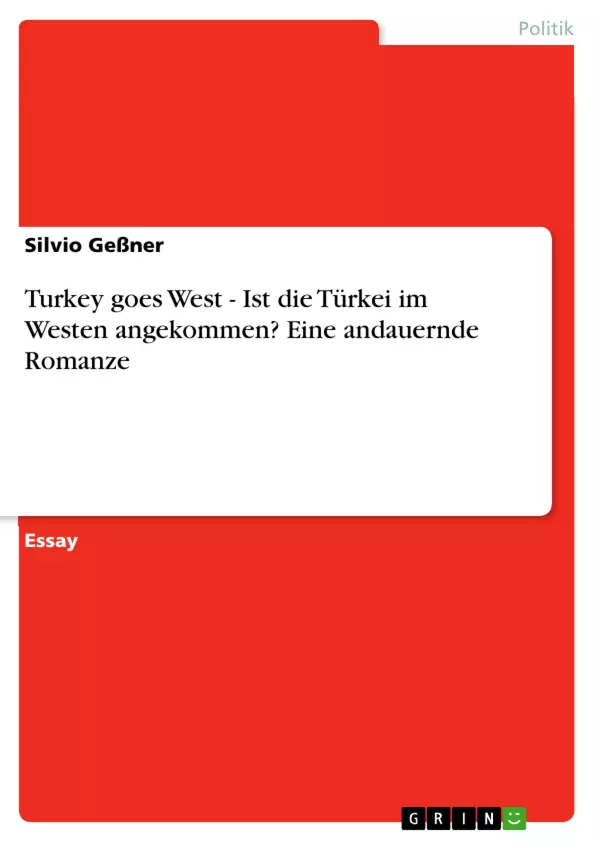„Wir nehmen nicht den Imperialismus der europäischen Staaten als Vorbild, sondern
den Fortschritt und die Weiterentwicklung“
(Mustafa Kemal Atatürk)
Die Essenz des o.g. Zitats ist meiner Meinung nach zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr gegeben.
Ist es die Türkei, die die Schranken zur EU nicht passieren möchte, oder vielmehr das Vorbildsimperium West? Bei diesem Zitat stellt sich zu Beginn für mich die Frage, ob das Konstrukt „Europäische Union“ in diesem Kontext wirklich immer noch als authentisches Vorbild fungiert. Oder lassen wir die Schranken zwischen der Türkei und der EU in der Diesigkeit des Nebels stagnieren?
In dieser Ausarbeitung zum Seminar: „Turkey goes West“ möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, ob die Türkei tatsächlich schon im Westen angekommen ist oder ob die Barriere für eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union bestehen bleiben sollte.
II.
Seit Jahrzehnten schon wirbt die Türkei um die Gunst Europas. Jedoch ist es immer nur bei einer assoziierten Partnerschaft geblieben. Eine engere Verbindung wurde seitens der Union stetig abgelehnt. Mit der Entscheidung der Europäischen Kommission auf dem Gipfel von Helsinki 1999, die Türkei in den Status eines Beitrittskandidaten zu erheben, trat eine Wende ein. Die Debatte um einen möglichen Türkei-Beitritt wurde zunehmend offensiver geführt und spaltete die Union in zwei Lager. Auf die im Vorwort von mir dargelegten Fragen werden in dieser Ausarbeitung versucht Antworten zu präzisieren und die beiden jeweiligen Positionen zu einem möglichen EU-Beitritt der Türkei vorgestellt – pro vs. contra.
Damit das Verstehen dieser Problematik überhaupt gelingt, wird vorab kurz die Entwicklung der EU – Türkei Beziehung seit der Unterzeichnung des Abkommens von Ankara im Jahr 1963 zusammenfassend dargestellt.
III.
Der Beginn der europäisch–türkischen Beziehung wird mit dem Antrag auf Annahme in die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft auf 1959 datiert. Schon einige Jahre zuvor, 1952, begannen mit dem Eintritt in die NATO die Bemühungen der Türkei sich der Westlichen Staatengemeinschaft anzuschließen. Durch den Beitritt in die EWG sollten diese fortgesetzt
Inhaltsverzeichnis
I. Vorwort
II. Einleitung
III. Genese der Türkei – EU Beziehung--Eine andauernde Romanze
IV. EU-Beitritt Türkei – pro
V. EU-Beitritt Türkei – contra
VI. Resümee
VII. Literaturverzeichnis
I. Vorwort
„Wir nehmen nicht den Imperialismus der europäischen Staaten als Vorbild, sondern den Fortschritt und die Weiterentwicklung“
(Mustafa Kemal Atatürk)
Die Essenz des o.g. Zitats ist meiner Meinung nach zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr gegeben.
Ist es die Türkei, die die Schranken zur EU nicht passieren möchte, oder vielmehr das Vorbildsimperium West ? Bei diesem Zitat stellt sich zu Beginn für mich die Frage, ob das Konstrukt „Europäische Union“ in diesem Kontext wirklich immer noch als authentisches Vorbild fungiert. Oder lassen wir die Schranken zwischen der Türkei und der EU in der Diesigkeit des Nebels stagnieren?
In dieser Ausarbeitung zum Seminar: „Turkey goes West“ möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, ob die Türkei tatsächlich schon im Westen angekommen ist oder ob die Barriere für eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union bestehen bleiben sollte.
II. Einleitung
Seit Jahrzehnten schon wirbt die Türkei um die Gunst Europas. Jedoch ist es immer nur bei einer assoziierten Partnerschaft geblieben. Eine engere Verbindung wurde seitens der Union stetig abgelehnt. Mit der Entscheidung der Europäischen Kommission auf dem Gipfel von Helsinki 1999, die Türkei in den Status eines Beitrittskandidaten zu erheben, trat eine Wende ein. Die Debatte um einen möglichen Türkei-Beitritt wurde zunehmend offensiver geführt und spaltete die Union in zwei Lager. Auf die im Vorwort von mir dargelegten Fragen werden in dieser Ausarbeitung versucht Antworten zu präzisieren und die beiden jeweiligen Positionen zu einem möglichen EU-Beitritt der Türkei vorgestellt – pro vs. contra.
Damit das Verstehen dieser Problematik überhaupt gelingt, wird vorab kurz die Entwicklung der EU – Türkei Beziehung seit der Unterzeichnung des Abkommens von Ankara im Jahr 1963 zusammenfassend dargestellt.
III. Genese der Türkei – EU Beziehung--Eine andauernde Romanze
Der Beginn der europäisch–türkischen Beziehung wird mit dem Antrag auf Annahme in die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft auf 1959 datiert. Schon einige Jahre zuvor, 1952, begannen mit dem Eintritt in die NATO die Bemühungen der Türkei sich der Westlichen Staatengemeinschaft anzuschließen. Durch den Beitritt in die EWG sollten diese fortgesetzt und gefestigt werden.
1970 wurde ein Zusatzprotokoll verabschiedet, welches die Vollendung der Zollunion festlegte. Trotz dieses außenpolitischen Erfolgs kam es zu einer Abkühlung der Beziehungen, die vorrangig auf der politisch instabilen Lage der 1960er- und 1970er Jahre zurückzuführen war. Auch die 1974 aufkommende Zypernkrise und ein weiterer Militärputsch im September 1980 verschlechterten die Beziehungen der Türkei zur EG zunehmend. Die 1982 von den Militärs erlassene neue Verfassung, welche alle politischen Rechte nur unter Vorbehalt gewährte, war mit Grund für das Aussetzen des Assoziationsabkommens im selben Jahr (vgl. Riemer: S. 40 – 41).
Am 01.01.1996 trat die Zollunion in Kraft, welche die wirtschaftlichen Entwicklungsunterschiede zwischen der Türkei und den EU-Mitgliedern vermindern sollte. Die Türkei öffnete ihren Markt für EU-Produkte, erlangte aber kein politisches Mitspracherecht (vgl. Seufert/Kubaseck: S. 174). Als darauf auf dem Luxemburger Gipfel 1997 die Türkei nicht, wie zehn andere osteuropäischen Staaten, den Status als Beitrittskandidat zugesprochen bekam, brach die Regierung in Ankara den Dialog mit der EU ab. Erst mit der Ernennung der Türkei zu einem offiziellen Beitrittskandidaten während des Gipfels in Helsinki im Dezember 1999, kam es zu einer erneuten Annäherung der beiden Partner – die Romanze nahm ihren Lauf. Durch diesen neuen Status entstanden für die Regierung in Ankara neue politische Herausforderungen. Mit der Unterzeichnung der Beitrittspartnerschaft auf dem Gipfel in Nizza im Dezember 2000 verpflichtete sich die Türkei tief greifende Reformen durchzuführen, welche die Angleichung an die Normen der Europäischen Union zum Ziel hatten, die unter den sogenannten „Kopenhagener Kriterien“ zusammengefasst sind (vgl. Auswärtiges Amt: Kopenhagener Kriterien).
Der Euphorie über diesen Erfolg folgten auch schnell Reformprozesse. Bereits im Jahr 2001 verabschiedete die Regierung ihr nationales Programm zur Umsetzung der Beitrittspartnerschaft. Dieses Programm beinhaltet Reformen, die die Türkei zur Erfüllung der Beitrittskriterien umsetzten will. Durch verschiedene innerpolitische Streitigkeiten kam der mit der Zeit auch zunehmend langsamer gewordene Reformprozess vollends ins Stocken.
Erst mit den vorgezogenen Parlamentswahlen im November 2002, aus denen Recep Tayyip Erdogan mit seiner Gerechtigkeits- und Entwicklunsgpartei (AKP) hervorging, vollzog sich ein Wandel in der türkischen Reformpolitik. Erdogan trieb die Reformprozesse deutlich voran. Durch weitere Reformpakete, die von der EU positiv aufgefasst wurden, wurden finanzielle Unterstützungen vereinbart. Hierbei ist besonders die Reform des Nationalen
Sicherheitsrates bedeutend, da diese vornehmlich von den Militärs bestimmt wurde. Mit der Reform wurden die Kompetenzen des Nationalen Sicherheitsrates auf seine verfassungsgemäß beratende Rolle eingeschränkt und somit, zumindest formal, unter die politische Kontrolle der Regierung gebracht. In anbetracht dieser Entwicklungen entschloss sich der Europäische Rat im Dezember 2004, ab Oktober des kommenden Jahres direkte Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufzunehmen, da diese nach einem Beitritt der Kommission die politischen Kriterien von Kopenhagen ausreichend erfüllte. Kurze Zeit später stellte die Kommission den sogenannten Verhandlungsrahmen vor, welcher den Verlauf der Verhandlungen regeln sollte. Ebenso verlangt dieses Dokument, dass die Türkei das europäische Gesetzes- und Regelwerk übernehmen muss und sich dabei an den politischen Kriterien von Kopenhagen und an internationalen Verträgen orientieren soll. Da aber einige dieser Verträge nicht von allen EU- Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden, kam in der Türkei die Befürchtung auf, mehr Regelungen übernehmen zu müssen als einzelne Mitglieder es bis heute tun.
Im Juni 2005 unterzeichnete die Türkei das Zusatzprotokoll zum Ankara-Abkommen von 1963. Somit wurde die Zollunion auf die 10 neuen Mitgliedsländer, einschließlich Zypern, ausgeweitet. Zur Verabschiedung des „Verhandlungsrahmens“ kam es im Oktober 2005, dem folgte der Eröffnung der Beitrittsverhandlungen. Diese wurden mit dem sogenannten
„Screening“ eingeleitet, in welche die Gesetzgebung der Türkei mit dem Recht der EU verglichen wurde (vgl. Auswärtiges Amt: Beziehung zwischen der Türkei und der europäischen Union). Seit 2006 ist dieser Prozess abgeschlossen.
Anhand dieser und aktueller Entwicklungen ist es abzusehen, dass die Verhandlungen sich noch über einen langen Zeitrahmen hinziehen werden, da in dieser, von mit betitelter Romanze, nicht immer Übereinstimmung herrscht. Hinzu kommt, dass die Türkei-Debatte nichts von ihrer Brisanz verloren hat.
Im Folgenden sollen die beiden Positionen der Debatte näher beleuchtet werden.
IV. EU-Beitritt Türkei– pro
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptgegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Analyse der Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union, insbesondere im Hinblick auf einen möglichen EU-Beitritt der Türkei.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis aufgeführt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst ein Vorwort, eine Einleitung, die Genese der Türkei-EU-Beziehung, Argumente für und gegen einen EU-Beitritt der Türkei, ein Resümee und ein Literaturverzeichnis.
Was wird im Vorwort angesprochen?
Das Vorwort behandelt die Frage, ob die Türkei die Bedingungen für einen EU-Beitritt nicht erfüllen möchte oder ob die EU Hindernisse schafft. Es stellt die Frage, ob die EU noch als Vorbild dient und ob die Türkei bereits im Westen angekommen ist.
Welche Informationen enthält die Einleitung?
Die Einleitung beschreibt die langjährige Bemühung der Türkei um die Gunst Europas und die Entscheidung von 1999, die Türkei als Beitrittskandidaten anzuerkennen. Sie erwähnt die Spaltung der Union in Bezug auf einen möglichen Beitritt und stellt die Frage nach den Positionen pro und contra.
Was wird im Abschnitt zur Genese der Türkei-EU-Beziehung behandelt?
Dieser Abschnitt beschreibt die Entwicklung der Beziehungen seit dem Abkommen von Ankara im Jahr 1963, einschließlich des Antrags auf Annahme in die EWG, des Zusatzprotokolls von 1970, der Zypernkrise, des Militärputsches von 1980, der Zollunion von 1996 und der Ernennung zum Beitrittskandidaten im Jahr 1999. Außerdem werden die Reformprozesse und Verhandlungen seit 2000 erläutert.
Welche Argumente werden für einen EU-Beitritt der Türkei angeführt?
Befürworter sehen im EU-Beitritt der Türkei eine Chance, eine Brücke zwischen den Kulturen zu schlagen und die Türkei als Vorbild für islamische Staaten zu etablieren. Die geostrategische und sicherheitspolitische Rolle der Türkei wird ebenfalls als Vorteil genannt.
Was sind die "Kopenhagener Kriterien"?
Die Kopenhagener Kriterien sind eine Reihe von Bedingungen, die ein Beitrittskandidat erfüllen muss, um in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Diese beinhalten politische Stabilität, eine funktionierende Marktwirtschaft und die Übernahme des EU-Rechts.
Was ist das Ankara-Abkommen?
Das Ankara-Abkommen von 1963 ist ein Assoziierungsabkommen zwischen der Türkei und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), dem Vorläufer der Europäischen Union. Es markiert den Beginn der formellen Beziehungen zwischen der Türkei und Europa und diente als Grundlage für eine schrittweise Integration.
Was beinhaltete die Zollunion von 1996?
Die Zollunion von 1996 öffnete den türkischen Markt für EU-Produkte, verminderte wirtschaftliche Entwicklungsunterschiede, gewährte der Türkei jedoch kein politisches Mitspracherecht.
Was ist der "Verhandlungsrahmen"?
Der Verhandlungsrahmen ist ein Dokument, das den Verlauf der Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und der Türkei regelt. Er verlangt von der Türkei die Übernahme des europäischen Gesetzes- und Regelwerks und die Einhaltung der politischen Kriterien von Kopenhagen und internationaler Verträge.
- Citation du texte
- Silvio Geßner (Auteur), 2009, Turkey goes West - Ist die Türkei im Westen angekommen? Eine andauernde Romanze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122237