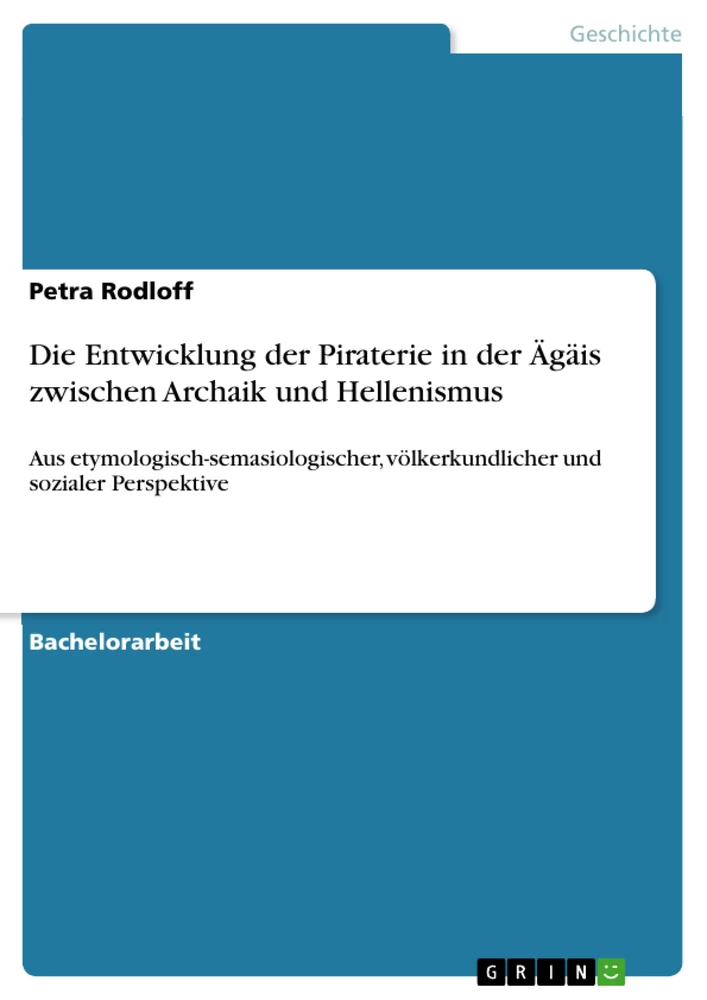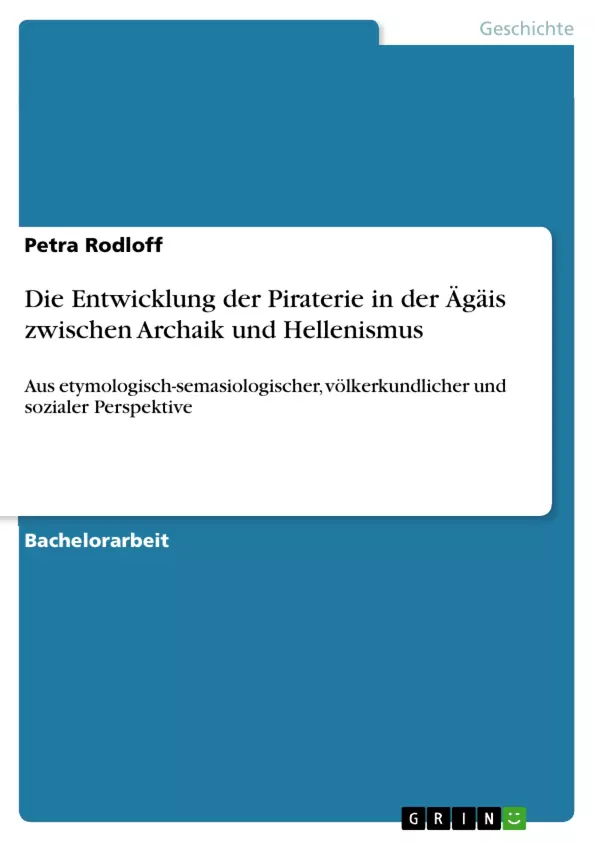Die sich entwickelnden Typen von Piraterie herauszuarbeiten, ist das Bestreben der Arbeit. Aus diesem Grund werde ich nach der Klärung der Bedeutung der literarisch genutzten griechischen Piraterie-Begriffe das zweite Kapitel der Entwicklung der ägäischen Piraterie vom Seevölkersturm bis zum Hellenismus widmen. Im daran anschließenden dritten Teil gehe ich in Hinblick auf die völkerkundliche und soziale Dimension der ägäischen Piraterie der Frage nach, warum in der antiken Historiographie ausschließlich die ägäischen Randvölker der Piraterie bezichtigt werden, nicht jedoch die Angehörigen des zivilen Griechenlands, für dessen kulturell führende Poleis die Anti-Piraterie-Kampagnen für Selbstbild und Legitimierung ihrer See-Herrschaft wichtiger sind als die Sache selbst. Eine Begründung für diese Haltung ist in der aktiven Beteiligung der zivilisatorisch fortschrittlichen Poleis beziehungsweise Angehöriger der führenden Bürgerschicht an dieser zu ersehen. Im Fazit erwarte ich nachzuweisen, dass griechische, aus den höheren Schichten stammende Söhne der Poleis Piraterie aufgrund einer beibehaltenen archaischen Kriegermentalität betrieben haben.
Aus Sicht des Aristokraten Platon scheint die Frage, wer die Welt beherrscht, müßig: Mit dem Gleichnis der um einem Teich sitzenden Frösche sind die von aristokratischen Familien politisch dominierten griechischen Städte als Zentren der Zivilisation gemeint. Vom Land aus beherrschen sie das Meer, nutzen es für ihre Zwecke, ohne jedoch selbst ein Teil davon zu sein. Platon betont in seiner Allegorie den räuberischen Landanteil der Lurche, die das Wasser für ihre Bedürfnisse nutzen und sich von ihrem trockenen Standort am Rande des Teiches aus darüber als Herrscher gebärden; dabei beachtet er nicht den verletzlicheren Wasseranteil dieser Tiere, welcher bei Amphibien aller Art der entscheidende ist: Im Wasser pflanzen sie sich fort, verbringen ihr Larvenstadium als Kaulquappen ausschließlich unter der Wasseroberfläche. Noch den erwachsenen Tieren ist das Wasser eine Notwendigkeit des Überlebens: Ohne dieses trocknen sie, schutzlos der Sonne ausgesetzt, aus. Daher ist die Frosch-Metapher – mag sie noch so lyrisch sein – als propagandistisches Eigen-Bildnis des klassisch-platonischen Griechentums zu bewerten und nicht als allgemein gültige Tatsächlichkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Wer sind die Frösche des Teiches?
- 1. Piraten - Ein komplexes Wortfeld aus etymologisch-semasiologischer Sicht
- 2. Die Entwicklung der Piraterie im ägäischen Raum
- 2.1. Beginnende Eisenzeit - Erste Hinweise auf Piraterie im östlichen Mittelmeerraum
- 2.2. Archaik - Im Spannungsfeld von Handel und Krieg
- 2.3. Klassik - Von Skyros über den Delisch-Attischen Seebund zu Philipp II. von Makedonien
- 2.3.1. Die (Wieder-)Entdeckung eines Heros auf der Pirateninsel
- 2.3.2. Der Delisch-Attische Seebund als Vereinigung politisierter Piraten
- 2.4. Hellenismus – Von Gebundenheit über Selbstbegrenzung zur Freiheit
- 2.4.1. Antikes Freibeutertum
- 2.4.2. Selbstbegrenzung durch asylia-Vergabe
- 2.4.3. Freiheit
- 2.5. Zusammenfassung: Entwicklung der antiken Piraterie in der Ägäis
- 3. Die völkerkundliche und soziale Dimension der ägäischen Piraterie(n)
- 3.1. Plädoyer im Sinne der angeklagten Völker
- 3.2. Der ursprüngliche soziale Stand der antiken Piraten
- 3.3. Zusammenfassung: ethnos, Stand und „raid mentality“
- Fazit: Die Frösche im Teich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Piraterie in der Ägäis von der Archaik bis zum Hellenismus. Sie verfolgt das Ziel, die Piraterie nicht nur als ein militärisch-ökonomisches Phänomen zu betrachten, sondern auch ihre völkerkundlichen und sozialen Dimensionen zu beleuchten. Die Arbeit hinterfragt gängige Darstellungen und analysiert die Rolle verschiedener Akteure.
- Etymologisch-semasiologische Analyse des Begriffs „Pirat“
- Entwicklung der Piraterie in der Ägäis über verschiedene historische Perioden
- Soziale und völkerkundliche Aspekte der Piraterie
- Die Rolle der griechischen Poleis im Kampf gegen die Piraterie
- Die Motivation und das soziale Umfeld antiker Piraten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Wer sind die Frösche des Teiches?: Die Einleitung verwendet Platons Gleichnis der Frösche am Teich, um die Perspektive der griechischen Poleis auf das Meer und die Piraterie zu hinterfragen. Sie kritisiert die einseitige Sichtweise der Landbevölkerung, die das Meer als Ressource betrachtet, ohne dessen Gefahren und die Abhängigkeit von ihm zu erkennen. Die Arbeit stellt die These auf, dass die Piraten oft aus der Oberschicht stammten und ihre Tätigkeit als eine Art archaische Form der Kriegsführung verstanden werden kann.
1. Piraten - Ein komplexes Wortfeld aus etymologisch-semasiologischer Sicht: Dieses Kapitel analysiert die etymologische und bedeutungsmäßige Entwicklung des Begriffs „Pirat“ in verschiedenen Sprachen. Es zeigt die Schwierigkeit auf, den Begriff präzise zu definieren und verweist auf die unterschiedlichen Konnotationen in verschiedenen historischen Kontexten. Die Analyse bildet die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es die semantischen Grenzen des Begriffs und damit die Komplexität des Phänomens Piraterie aufzeigt.
2. Die Entwicklung der Piraterie im ägäischen Raum: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Piraterie in der Ägäis von der beginnenden Eisenzeit bis zum Hellenismus. Es analysiert die Veränderungen des Phänomens im Kontext von Handel, Krieg und politischen Entwicklungen. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen Piraten und den griechischen Stadtstaaten sowie auf dem Wandel der Strategien und des sozialen Hintergrunds der Piraten über die Jahrhunderte. Die Kapitel 2.1-2.4 analysieren die Entwicklung in verschiedenen Epochen, vom anfänglichen Auftreten bis zur relativen Bedeutungslosigkeit im Hellenismus nach verschiedenen Maßnahmen zur Eindämmung des Piratenwesens.
3. Die völkerkundliche und soziale Dimension der ägäischen Piraterie(n): Dieses Kapitel untersucht die völkerkundlichen und sozialen Aspekte der Piraterie. Es befasst sich mit der Frage, warum in der antiken Geschichtsschreibung vor allem Randvölker als Piraten bezeichnet wurden, während die Beteiligung von Angehörigen der griechischen Poleis heruntergespielt wurde. Es hinterfragt die gängige Darstellung der Piraterie als ausschließlich kriminelles Phänomen und analysiert den sozialen Hintergrund der Piraten sowie deren Strategien und Motive. Das Kapitel hinterfragt die einseitige Darstellung und sucht nach Erklärungen für das Schweigen über die Beteiligung der zivilisatorisch führenden Poleis an der Piraterie. Die Analyse von ethnischen und sozialen Aspekten soll das Gesamtbild des Phänomens Piraterie vervollständigen.
Schlüsselwörter
Piraterie, Ägäis, Antike, Hellenismus, Archaik, Etymologie, Semasiologie, Völkerkunde, Sozialgeschichte, Griechenland, Handel, Krieg, Poleis, Randvölker, Seeraub, Freibeutertum.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Die Frösche des Teiches - Piraterie in der Ägäis"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Piraterie in der Ägäis von der Archaik bis zum Hellenismus. Sie betrachtet Piraterie nicht nur als militärisch-ökonomisches Phänomen, sondern beleuchtet auch die völkerkundlichen und sozialen Dimensionen.
Welche Aspekte der Piraterie werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die etymologisch-semasiologische Analyse des Begriffs „Pirat“, die Entwicklung der Piraterie in verschiedenen historischen Perioden, die sozialen und völkerkundlichen Aspekte, die Rolle der griechischen Poleis im Kampf gegen die Piraterie sowie die Motivation und das soziale Umfeld antiker Piraten.
Welche Zeiträume werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit deckt den Zeitraum von der beginnenden Eisenzeit über die Archaik und die Klassik bis zum Hellenismus ab.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel und ein Fazit. Kapitel 1 analysiert den Begriff „Pirat“, Kapitel 2 untersucht die Entwicklung der Piraterie im ägäischen Raum, Kapitel 3 betrachtet die völkerkundlichen und sozialen Dimensionen, und das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche These vertritt die Arbeit?
Die Arbeit stellt die These auf, dass die Piraten oft aus der Oberschicht stammten und ihre Tätigkeit als eine Art archaische Form der Kriegsführung verstanden werden kann. Sie kritisiert die einseitige Sichtweise der Landbevölkerung, die das Meer als Ressource betrachtet, ohne dessen Gefahren und die Abhängigkeit von ihm zu erkennen.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine etymologisch-semasiologische Analyse des Begriffs „Pirat“, untersucht historische Quellen und analysiert die Entwicklung der Piraterie im Kontext von Handel, Krieg und politischen Entwicklungen. Sie beleuchtet völkerkundliche und soziale Aspekte und hinterfragt gängige Darstellungen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Piraterie in der Ägäis ein komplexes Phänomen war, das eng mit den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen der Zeit verbunden war. Sie hinterfragt die einseitige Darstellung der Piraterie als ausschließlich kriminelles Phänomen und betont die Notwendigkeit, die verschiedenen Perspektiven und Akteure zu berücksichtigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Piraterie, Ägäis, Antike, Hellenismus, Archaik, Etymologie, Semasiologie, Völkerkunde, Sozialgeschichte, Griechenland, Handel, Krieg, Poleis, Randvölker, Seeraub, Freibeutertum.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler und Studierende der Altertumswissenschaften, Geschichte und verwandter Disziplinen gedacht, die sich für die antike Geschichte und die Sozialgeschichte des Mittelmeerraums interessieren. Der Fokus liegt auf einer wissenschaftlichen und strukturierten Analyse der Thematik.
- Quote paper
- Petra Rodloff (Author), 2016, Die Entwicklung der Piraterie in der Ägäis zwischen Archaik und Hellenismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1222946