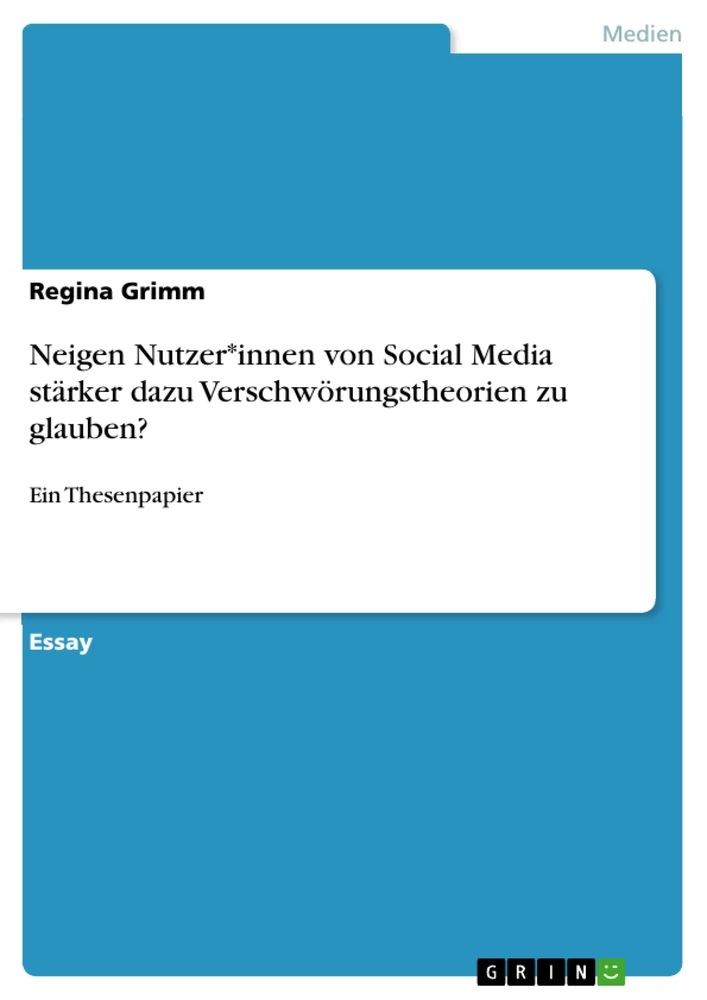In Krisenzeiten, wie beispielsweise während der Covid-19-Pandemie, ist eine erfolgreiche Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse an die nicht wissenschaftliche Bevölkerung unabdingbar für eine Orientierung dieser an wissenschaftlichen Empfehlungen und das Einhalten der daraus abgeleiteten politischen Maßnahmen. Diese Kommunikation wird jedoch durch die zunehmende Verbreitung von Falschinformation in den Medien gefährdet. Betroffen sind dabei vor allem soziale Medien wie Instagram, Twitter oder Telegramm, in denen sich fehlerhafte, deutlich von den wissenschaftlichen Erkenntnissen abweichende Informationen mit teilweise verschwörungsideologischen Elementen schnell verbreiten. Derweil stellen soziale Medien laut dem „Reuters Institute Digital News Report 2019“ eine immer wichtigere Informationsquelle für viele Menschen dar. Aus diesem Grund bezeichnete die Weltgesundheitsorganisation die Informationslage um die Corona-Pandemie schon im Februar des Jahres 2020 als „Infodemie“, welche es der Bevölkerung erschwere, zwischen wissenschaftlich fundierter und fehlerhafter Information zu unterscheiden. Problematisch sind hier zum einen mutwillig verbreitete Falschinformationen, zum anderen aber auch Falschinformationen, die unwissentlich von Nutzer*innen verbreitet werden, ohne ihren Wahrheitsgehalt vorher zu überprüfen. Im Folgenden wird die These, dass Personen, die sich einen Großteil ihrer Informationen über Social Media Plattformen beschaffen, stärker dazu neigen, Falschinformationen und Verschwörungstheorien zu glauben und zu vertreten, diskutiert.
Thesenpapier
In Krisenzeiten, wie beispielsweise wahrend der Covid-19-Pandemie, ist eine erfolgreiche Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse an die nicht wissenschaftliche Bevolkerung unabdingbar fur eine Orientierung dieser an wissenschaftlichen Empfehlungen und das Einhalten der daraus abgeleiteten politischen MaRnahmen. Diese Kommunikation wird jedoch durch die zunehmende Verbreitung von Falschinformation in den Medien gefahrdet. Betroffen sind dabei vor allem soziale Medien wie Instagram, Twitter oder Telegramm, in denen sich fehlerhafte, deutlich von den wissenschaftlichen Erkenntnissen abweichende Informationen mit teilweise verschworungsideologischen Elementen schnell verbreiten. Derweil stellen soziale Medien laut dem „Reuters Institute Digital News Report 2019“ eine immer wichtigere Informationsquelle fur viele Menschen dar. Aus diesem Grund bezeichnete die Weltgesundheitsorganisation die Informationslage um die Corona-Pandemie schon im Februar des Jahres 2020 als „Infodemie“, welche es der Bevolkerung erschwere, zwischen wissenschaftlich fundierter und fehlerhafter Information zu unterscheiden (Weltgesundheitsorganisation 2020: 13). Problematisch sind hier zum einen mutwillig verbreitete Falschinformationen, zum anderen aber auch Falschinformationen, die unwissentlich von Nutzer*innen verbreitet werden, ohne ihren Wahrheitsgehalt vorher zu uberprufen (Pennycook et al. 2020: 20).
Im Folgenden wird die These, dass Personen, die sich einen GroRteil ihrer Informationen uber Social Media Plattformen beschaffen, starker dazu neigen, Falschinformationen und Verschworungstheorien zu glauben und zu vertreten, diskutiert. Unter Verschworungstheorien werden in diesem Kontext mutwillig verbreitete Falschinformationen verstanden, die auf der Annahme basieren, dass wichtige Geschehnisse durch machtige Gruppen in Unwissenheit von der Offentlichkeit gelenkt werden (Bundeszentrale fur politische Bildung). Globale Krisen, wie die Corona-Pandemie, wirken wie Katalysatoren fur Verschworungstheorien, da diese einfache Antworten auf komplexe Fragen liefern, die sonst existenzielle Angste und Unsicherheit in den Menschen auslosen. Unter sozialen Medien werden in dieser Arbeit Internetplattformen verstanden, die der - haufig profilbasierten - Vernetzung von Nutzer*innen und deren Kommunikation und Kooperation uber das Internet dienen (Wirtschaftslexikon). Beruhmte Beispiele fur soziale Medien sind Facebook, Instagram, YouTube, Twitter sowie Telegramm.
Ein Argument, das fur die These spricht, ist, dass soziale Medien sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sich dort jeder der Offentlichkeit mitteilen kann. Wahrend in herkommlichen Medien wie den Zeitungen, dem Fernsehen und dem Radio veroffentlichte Informationen und Beitrage erstmal den redaktionellen Filter durchlaufen mussen, kann auf sozialen Netzwerken jede beliebige Person fast ungefiltert Informationen veroffentlichen. Dies hat den Vorteil, dass die Medien- und Meinungslandschaft dadurch diverser ist und mehr Moglichkeiten fur politische Partizipation bestehen. Jedoch bringt der fehlende Filter auch den Nachteil mit sich, dass Informationen ungepruft an die Offentlichkeit gelangen. Damit stellen soziale Netzwerke eine Infrastruktur dar, in der sich Falschinformationen schnell und weit verbreiten konnen (Vosoughi et al. 2018: 5). Die Plattformen Facebook und Twitter sperren zwar Konten, die wiederholt und nachgewiesen Falschinformationen verbreiten, jedoch verlauft die Kommunikation auf dem Nachrichtendienst Telegramm komplett ohne Filter. Dort verbreitete beispielsweise Attila Hildmann bis vor kurzem in einer Gruppe mit uber 100.000 Mitglieder*innen seine Verschworungstheorie, dass hinter der Corona-Pandemie eine Verschworung steckt (Becker et al. 2021: 15).
Seminar Mediennutzung und -wirkung
Regina Grimm
27.07.2021
Des Weiteren zeichnen sich soziale Medien dadurch aus, dass die veroffentlichten Beitrage von kurzer Lange sind und die Nutzer*innen nur eine kurze Zeit bei einem Beitrag verweilen und schnell zum nachsten wechseln. Die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer*innen auf diesen Plattformen ist deutlich geringer als bei herkommlichen Medien wie dem Fernsehen oder Print-Medien (Becker et al. 2021: 22). Dadurch wird deutlich schneller zum nachsten Beitrag gescrollt als beispielsweise der nachste Artikel einer Zeitung gelesen wird. Die Konsequenz ist, dass die Ersteller*innen von Beitragen versuchen die Aufmerksamkeit der Nutzer*innen auf ihre Inhalte zu ziehen, indem ihre Beitrage starke Emotionen bei diesen auslosen. Dieser Uberlegung liegt der dynamisch-transaktionale Ansatz von Werner Fruh und Klaus Schonbach zugrunde, der besagt, dass Medien und Rezipient*innen beide sowohl aktive als auch passive Teilnehmer*innen im Kommunikationsprozess sind und sich gegenseitig beeinflussen (Fruh/ Schonbach 2005: 17). Das Uberangebot an Beitragen auf sozialen Medien fuhrt so zu einer geringeren Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer*innen. Diese fuhrt wiederum dazu, dass Ersteller*innen ihre Beitrage zunehmend emotionalisieren wollen, um gegen ihre Konkurrenz um die kurze Aufmerksamkeit der Nutzer*innen zu bestehen (Lischka/ Stocker 2017: 29). Zu diesem Zweck werden Inhalte ebenfalls oft verallgemeinert und Themen nicht differenziert, sondern radikal betrachtet, um zu polarisieren und damit viel Aufmerksamkeit auf den eigenen Beitrag zu ziehen. Neben moglichen kommerziellen Interessen stellen hohe Klickzahlen, Likes und Kommentare fur die Ersteller*innen der Beitrage soziale Anerkennung dar, die sie anstreben. Dadurch kann es leicht passieren, dass zu echten Informationen immer wieder etwas dazugedichtet wird und sie somit verfalscht werden. Dies kann entweder willentlich oder aber auch unwissentlich geschehen. Somit bieten soziale Netzwerke nicht nur eine Infrastruktur, in der sich Falschinformationen schnell verbreiten, sondern fordern durch ihre Funktionsweise teilweise die Generalisierung, Emotionalisierung und somit Verfalschung von Informationen.
Zudem kommt hinzu, dass willentlich verbreitete Falschinformationen, sogenannte „Fake News“, auf sozialen Medien sogar ofters verbreitet werden als auf wahren Tatsachen beruhende Meldungen. Laut einer Studie des Massachusetts Institute of Technology, die die Verbreitung von Meldungen auf der Plattform Twitter untersucht hat, kommen Falschmeldungen etwa sechsmal schneller bei 1500 Usern an als eine richtige Information (Vosoughi et al. 2018: 3). Der Grund dafur ist zum einen, dass Falschinformationen oft als spannender erachtet werden, da sie meist emotionaler und skandaloser sind und dadurch die Aufmerksamkeit starker auf sich ziehen als auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Informationen. Zum anderen liefern in Verschworungstheorien eingebundene Falschmeldungen oft einfache Erklarungen fur komplexe Probleme und Angste, wahrend wissenschaftliche Erkenntnisse die Komplexitat eines Phanomens in vielen Fallen zusatzlich steigern (Nocun/ Lamberty 2020: 20). Somit haben es Falschmeldungen und Verschworungstheorien teilweise einfacher, sich auf sozialen Medien Gehor zu verschaffen als wahrheitsgetreue Informationen.
Das Prinzip der selektiven Zuwendung besagt, dass Menschen sich bevorzugt den Medieninhalten aussetzen, die ihre bestehenden Einstellungen bestatigen und diese als Konsequenz somit verstarkt werden (Bonfadelli/ Friemel 2015: 55). Wenn Personen also dadurch, dass sie den GroRteil ihrer Informationen uber Social Media beziehen, ofters in Verschworungstheorien eingebundenen Falschinformationen ausgesetzt sind und diese glauben, kann dies dazu fuhren, dass sie auch in Zukunft ihre Aufmerksamkeit vor allem auf Beitrage richten, die diese Sichtweise bestatigen und dadurch noch mehr Falschinformationen konsumieren. Dieses Prinzip lasst sich sowohl auf die aktive Auswahl von Medien wie auch die passive Exposition gegenuber Medienangeboten anwenden (Bonfadelli/ Friemel
Seminar Mediennutzung und -wirkung
Regina Grimm
27.07.2021
2015: 189) - also sowohl auf Beitrage, die Personen bewusst anklicken und konsumieren als auch die Beitrage auf denen unterbewusst ihre Aufmerksamkeit, beispielsweise beim Scrollen durch Instagram, hangen bleibt. Die Funktionsweise von vielen Social Media Plattformen fordert diese Entwicklung zudem dadurch, dass sogenannte „Filterblasen“ gebildet werden. Filterblasen entstehen, weil soziale Netzwerke basierend auf den verfugbaren Informationen wie dem Klickverhalten der Nutzer*innen, versuchen algorithmisch vorauszusagen, welche Informationen diese auffinden mochten, und ihnen diese vorschlagen. Das Ergebnis ist eine Isolation gegenuber Informationen, die nicht dem Standpunkt des/der Nutzer*in entsprechen (Pariser 2011: 151). Die Konsequenz ist, dass Nutzer*innen weniger widerspruchliche Informationen zu Verschworungstheorien auffinden, wenn sie einmal in einer solchen Filterblase sind, und diese somit eher glauben. Zudem werden Inhalte auf YouTube, mit denen ein/e Nutzer*in viel Zeit verbringt, durch die auf dem Algorithmus basierenden Videovorschlage teilweise sogar radikalisiert. So kommt ein/e Nutzer*in durch wenige algorithmisch ausgewahlte Videovorschlage von einer Reportage uber Querdenkerdemonstrationen zu Videos von Verschworungstheoretiker*innen (Lamberty/ Nocun 2020: 223). Der Grund dafur ist, dass die Betreiber*innen von YouTube davon ausgehen, dass, je spannender und skandaloser die Inhalte sind, Nutzer*innen mehr Zeit auf ihrer Plattform verbringen und sie somit mehr Geld mit der Schaltung von Werbung verdienen.
Hinzu kommt, dass Personen, die den GroRteil ihrer Informationen aus sozialen Netzwerken beziehen, im Durchschnitt einen niedrigeren Bildungsstand haben, als Personen, die ihre Informationen hauptsachlich aus herkommlichen Medien beziehen (Ziemer et al. 2021: 31). Der Bildungsstand spielt ebenfalls eine Rolle bei der Frage, ob eine Person Verschworungstheorien glaubt oder sogar selbst verbreitet. Die Theorie der Wissenskluft besagt zum einen, dass Menschen mit besserer Schulbildung erhohte Medienkompetenz aufweisen und die Qualitat von Informationen, die durch die Medien vermittelt werden, somit besser einschatzen konnen (Jackel 2011: 326). Somit erkennen Menschen mit hoherer Bildung Falschinformationen im Durchschnitt schneller und ofters als solche, wahrend Menschen mit niedrigerer Bildung diese ofters glauben und dadurch anfalliger fur Verschworungstheorien sind. Zum anderen konnen sich gesellschaftliche Gruppen mit viel Vorwissen deutlich schneller und einfacher neues Wissen aneignen, als Gruppen mit weniger Vorwissen. Die dynamische Entwicklung von globalen Krisen stellt fur groRe Teile der Bevolkerung eine groRe kognitive Herausforderung dar. Menschen mit niedrigem Bildungsstand sind von den Ambiguitaten und Unsicherheiten, die Krisen oft mit sich bringen, teilweise uberfordert und wunschen sich einfachere Erklarungen. Diese bieten ihnen Verschworungstheorien. Ein entsprechender Zusammenhang von geringerer kognitiver Verarbeitungstiefe und der Anfalligkeit fur Verschworungstheorien im Rahmen von Covid-19 konnte empirisch festgestellt werden (Alper et al. 2020; Pennycook et al. 2020).
Ziemer, Farkhari und Rothmund untersuchten in einer Studie im Jahre 2020 verschiedene Einflussfaktoren auf konspiratives Denken im Rahmen der Covid-19-Krise, sowie auf die Pandemieleugnung. Dafur erfassten sie mitunter die bevorzugte Medienwahl der befragten Personen und verglichen ihre Einschatzungen zur Corona-Pandemie mit den Einschatzungen von Expert*innen. Es konnte festgestellt werden, dass die beiden Gruppen der „Ablehnenden“ und „Zweifelnden“, deren Einschatzungen am weitesten von denen der Expert*innen abwichen und die teilweise konspirative Denkmuster aufwiesen, ihre Informationen zu Covid-19 hauptsachlich aus sozialen Medien und weniger aus dem offentlich-rechtlichen Fernsehen bezogen. Im Gegensatz dazu bezogen die anderen
Seminar Mediennutzung und -wirkung
Regina Grimm
27.07.2021
beiden Gruppen, deren Einschatzungen besser mit denen der Expert*innen zusammenpassten, ihre Informationen verstarkt aus dem offentlich-rechtlichen Fernsehen. In einer weiteren Studie, die im „Harvard Kennedy School Misinformation Review“ veroffentlicht wurde, konnte festgestellt werden, dass Personen, die sich zur Lage um Covid-19 groRtenteils uber soziale Medien informierten, deutlich ofters Falschinformationen konsumiert haben und in der Konsequenz schlechter uber die Gefahren der Corona-Pandemie sowie notwendige SchutzmaRnahmen aufgeklart waren (Bridgman et al. 2020). AbschlieRend lasst sich sagen, dass die Infrastruktur von sozialen Medien die Verbreitung und den Glauben an Verschworungstheorien deutlich starker fordert als herkommliche Medien. Durch den weitestgehend fehlenden Filter der Beitrage, die gepostet werden, konnen Falschinformationen und Verschworungstheorien in den meisten Fallen ungehindert verbreitet werden. Zudem setzt die Funktionsweise von sozialen Netzwerken Anreize an die Ersteller*innen von Beitragen, die darin transportierte Information zu generalisieren und zu emotionalisieren, da diese Beitrage im Durchschnitt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dadurch konnen Informationen auch unwissentlich verfalscht werden. Des Weiteren werden Falschnachrichten auf sozialen Medien sogar schneller verbreitet als wahre Informationen, wodurch Anreize gesetzt werden, Falschinformationen mutwillig zu erstellen und zu verbreiten. Durch diese drei Mechanismen werden Personen, die den GroRteil ihrer Informationen uber soziale Netzwerke beziehen, deutlich starker Falschinformationen und Verschworungstheorien ausgesetzt als Personen, die ihre Informationen aus herkommlichen Quellen beziehen. Zusatzlich fordert der Algorithmus der meisten sozialen Netzwerke die Bildung von Filterblasen, in denen Personen, die sich fur Verschworungstheorien interessieren, von kontraren Informationen weitestgehend isoliert werden. Dadurch verstarken die Plattformen den schon bestehenden Effekt der selektiven Zuwendung. Hinzu kommt, dass Menschen, die den GroRteil ihrer Informationen uber soziale Netzwerke beziehen, im Durchschnitt einen niedrigeren Bildungsstand haben, wodurch sie per se anfalliger fur Verschworungstheorien sind. Der positive Zusammenhang zwischen der Nutzung von Social Media als Informationsquelle und dem Glauben an Verschworungstheorien konnte empirisch bestatigt werden. Jedoch hangt die Anfalligkeit fur Verschworungstheorien ebenfalls von anderen Faktoren wie dem Bildungsstand oder dem Umgang mit Ambiguitaten, Unsicherheiten und ungeklarten Sachverhalten ab.
Seminar Mediennutzung und -wirkung
Regina Grimm
27.07.2021
Literaturverzeichnis
Becker, Annika/Ljajic, Amina/Schwarz, Simon (2021): Echokammer extrem? Symbolische Grenzziehungen in der Telegramgruppe von Attila Hildmann, Soziologiemagazin, 1, S. 7-25.
Bonfadelli, H., & Friemel, T. N. (2015). Medienwirkungsforschung (5., uberarb. Aufl). UTB: 3451: Medien- und Kommunikationswissenschaft, Padagogik, Psychologie, Soziologie. Konstanz, Munchen: UVK Verl.-Ges.; UVK Lucius.
Bundeszentrale fur politische Bildung: Lexikon einfach POLITIK. Abgerufen 16. Juli 2021, von https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-in-einfacher-sprache/
Fruh, W., & Schonbach, K. (2005). Der dynamisch-transaktionale Ansatz III: Eine Zwischenbilanz. Publizistik, 50(1), S. 4-20.
Jamieson, Kathleen Hall/Albarracin, Dolores (2020): The Relation between Media Consumption and Misinformation at the Outset of the SARS-CoV-2 Pandemic in the US. In: The Harvard Kennedy School Misinformation Review, 1, Special Issue on COVID-19 and Misinformation. Abgerufen 16. Juli 2021, von doi.org/10.37016/mr-2020-012
Jackel, M. (2011). Medienwirkungen: Ein Studienbuch zur Einfuhrung (5., uberarb. Aufl.). Lehrbuch. Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften.
Lischka, Konrad/ Stocker Prof. Dr., Christian (2017): Digitale Offentlichkeit - Wie algorithmische Prozesse den gesellschaftlichen Diskurs beeinflussen - Arbeitspapier, Gutersloh: Bertelsmann Stiftung.
Nocun, Katharina/Lamberty, Pia (2020): Fake Facts. Wie Verschworungstheorien unser Denken bestimmen. Koln: Quadriga.
Pariser, Eli (2011): The Filter Bubble. How the new personalized web is changing what we read and how we think. London: Viking/Penguin Press.
Pennycook, Gordon/McPhetres, Jonathan/Bago, Bence/Rand, David (2020): Predictors of attitudes and misperceptions about COVID-19 in Canada, the UK, and the USA. Abgerufen 17. Juli 2021, von osf.io/3a497/
Reuters Institute Digital News Report 2019. Abgerufen 16. Juli 2021, von https://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/overview-key-findings-2019/
Vosoughi, Soroush/ Roy, Deb/ Aral, Sinan (2018): The spread of true and false news online. In: Science, 369 (6389), S. 1146-1151.
Weltgesundheitsorganisation (2020): COVID-19 Strategy Update. Abgerufen 17.07.2021, von www.who.int/publications/i/item/covid-19-strategy-update---14-april-2020
Ziemer, Carolin-Theresa/ Farkhari, Fahima/ Rothmund, Tobias (2021): Was zeichnet Pandemieleugner*innen aus? - Eine Analyse politischer Einstellungen, kognitiver Stile und Mediennutzung. In: Institut fur Demokratie und Zivilgesellschaft [Hrsg.]: Wissen schafft Demokratie. Schwerpunkt Demokratiegefahrdung in der Coronakrise, Band 9, Jena, S. 28-41.
Häufig gestellte Fragen zum Thesenpapier
Worum geht es in diesem Thesenpapier?
Das Thesenpapier untersucht, ob Personen, die sich hauptsächlich über soziale Medien informieren, eher dazu neigen, Falschinformationen und Verschwörungstheorien zu glauben und zu verbreiten. Es wird untersucht, inwieweit soziale Medien die Verbreitung von Falschinformationen fördern, insbesondere im Kontext von Krisen wie der COVID-19-Pandemie.
Welche Rolle spielen soziale Medien bei der Verbreitung von Falschinformationen?
Soziale Medien ermöglichen es jedem, ungefiltert Informationen zu veröffentlichen, was die Verbreitung von Falschinformationen begünstigt. Im Gegensatz zu traditionellen Medien gibt es oft keine redaktionelle Kontrolle, wodurch ungeprüfte Informationen schnell verbreitet werden können. Zudem fördert die kurze Aufmerksamkeitsspanne auf diesen Plattformen die Emotionalisierung und Generalisierung von Inhalten, was zur Verfälschung von Informationen beitragen kann.
Warum werden Falschinformationen in sozialen Medien schneller verbreitet als wahre Informationen?
Falschinformationen werden oft als spannender empfunden, da sie emotionaler und skandalöser sind. Verschwörungstheorien bieten zudem einfache Erklärungen für komplexe Probleme, während wissenschaftliche Erkenntnisse die Komplexität oft noch erhöhen. Dadurch finden Falschmeldungen leichter Gehör.
Was sind Filterblasen und wie beeinflussen sie den Konsum von Falschinformationen?
Filterblasen entstehen, wenn soziale Netzwerke algorithmisch voraussagen, welche Informationen Nutzer interessieren könnten, und ihnen diese vorschlagen. Dies führt zu einer Isolation gegenüber abweichenden Meinungen und verstärkt die Tendenz, nur Informationen zu konsumieren, die die eigene Sichtweise bestätigen. Dadurch werden Nutzer weniger mit widersprüchlichen Informationen konfrontiert und glauben eher an Verschwörungstheorien.
Welchen Einfluss hat der Bildungsstand auf die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien?
Personen mit einem niedrigeren Bildungsstand beziehen ihre Informationen häufiger aus sozialen Medien und haben im Durchschnitt eine geringere Medienkompetenz. Dadurch können sie die Qualität von Informationen schlechter einschätzen und sind anfälliger für Falschinformationen und Verschwörungstheorien. Zudem können sie sich schwieriger neues Wissen aneignen, was in Krisenzeiten zu dem Wunsch nach einfachen Erklärungen durch Verschwörungstheorien führt.
Welche Studien belegen den Zusammenhang zwischen Mediennutzung und dem Glauben an Verschwörungstheorien?
Das Thesenpapier verweist auf mehrere Studien, die zeigen, dass Personen, die sich hauptsächlich über soziale Medien informieren, eher Falschinformationen konsumieren und schlechter über die Gefahren der COVID-19-Pandemie aufgeklärt sind. Eine Studie von Ziemer, Farkhari und Rothmund (2020) zeigt, dass Personen mit konspirativen Denkmustern ihre Informationen hauptsächlich aus sozialen Medien und weniger aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen beziehen.
Welche Schlussfolgerung zieht das Thesenpapier?
Das Thesenpapier kommt zu dem Schluss, dass die Infrastruktur von sozialen Medien die Verbreitung und den Glauben an Verschwörungstheorien deutlich stärker fördert als traditionelle Medien. Verschiedene Mechanismen wie der fehlende Filter, die Funktionsweise der Netzwerke und der Algorithmus tragen dazu bei. Jedoch hängt die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien auch von anderen Faktoren wie dem Bildungsstand ab.
Wo finde ich das Literaturverzeichnis des Thesenpapiers?
Das Literaturverzeichnis ist im Thesenpapier enthalten und listet die Quellen auf, die für die Analyse verwendet wurden. Es enthält unter anderem Studien von Becker, Bonfadelli, Fruh, Jamieson, Jackel, Lischka, Nocun, Pariser, Pennycook, Vosoughi, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Ziemer.
- Citation du texte
- Regina Grimm (Auteur), 2021, Neigen Nutzer*innen von Social Media stärker dazu Verschwörungstheorien zu glauben?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1223405