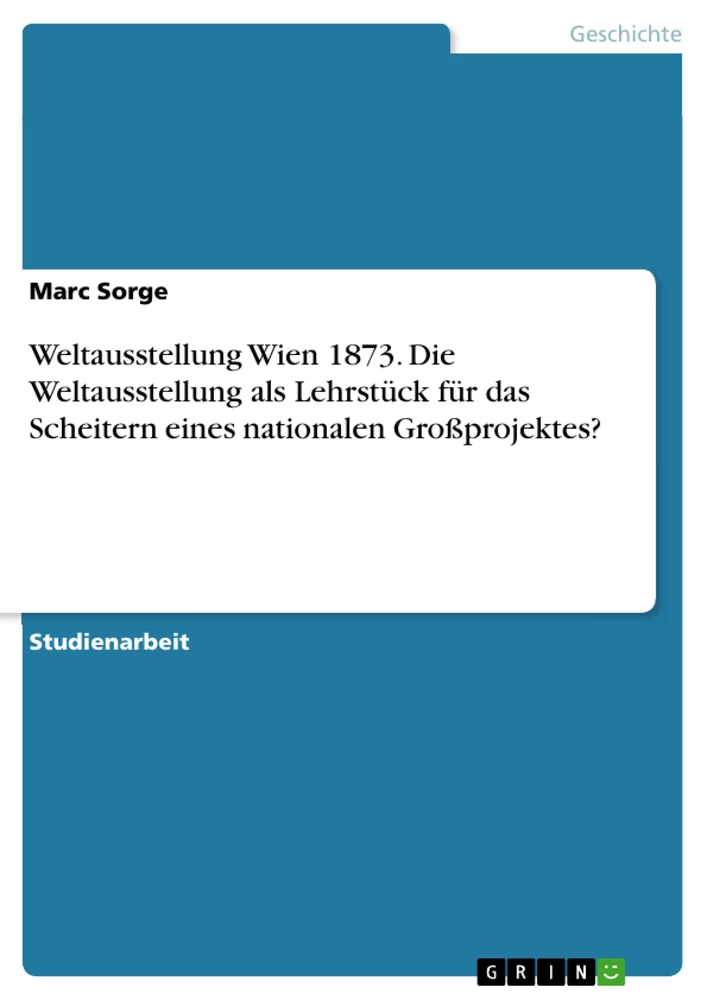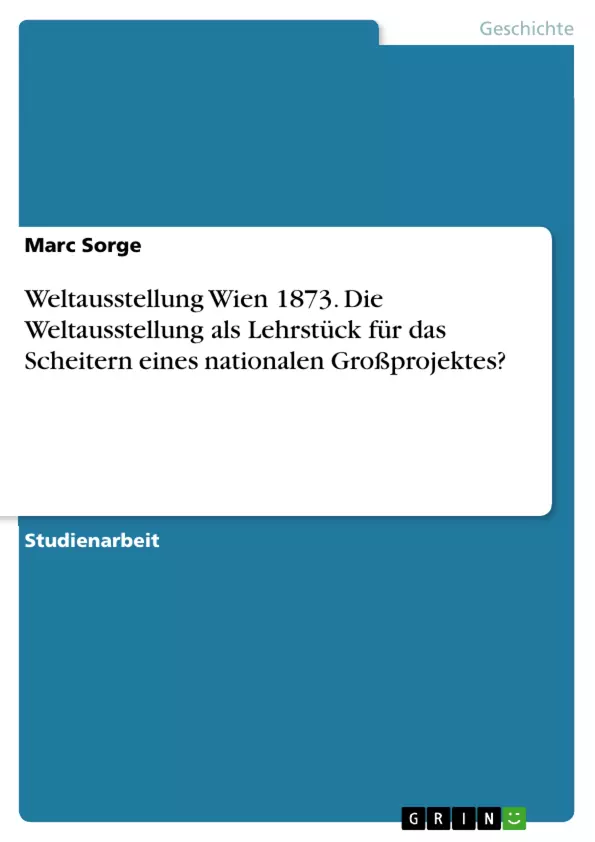Kann man die Weltausstellung als Lehrstück für das Scheitern eines nationalen Großprojektes ansehen? War die Weltausstellung aus wirtschaftlicher Hinsicht, in ihrem Zustandekommen und Anspruch ein Erfolg oder Misserfolg?
Die Wiener Weltausstellung war ein Projekt vom kulturellen und gesellschaftlichen hohen Ausmaß. Wien sollte als Reichshaupt- und Residenzstadt den internationalen Besucherstrom in wirtschaftlicher Hochblüte präsentiert werden.
Doch von Beginn an gab es massive Probleme im Bau des neuen Infrastrukturnetzes und der neuen Pavillons für das Ausstellungsgelände.
Hinzu kam am 09. Mai 1873 die Börsenkatastrophe in Wien. Der „schwarze Freitag“ des Jahres sollte das Schicksal vieler Klein- und Großunternehmer besiegeln. Im Hochsommer folgte eine Choleraepidemie. Wien hatte im laufe des Jahres 3000 Todesopfer zu beklagen.
„Die finanzielle Gesamtbilanz war negativ; dennoch brachte die Ausstellung dem Wien der Gründerzeit eine Mehrung seiner Geltung bis weit jenseits der Grenzen des Habsburgerreichs“, so Jutta Pemsel zur Wiener Weltausstellung. Genau hier soll meine wissenschaftliche Arbeit ansetzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorgeschichte der Weltausstellung – Motivation und Planung
- 2.1. Neoabsolutismus
- 2.2. Liberales Zwischenspiel
- 3. Die Wiener Weltausstellung 1873
- 3.1. 01. Mai 1873 – Die feierliche Eröffnung
- 4. Wien und die Weltausstellung
- 4.1. Baustelle Ringstraße – Ein Boulevard der großen Ambitionen
- 4.2. Kontrolle über die Natur - Donauregulierung
- 4.3. Verkehr und Kommunikation
- 5. Problemfelder im Zuge der Weltausstellung
- 5.1. Der „schwarze Freitag“ des Jahres 1873.
- 5.2. Wiens letzte Choleraepidemie
- 6. Schluss: Finanzdesaster und Imagegewinn – Bilanz und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wiener Weltausstellung von 1873 und analysiert sie als mögliches Lehrstück für das Scheitern nationaler Großprojekte. Es wird geprüft, ob die Ausstellung aus wirtschaftlicher Sicht ein Erfolg oder Misserfolg war, unter Berücksichtigung ihres Zustandekommens und ihrer Ansprüche.
- Die Vorgeschichte der Weltausstellung und die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der 1870er Jahre in Österreich.
- Die Planung und Durchführung der Weltausstellung, einschließlich der Herausforderungen beim Bau der Infrastruktur und der Ausstellungspaläste.
- Die Rolle Wiens als Gastgeberstadt und die Auswirkungen der Ausstellung auf die Stadtentwicklung.
- Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Ausstellung, einschließlich des "schwarzen Freitags" von 1873 und der Choleraepidemie.
- Die Gesamtbilanz der Weltausstellung: Finanzielle Aspekte und Imagegewinn für Wien.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Wiener Weltausstellung 1873 vor und skizziert die gegensätzlichen Perspektiven auf das Ereignis: patriotische Jubelberichte in der Tagespresse im Gegensatz zu den späteren Analysen, die die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Krisen hervorheben. Die Arbeit zielt darauf ab, die Weltausstellung im Kontext ihrer Zeit zu analysieren und die Frage nach ihrem Erfolg oder Misserfolg zu beantworten.
2. Vorgeschichte der Weltausstellung – Motivation und Planung: Dieses Kapitel beleuchtet die politischen und wirtschaftlichen Hintergründe der Weltausstellung. Es untersucht den Einfluss des Neoabsolutismus und des liberalen Zwischenspiels auf die Entscheidung für die Austragung der Ausstellung in Wien. Die Kapitel analysiert die Motivationen hinter dem Projekt und die Planungsphase, die die grundlegenden Entscheidungen für das Aussehen und den Ablauf der Ausstellung legte.
3. Die Wiener Weltausstellung 1873: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die feierliche Eröffnung der Ausstellung am 1. Mai 1873. Es beschreibt die ersten Eindrücke und die anfängliche Euphorie, die schnell von ersten Problemen überschattet wurde. Das Kapitel bietet einen ersten Einblick in die Herausforderungen, mit denen die Organisatoren konfrontiert waren, und legt den Grundstein für die detailliertere Analyse der Schwierigkeiten in den folgenden Kapiteln.
4. Wien und die Weltausstellung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle Wiens als Austragungsort. Es beleuchtet die Auswirkungen der Weltausstellung auf die Stadtentwicklung, insbesondere den Bau der Ringstraße, die Donauregulierung und den Ausbau des Verkehrs- und Kommunikationsnetzes. Es wird untersucht, wie die Ausstellung dazu beitrug, Wien als moderne Metropole zu präsentieren und seine internationale Bedeutung zu stärken.
5. Problemfelder im Zuge der Weltausstellung: Dieses Kapitel befasst sich mit den erheblichen Problemen, die während und nach der Ausstellung auftraten. Der "schwarze Freitag" von 1873, eine schwere Börsenkatastrophe, und die Choleraepidemie werden im Detail analysiert. Das Kapitel untersucht die Auswirkungen dieser Ereignisse auf die Wirtschaft und die Bevölkerung Wiens und stellt ihre Bedeutung für den Gesamterfolg der Weltausstellung in Frage.
Schlüsselwörter
Wiener Weltausstellung 1873, Gründerzeit, Neoabsolutismus, Liberalismus, Donaumonarchie, Ringstraße, Börsenkrach, Choleraepidemie, nationale Großprojekte, wirtschaftlicher Erfolg/Misserfolg, Imagegewinn.
Häufig gestellte Fragen zur Wiener Weltausstellung 1873
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Wiener Weltausstellung von 1873 als mögliches Lehrstück für das Scheitern nationaler Großprojekte. Sie untersucht, ob die Ausstellung wirtschaftlich erfolgreich war, unter Berücksichtigung ihres Entstehungsprozesses und ihrer Zielsetzungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Vorgeschichte der Ausstellung, die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der 1870er Jahre in Österreich, die Planung und Durchführung, die Rolle Wiens als Gastgeberstadt und die Auswirkungen auf die Stadtentwicklung, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen (inkl. "schwarzer Freitag" und Choleraepidemie), sowie die finanzielle Bilanz und den Imagegewinn für Wien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung: Einführung in die Thematik und die gegensätzlichen Perspektiven auf die Ausstellung. 2. Vorgeschichte: Politische und wirtschaftliche Hintergründe, Neoabsolutismus und liberales Zwischenspiel. 3. Die Weltausstellung 1873: Feierliche Eröffnung und erste Eindrücke. 4. Wien und die Ausstellung: Auswirkungen auf die Stadtentwicklung (Ringstraße, Donauregulierung, Verkehr). 5. Problemfelder: "Schwarzer Freitag" 1873 und Choleraepidemie. 6. Schluss: Finanzielle Bilanz und Imagegewinn.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Wiener Weltausstellung 1873, Gründerzeit, Neoabsolutismus, Liberalismus, Donaumonarchie, Ringstraße, Börsenkrach, Choleraepidemie, nationale Großprojekte, wirtschaftlicher Erfolg/Misserfolg, Imagegewinn.
Wie wird der Erfolg oder Misserfolg der Weltausstellung bewertet?
Die Arbeit untersucht die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Ausstellung, um zu einer fundierten Bewertung ihres Erfolgs oder Misserfolgs zu gelangen. Dabei werden sowohl die positiven Aspekte (z.B. Imagegewinn für Wien) als auch die negativen Aspekte (z.B. "Schwarzer Freitag", Choleraepidemie) berücksichtigt.
Welche Rolle spielte Wien bei der Weltausstellung?
Wien war nicht nur der Austragungsort, sondern die Ausstellung hatte erhebliche Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. Der Bau der Ringstraße, die Donauregulierung und der Ausbau des Verkehrsnetzes wurden im Zusammenhang mit der Ausstellung betrachtet und analysiert.
Welche Probleme traten während und nach der Weltausstellung auf?
Die Arbeit befasst sich ausführlich mit dem "schwarzen Freitag" von 1873, einer schweren Börsenkatastrophe, und der Choleraepidemie. Diese Ereignisse hatten erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Bevölkerung Wiens und werden im Kontext des Gesamterfolgs der Ausstellung bewertet.
- Citar trabajo
- Master of Arts Marc Sorge (Autor), 2016, Weltausstellung Wien 1873. Die Weltausstellung als Lehrstück für das Scheitern eines nationalen Großprojektes?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1223952