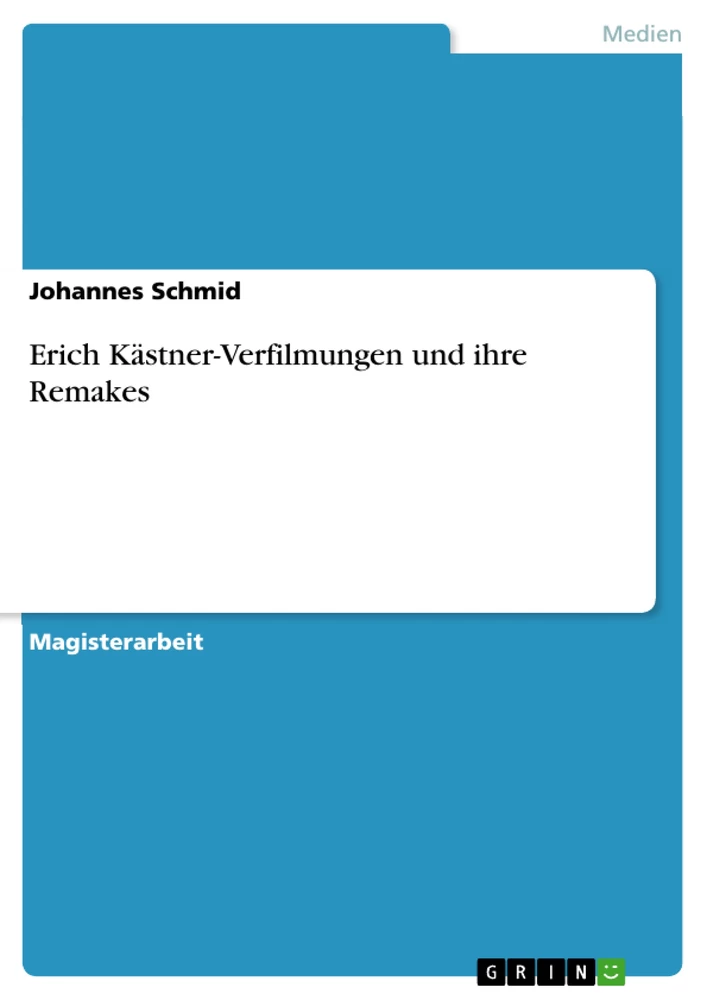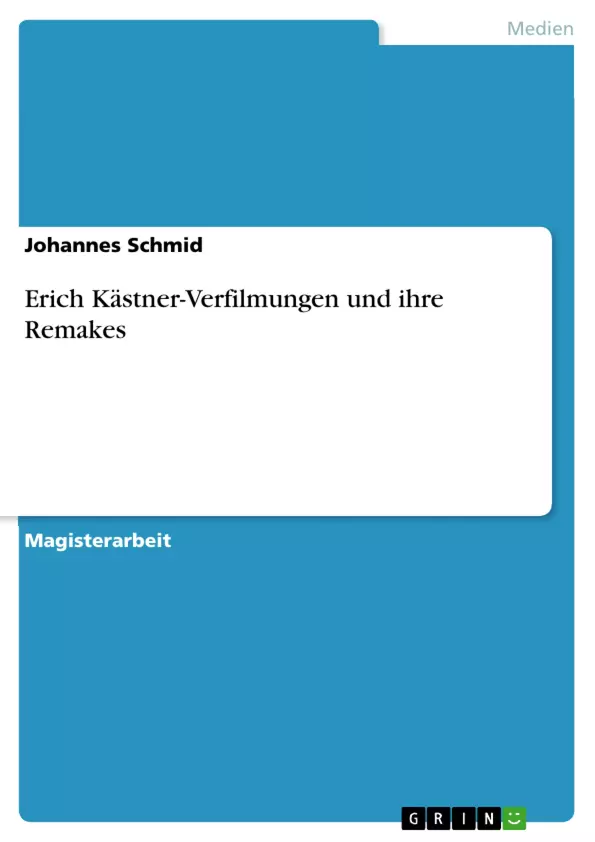Kästner nahm sich bekannter Volksbücher und Klassiker der Weltliteratur wie "Till Eulenspiegel" oder "Gullivers Reisen" an, um sie nach seinem Geschmack zu bearbeiten und für die Kinder seiner Zeit attraktiv zu gestalten. Das Nacherzählen empfand er als notwendig und berechtigt. Auch die meisten von Kästners eigenen Stoffen erwiesen sich im Laufe der Zeit als genauso „unzerreißbar“ wie die Vorlagen seiner Nacherzählungen. Dass auch seine Werke immer wieder wert befunden wurden, bearbeitet und neu erzählt zu werden, dessen konnte sich Kästner noch zu Lebzeiten versichern. Die wohl wichtigste Rolle kam dabei aber nicht der literarischen Nacherzählung, sondern der Übertragung in das Massenmedium Film zu. Über Leinwand und Bildschirm erreichten seine Stoffe Millionen von Menschen in Ländern auf der ganzen Welt. Insbesondere in Deutschland wurden nicht nur Verfilmungen seiner Bücher, sondern auch filmische Nacherzählungen der urprünglichen Verfilmungen, sogenannte Remakes, hergestellt.
Mit dem Remake, dem filmgeschichtlichen Äquivalent zu Kästners Nacherzählungen, beschäftigt sich die hier vorliegende Arbeit. Ziel ist es, Motivationen für deren Produktion und unterschiedliche Prozesse der Bearbeitung durchsichtig zu machen. Beispielhaft werden jeweils die deutsche Erstverfilmung und das deutsche Remake dreier Kästner-Stoffe für Kinder herausgegriffen und miteinander verglichen: "Emil und die Detektive", "Das doppelte Lottchen" und "Pünktchen und Anton".
In einem allgemeinen Teil sollen zunächst methodologische und definitorische Überlegungen zum Begriff Remake angestellt werden, die die Grundlage für die sich anschließenden Filmvergleiche bilden sollen. Da es zu den besprochenen Remakes nicht nur eine filmische, sondern jeweils auch eine literarische Vorlage gibt, soll des Weiteren auf das Wechselverhältnis von Literatur und Film eingegangen werden. Außerdem soll aufgezeigt werden, inwieweit Erkenntnisse der Theorie der Literaturverfilmung für die Beschäftigung mit Remakes fruchtbar gemacht werden können. Da Kästner selbst an mehreren der besprochenen Filme mitgearbeitet hat, erscheint es sinnvoll, nach diesen methodologischen Vorüberlegungen Erich Kästners spezielles Verhältnis zum Film und die von ihm über die Mediengrenzen hinweg praktizierte Mehrfachverwertung seiner Texte darzustellen.
Bei den drei Vergleichen von den Erstverfilmungen und den Remakes soll versucht werden, die gewonnenen Erkenntnisse am Beispiel anzuwenden und zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Vorbemerkung
- 1 Allgemeiner Teil
- 1.1 Methodologische Vorüberlegungen
- 1.1.1 Das Remake - eine erste Annäherung
- 1.1.2 Das Wechselverhältnis von Literatur und Film
- 1.1.2 Theorie der Literaturadaption und Rückschlüsse auf das Remake
- 1.2 Erich Kästner und der Film - ein Überblick
- 2 Erich Kästner-Verfilmungen und ihre Remakes
- 2.1 Emil und die Detektive
- 2.1.1 Die Romanvorlage und die Geschichte ihrer Medialisierungen
- 2.1.2 Produktionsbedingungen von Original und Remake
- 2.1.2.1 Gerhard Lamprechts Emil und die Detektive von 1931
- 2.1.2.2 Robert A. Stemmles Emil und die Detektive von 1954
- 2.1.3 Rezeptionsgeschichte von Original und Remake
- 2.1.3.1 Gerhard Lamprechts Emil und die Detektive von 1931
- 2.1.3.2 Robert A. Stemmles Emil und die Detektive von 1954
- 2.1.4 Vergleichende Analyse von Original und Remake
- 2.1.4.1 Amplifikation und Attuentation von Aspekten der Handlungskonzeption
- 2.1.4.2 Oberflächliche und fehlende Aktualisierung
- 2.1.4.3 Formale Organisation
- 2.1.5 Abschließende Beurteilung: Von der Gesellschaftskritik zur Restauration
- 2.2 Das doppelte Lottchen
- 2.2.1 Die Genese des Kästner-Stoffes in seinen verschiedenen Medialisierungen
- 2.2.2 Produktionsbedingungen von Original und Remake
- 2.2.2.1 Josef von Bakys Das doppelte Lottchen von 1950
- 2.2.2.2 Joseph Vilsmaiers Charlie & Louise - Das doppelte Lottchen von 1993
- 2.2.3 Rezeptionsgeschichte von Original und Remake
- 2.2.3.1 Josef von Bakys Das doppelte Lottchen von 1950
- 2.2.3.2 Joseph Vilsmaiers Charlie & Louise - Das doppelte Lottchen von 1993
- 2.2.4 Vergleichende Analyse von Original und Remake
- 2.2.4.1 Topographische Transposition
- 2.2.4.2 Verbalisation
- 2.2.4.3 Änderungen beim Figureninventar und bei der Handlungskonzeption
- 2.2.4.4 Formale Organisation und Erzählstil
- 2.2.4.5 Happy Endings 1950 und 1993
- 2.2.5 Abschließende Beurteilung: Von der Ironie zum Klischee
- 2.3 Pünktchen und Anton
- 2.3.1 Die Romanvorlage und die Geschichte ihrer Medialisierungen
- 2.3.2 Produktionsbedingungen von Original und Remake
- 2.3.2.1 Thomas Engels Pünktchen und Anton von 1953
- 2.3.2.2 Caroline Links Pünktchen und Anton von 1998
- 2.3.3 Rezeptionsgeschichte von Original und Remake
- 2.3.3.1 Thomas Engels Pünktchen und Anton von 1953
- 2.3.3.2 Caroline Links Pünktchen und Anton von 1998
- 2.3.4 Vergleichende Analyse von Original und Remake
- 2.3.4.1 Parallelen in der Handlungskonzeption bei Engels und Links Pünktchen und Anton-Filmen im Vergleich zu Kästners Romanvorlage
- 2.3.4.2 Topographische Transposition
- 2.3.4.3 Änderungen und Schwerpunktverlagerungen in der Handlungskonzeption
- 2.3.4.4 Änderungen beim Figureninventar
- 2.3.4.5 Verbalisation
- 2.3.4.6 Erzählstil und Formale Organisation
- 2.3.5 Abschließende Beurteilung: Von der Chiffre zum Charakter
- 2.3.6 EXKURS: Kästner 2000 – geplante Kästner-Filme der Pünktchen und Anton-Produzenten Uschi Reich und Peter Zenk
- 3 Schlussbemerkung
- Vergleichende Analyse von Original- und Remake-Verfilmungen
- Untersuchung der Produktionsbedingungen und Rezeptionsgeschichte der Filme
- Analyse der Veränderungen in Handlung, Figuren und Erzählstrukturen
- Bewertung der Aktualisierungen und Anpassungen an verschiedene Epochen
- Betrachtung der Entwicklung der filmischen Adaption von Kästners Werken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Motivationen hinter der Produktion von Remakes von Erich Kästner-Verfilmungen und analysiert die unterschiedlichen Bearbeitungsprozesse. Drei Kästner-Stoffe für Kinder – Emil und die Detektive, Das doppelte Lottchen und Pünktchen und Anton – werden exemplarisch betrachtet, indem jeweils die Erstverfilmung und ihr deutsches Remake verglichen werden. Der Fokus liegt auf der Veranschaulichung der Veränderungen und Anpassungen, die in den Remakes vorgenommen wurden.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Allgemeiner Teil: Dieses Kapitel legt die methodologischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert den Begriff des Remakes im filmischen Kontext und untersucht das komplexe Wechselverhältnis zwischen Literatur und Film. Die Theorie der Literaturadaption wird herangezogen, um die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Umsetzung von literarischen Vorlagen in filmische Remakes zu beleuchten. Besonders wird auf die Aspekte der Transformation und Interpretation eingegangen und wie diese im Kontext der gewählten Kästner-Verfilmungen relevant werden.
2 Erich Kästner-Verfilmungen und ihre Remakes: Dieser Abschnitt bildet den Kern der Arbeit und präsentiert die detaillierte Analyse der drei ausgewählten Filmpaare: Emil und die Detektive, Das doppelte Lottchen, und Pünktchen und Anton. Jedes Unterkapitel untersucht die jeweiligen Romanvorlagen, die Produktionsbedingungen der Original- und Remake-Verfilmungen, ihre Rezeptionsgeschichte und schließlich eine vergleichende Analyse der beiden Filmversionen. Dabei werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug auf Handlung, Figuren, Erzählweise und visuelle Gestaltung hervorgehoben und kritisch bewertet. Die Kapitel beleuchten die jeweiligen Aktualisierungen und Anpassungen und beurteilen den Erfolg dieser im Hinblick auf die Erhaltung des ursprünglichen Stoffes.
Schlüsselwörter
Erich Kästner, Verfilmung, Remake, Literaturadaption, Kinderliteratur, Emil und die Detektive, Das doppelte Lottchen, Pünktchen und Anton, Filmgeschichte, Produktionsbedingungen, Rezeptionsgeschichte, Vergleichende Analyse, Handlungsanalyse, Figurenanalyse, Erzählstrukturen, Aktualisierung, Gesellschaftskritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Erich Kästner-Verfilmungen und ihren Remakes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Motivationen hinter der Produktion von Remakes deutscher Verfilmungen von Erich Kästner und untersucht die unterschiedlichen Bearbeitungsprozesse. Der Fokus liegt auf drei Kinderbuchverfilmungen: "Emil und die Detektive", "Das doppelte Lottchen" und "Pünktchen und Anton". Für jeden Titel werden die Erstverfilmung und ihr deutsches Remake verglichen, um Veränderungen und Anpassungen aufzuzeigen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit nutzt eine vergleichende Analysemethode. Sie untersucht die Produktionsbedingungen und die Rezeptionsgeschichte der Filme, analysiert Veränderungen in Handlung, Figuren und Erzählstrukturen und bewertet die Aktualisierungen und Anpassungen an verschiedene Epochen. Die Theorie der Literaturadaption dient als theoretischer Rahmen.
Welche Bücher/Filme werden untersucht?
Die Arbeit analysiert jeweils die Erstverfilmung und ein deutsches Remake von drei Erich Kästner-Verfilmungen: "Emil und die Detektive", "Das doppelte Lottchen" und "Pünktchen und Anton". Für jeden Film werden konkrete Versionen genannt (z.B. Lamprechts "Emil und die Detektive" von 1931 und Stemmles Version von 1954).
Welche Aspekte der Filme werden verglichen?
Der Vergleich umfasst die Produktionsbedingungen (z.B. Produktionsjahr, Regisseur), die Rezeptionsgeschichte (wie wurden die Filme aufgenommen), die Handlung, die Figuren, den Erzählstil, die visuelle Gestaltung und die jeweilige Aktualisierung und Anpassung an die jeweilige Zeit.
Welche konkreten Fragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht, welche Motivationen hinter den Remakes stecken, wie die Adaptionsprozesse vonstattengehen und wie die jeweiligen Remakes den Originalen gegenüber stehen. Sie analysiert, inwiefern Aktualisierungen erfolgreich waren und ob der ursprüngliche Geist von Kästners Werken erhalten geblieben ist. Auch topographische Transpositionen und Veränderungen im Figureninventar werden analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen allgemeinen Teil (methodologische Vorüberlegungen, Überblick über Kästner-Verfilmungen), einen Hauptteil mit der detaillierten Analyse der drei Filmpaare und einer Schlussbemerkung. Jedes der drei Filmpaare wird in einem eigenen Unterkapitel behandelt, inklusive der Analyse der Romanvorlage, der Produktionsbedingungen, der Rezeptionsgeschichte und eines vergleichenden Abschnitts.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erich Kästner, Verfilmung, Remake, Literaturadaption, Kinderliteratur, Emil und die Detektive, Das doppelte Lottchen, Pünktchen und Anton, Filmgeschichte, Produktionsbedingungen, Rezeptionsgeschichte, Vergleichende Analyse, Handlungsanalyse, Figurenanalyse, Erzählstrukturen, Aktualisierung, Gesellschaftskritik.
- Arbeit zitieren
- M.A. Johannes Schmid (Autor:in), 2000, Erich Kästner-Verfilmungen und ihre Remakes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122473