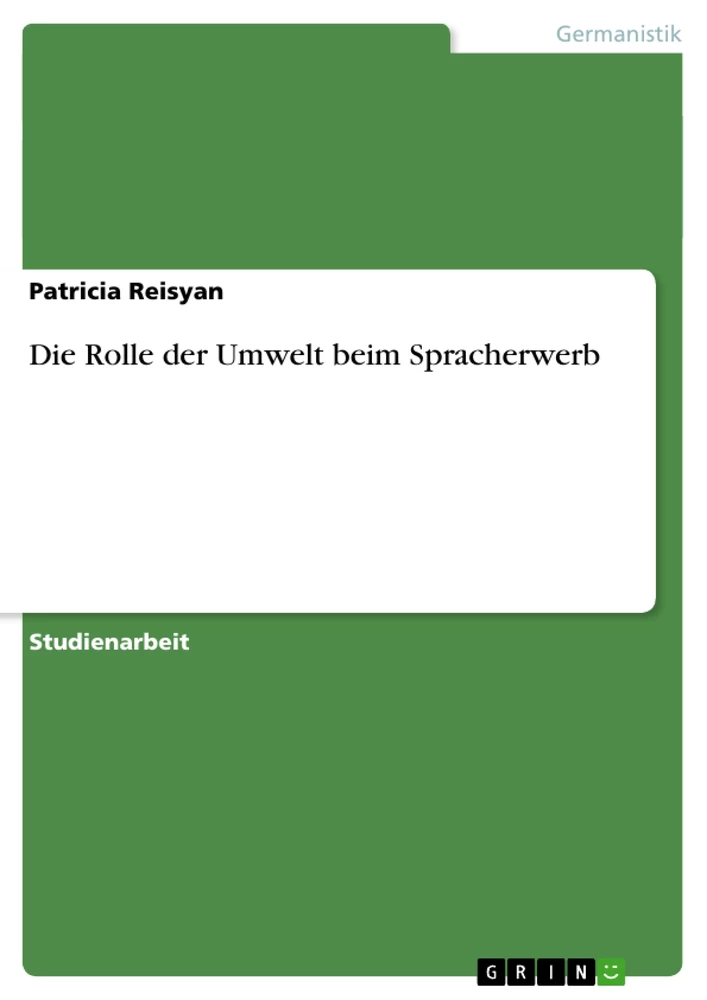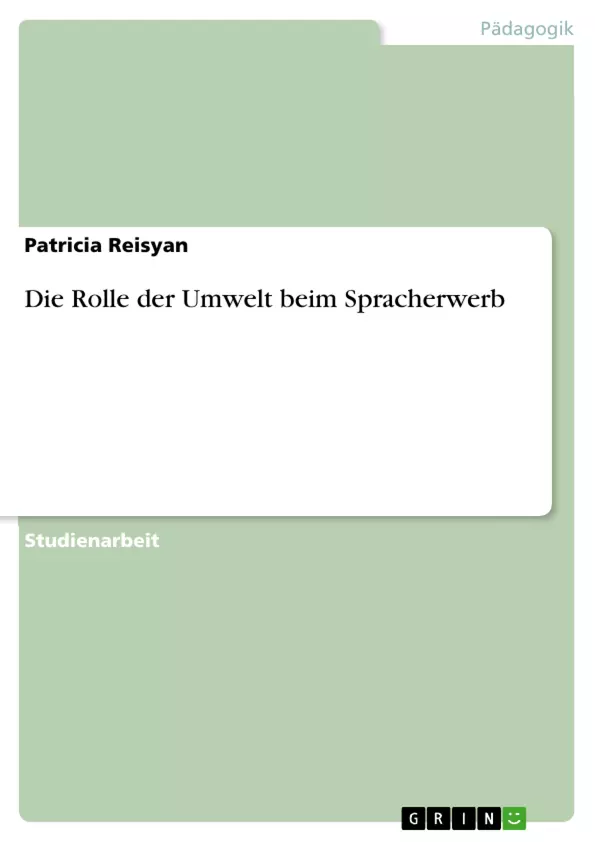Sprache stellt ein komplexes Phänomen dar, denn menschliche Sprache ist vielschichtig, international, ein Machtinstrument, das Ausdrucksmittel schlechthin. Sprache ist Geist, und Sprache kann sowohl Brücken zwischen Menschen herstellen als auch Komplikationen schaffen, da vor allem jedes Abstraktum einen Bedeutungsüberhang aufweist und so verschiedene Individuen Wörter semantisch unterschiedlich besetzen. Wenn man dieses Mittel beherrscht, kann man seine Meinung versprachlichen, diese argumentativ vertreten und andere davon überzeugen oder zumindest seinen eigenen Gedankengang verständlich machen. Der Spracherwerb als Forschungsgegenstand zählt seit jeher zu den Feldern, die in der Geschichte ihren Platz finden (z.B. Isolationsexperimente). Man fragte sich z.B., ob es eine Ursprache gibt und wie man überhaupt Sprache erwirbt.
Diese Hausarbeit macht es sich zur Aufgabe, die Rolle der Umwelt beim Spracherwerb näher zu durchleuchten und anhand eines Fallbeispiels, bei dem es sich um einen spontanen Dialog zwischen einer Großmutter und ihrem Enkelsohn handelt, die Thesen der wissenschaftlichen Theorien zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Spracherwerbstheorien
- 2.1 Nativismus
- 2.2 Kognitivismus
- 2.3 Interaktionismus
- 3. Präverbale Kommunikation
- 3.1 Umwelt und Kind als System
- 3.2 Erwerb kommunikativer Grundqualifikationen
- 3.3 Die an das Baby gerichtete Sprache (BGS)
- 4. Die an das Kind gerichtete Sprache (KGS)
- 4.1 Die Merkmale und die Funktion von KGS
- 4.2 Wirkung von KGS
- 4.3 Lehrstrategien
- 5. Gesprächsuntersuchung
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle der Umwelt beim Spracherwerb. Sie beleuchtet die drei wichtigsten Spracherwerbstheorien – Nativismus, Kognitivismus und Interaktionismus – und konzentriert sich dabei insbesondere auf den Interaktionismus und dessen Betrachtung der Umweltfaktoren. Die Arbeit analysiert die präverbale Kommunikation und den Einfluss der an das Kind gerichteten Sprache (KGS) auf die Sprachentwicklung. Ein spontaner Dialog zwischen Großmutter und Enkelsohn dient als Fallbeispiel.
- Die Bedeutung der Umwelt beim Spracherwerb
- Vergleichende Analyse verschiedener Spracherwerbstheorien
- Die Rolle der präverbalen Kommunikation
- Der Einfluss der an das Kind gerichteten Sprache (KGS)
- Analyse eines realen Dialogs als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das komplexe Thema Spracherwerb ein und betont die Vielschichtigkeit von Sprache als Kommunikationsmittel und Machtinstrument. Sie hebt die Bedeutung des Spracherwerbs als Forschungsfeld hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die zentrale Forschungsfrage ist die Rolle der Umwelt beim Spracherwerb, die anhand eines Fallbeispiels – eines Dialogs zwischen Großmutter und Enkel – untersucht wird. Die Arbeit kündigt die Erläuterung der drei wichtigsten Spracherwerbstheorien an, mit einem Fokus auf den Interaktionismus, sowie die Behandlung der präverbalen Kommunikation und des Einflusses der an das Kind gerichteten Sprache.
2. Spracherwerbstheorien: Dieses Kapitel stellt die drei dominierenden Spracherwerbstheorien – Nativismus, Kognitivismus und Interaktionismus – vor. Es wird betont, dass die Theorien über die Art und Weise, wie Kinder Sprache erlernen, nicht endgültig bewiesen werden können. Der Nativismus postuliert eine angeborene Sprachkompetenz, die durch den Input der Umwelt nur aktiviert wird. Der Kognitivismus sieht die Sprachentwicklung als Teil der kognitiven Entwicklung, wobei die Informationsverarbeitung im Vordergrund steht. Der Interaktionismus betont den sozialen Aspekt des Spracherwerbs und die Bedeutung von Interaktion für die Sprachentwicklung. Der Text erwähnt wichtige Vertreter wie Noam Chomsky (Nativismus) und Jean Piaget (Kognitivismus).
3. Präverbale Kommunikation: Dieses Kapitel befasst sich mit der präverbalen Kommunikation und deren Bedeutung für den späteren Spracherwerb. Es beschreibt die Interaktion zwischen Kind und Umwelt vor dem eigentlichen Sprechen, betont die Bedeutung des Systems "Umwelt und Kind" und den Erwerb kommunikativer Grundqualifikationen in dieser Phase. Ein Beispiel hierfür ist die Praxis in der japanischen Kultur, ungeborene Kinder mit klassischer Musik oder Fremdsprachen zu konfrontieren, um deren Intelligenz zu fördern. Das Kapitel legt den Fokus auf die frühkindliche Kommunikation als Grundlage für den späteren Spracherwerb und die Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten.
4. Die an das Kind gerichtete Sprache (KGS): Dieses Kapitel konzentriert sich auf die an das Kind gerichtete Sprache (KGS), auch bekannt als "motherese" oder "Ammensprache". Es beschreibt die Merkmale und Funktionen der KGS, untersucht deren Wirkung auf die Sprachentwicklung des Kindes und beleuchtet mögliche Lehrstrategien, die auf der KGS basieren. Der Fokus liegt auf der Analyse der sprachlichen Anpassung der Erwachsenen an das Kind und deren Einfluss auf den Spracherwerbsprozess. Es wird beleuchtet, wie die spezifischen Merkmale der KGS die Sprachentwicklung des Kindes fördern und welche pädagogischen Schlüsse daraus gezogen werden können.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Umwelt, Spracherwerbstheorien, Nativismus, Kognitivismus, Interaktionismus, Präverbale Kommunikation, An das Kind gerichtete Sprache (KGS), Motherese, Ammensprache, Child-directed-speech, Dialoganalyse, Fallbeispiel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Spracherwerb und die Rolle der Umwelt
Was ist der Hauptfokus dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Rolle der Umwelt beim Spracherwerb. Sie analysiert verschiedene Spracherwerbstheorien, die präverbale Kommunikation und den Einfluss der an das Kind gerichteten Sprache (KGS) auf die Sprachentwicklung. Ein realer Dialog zwischen Großmutter und Enkel dient als Fallbeispiel.
Welche Spracherwerbstheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die drei wichtigsten Spracherwerbstheorien: Nativismus, Kognitivismus und Interaktionismus. Der Fokus liegt dabei auf dem Interaktionismus und seiner Betrachtung der Umweltfaktoren. Es werden die zentralen Annahmen jeder Theorie erläutert und wichtige Vertreter wie Noam Chomsky (Nativismus) und Jean Piaget (Kognitivismus) genannt.
Was versteht man unter präverbaler Kommunikation?
Die Hausarbeit beschreibt die präverbale Kommunikation als die Interaktion zwischen Kind und Umwelt vor dem eigentlichen Sprechen. Sie betont die Bedeutung des Systems "Umwelt und Kind" und den Erwerb kommunikativer Grundqualifikationen in dieser Phase. Es wird beispielsweise die Praxis in der japanischen Kultur erwähnt, ungeborene Kinder mit klassischer Musik oder Fremdsprachen zu konfrontieren.
Welche Bedeutung hat die an das Kind gerichtete Sprache (KGS)?
Die Arbeit analysiert die an das Kind gerichtete Sprache (KGS), auch bekannt als "Motherese" oder "Ammensprache". Sie beschreibt deren Merkmale und Funktionen, untersucht deren Wirkung auf die Sprachentwicklung und beleuchtet mögliche Lehrstrategien, die auf der KGS basieren. Der Fokus liegt auf der sprachlichen Anpassung der Erwachsenen an das Kind und deren Einfluss auf den Spracherwerbsprozess.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist strukturiert in Einleitung, Kapitel zu den Spracherwerbstheorien, präverbaler Kommunikation und KGS, einer Gesprächsuntersuchung (Fallbeispiel), und einem Resümee. Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau. Jedes Kapitel fasst seine Kernaussagen zusammen, und Schlüsselbegriffe werden am Ende aufgelistet.
Welches Fallbeispiel wird verwendet?
Als Fallbeispiel dient ein spontaner Dialog zwischen Großmutter und Enkelsohn, der die Anwendung der besprochenen Theorien und Konzepte verdeutlicht und die Rolle der Umwelt im Spracherwerbsprozess illustriert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Spracherwerb, Umwelt, Spracherwerbstheorien, Nativismus, Kognitivismus, Interaktionismus, Präverbale Kommunikation, An das Kind gerichtete Sprache (KGS), Motherese, Ammensprache, Child-directed-speech, Dialoganalyse, Fallbeispiel.
Welche zentrale Forschungsfrage wird in der Arbeit gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ist die Rolle der Umwelt beim Spracherwerb. Diese Frage wird anhand des Dialogs zwischen Großmutter und Enkel und durch die Analyse der verschiedenen Spracherwerbstheorien beantwortet.
- Citar trabajo
- Patricia Reisyan (Autor), 2004, Die Rolle der Umwelt beim Spracherwerb, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122532