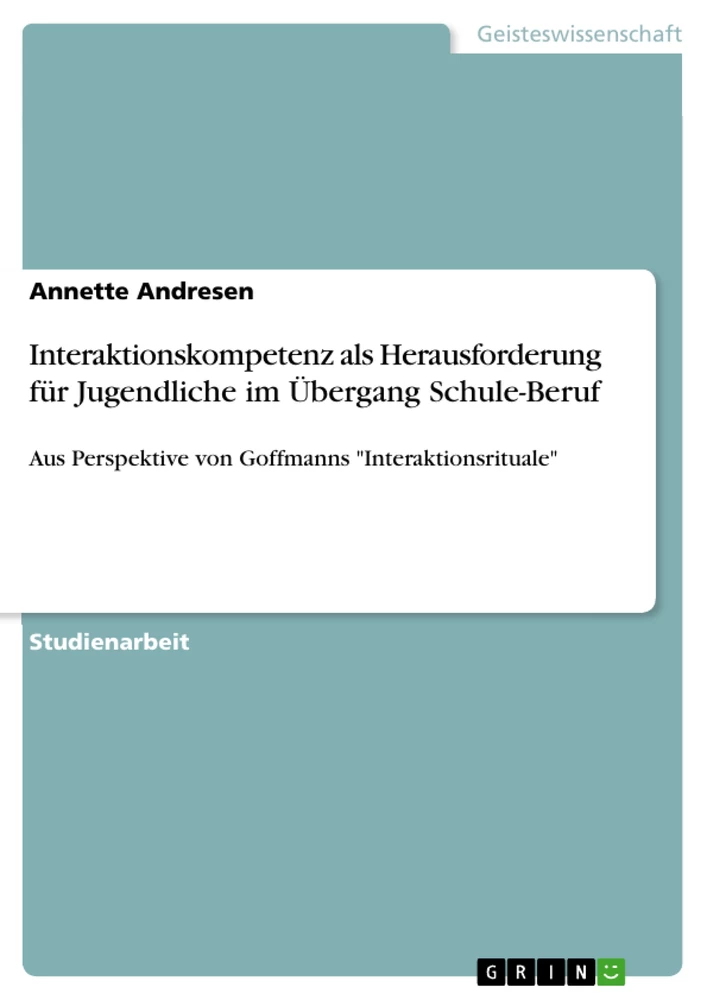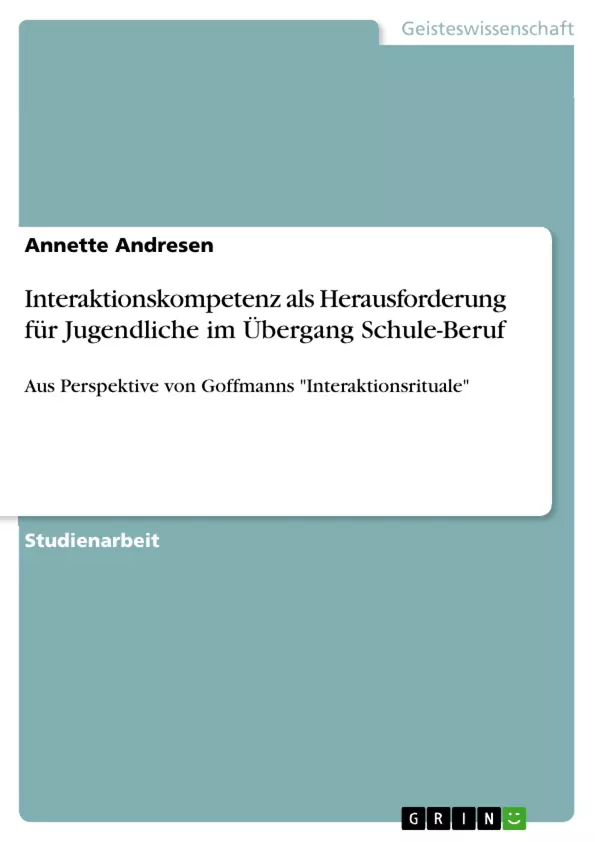Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Interaktionsritualen in direkter Kommunikation (nach Goffman 1967/2013) und wird angewandt auf das Phänomen der Jugendlichen, denen der Übergang von der Schule in den Ausbildungsmarkt nicht gelingt. Es wird hier davon ausgegangen, dass den Jugendlichen die gesellschaftlich erwarteten und geforderten Interaktionsrituale nicht geläufig sind, sie also nur über eine mangelnde Sozialkompetenz verfügen, was den Zugang in ein Ausbildungsverhältnis verhindert und zur Einmündung in den berufsschulischen Übergangssektor führt.
In Kapitel zwei wird die inhaltlich leitende Theorie der Interaktionsrituale vorgestellt. Das Werk Erving Goffmans mit den Schwerpunkten Interaktionsordnung und -ritualen sowie direkte Kommunikationssituationen wird theoretisch eingeordnet und die für die Interaktionsrituale relevanten Werke und Aspekte werden dargestellt, mit denen er versucht, die Strukturen, Mechanismen und Regeln von interaktionalem Verhalten zu erfassen. Das Phänomen Interaktionskompetenz als Herausforderung für Jugendliche im Übergang Schule-Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung von Sozialisation und Individuation wird in Kapitel drei beschrieben und mit Goffmans theoretischem Ansatz verknüpft. In Kapitel vier erfolgt ein kritisches Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie: „Interaktionsrituale“ von Erving Goffman
- Wissenschaftstheoretische und -historische Verortung
- Goffmans Vorgehensweise und Werk - ein fokussierter Überblick
- Interaktionsrituale – über Verhalten in direkter Kommunikation
- Im Fokus: Imagepflege sowie Ehrerbietung und Benehmen
- Das Phänomen: misslungener Übergang Schule-Arbeitsmarkt
- Misslingender Übergang Jugendlicher in den Arbeitsmarkt
- Interaktionskompetenz als Sozialkompetenz
- Im Fokus: Techniken der Imagepflege / Ehrerbietung und Benehmen
- Kritisches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Interaktionsritualen in direkter Kommunikation im Kontext des Übergangs von Jugendlichen von der Schule in den Arbeitsmarkt. Sie argumentiert, dass mangelnde Interaktionskompetenz, d.h. die fehlende Fähigkeit, gesellschaftlich erwartete Interaktionsrituale zu verstehen und anzuwenden, den Übergang erschwert und zu einem Eintritt in den berufsschulischen Übergangssektor führen kann.
- Interaktionsrituale nach Erving Goffman
- Der Übergang Schule-Arbeitsmarkt
- Interaktionskompetenz als Sozialkompetenz
- Imagepflege und Ehrerbietung in Interaktionen
- Die Rolle von Sozialisation und Individuation
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit, den Fokus auf Interaktionsrituale und den Übergang Schule-Arbeitsmarkt, vor. Sie argumentiert, dass mangelnde Interaktionskompetenz bei Jugendlichen zu einem misslungenen Übergang führen kann.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel stellt die Theorie der Interaktionsrituale von Erving Goffman vor. Es geht auf die wissenschaftstheoretische und -historische Verortung der Theorie ein, beschreibt Goffmans Vorgehensweise und seine zentralen Werke, und erläutert die Kernthesen seiner Theorie der Interaktionsrituale.
- Kapitel 3: Das Phänomen des misslungenen Übergangs Schule-Arbeitsmarkt wird im Detail betrachtet. Es untersucht, wie fehlende Interaktionskompetenz bei Jugendlichen diesen Übergang erschwert. Es werden die relevanten Aspekte der Sozialisation und Individuation beleuchtet und mit Goffmans Theorie verknüpft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Interaktionsrituale, der Interaktionskompetenz, dem Übergang Schule-Arbeitsmarkt, der Sozialisation, der Individuation, der Imagepflege, der Ehrerbietung und dem Benehmen. Sie bezieht sich auf die theoretischen Ansätze von Erving Goffman, dem Symbolischen Interaktionismus und der Ethnomethodologie.
- Quote paper
- Annette Andresen (Author), 2021, Interaktionskompetenz als Herausforderung für Jugendliche im Übergang Schule-Beruf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1225448