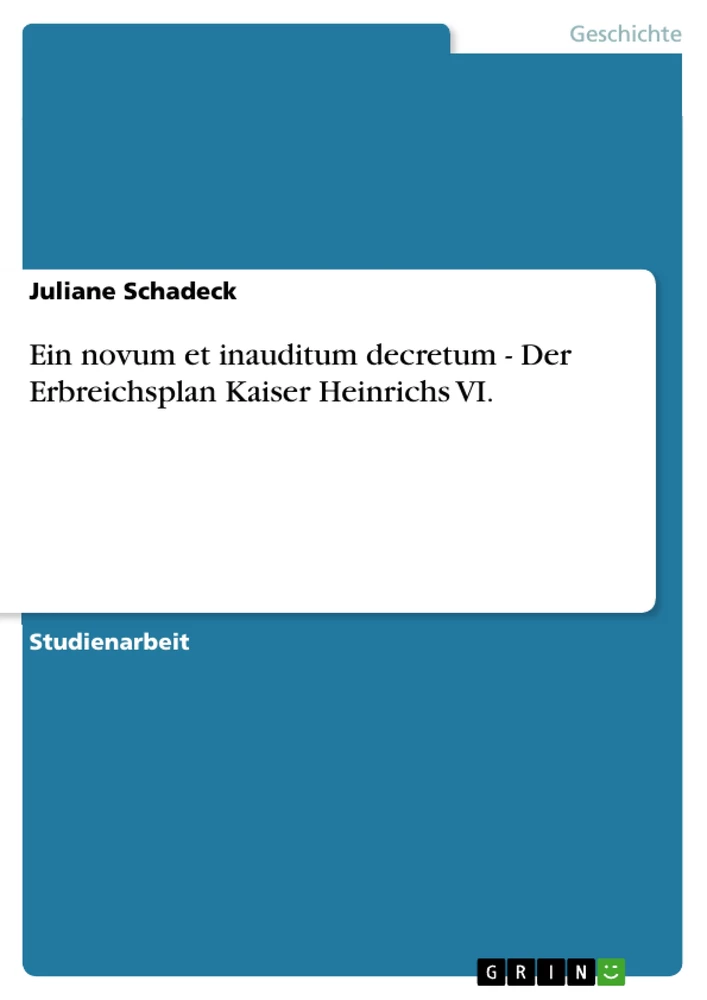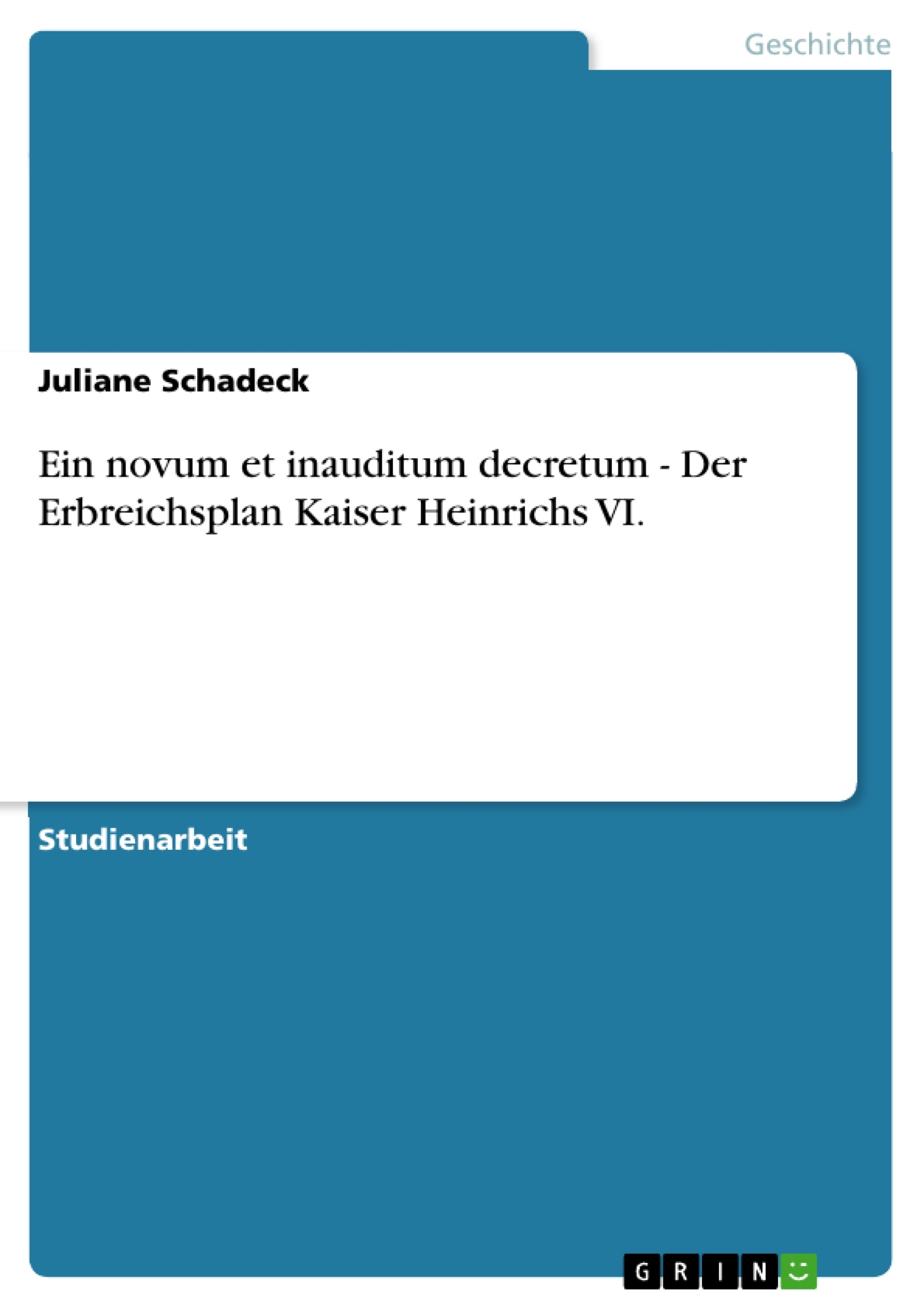„Die Geschichte Kaiser Heinrichs VI. gehört wie zu den wichtigsten Abschnitten des deutschen Mittelalters so auch zu denen, die heute noch der vollen Aufhellung am dringendsten bedürfen.“Dieses Urteil von Johannes Haller, kann ohne weiteres befürwortet werden. Viele Geschichtswissenschaftler haben sich im Laufe der Zeit überwiegend mit Barbarossa und Friedrich II. befasst. Im Gegensatz dazu hat Heinrich VI. und sein Schaffen wenig Beachtung gefunden. Nur wenige Mediävisten veröffentlichen Bücher über ihn und diese sprechen auch nur einen kleinen Leserkreis an. Einem großen Publikum bleibt der Stauferkaiser deshalb unbekannt. Aber seine Regierungszeit ist mehr als nur eine Übergangsphase zwischen den beiden berühmten Herrschern. Es lässt sich sogar sagen, dass Heinrich „das Stauferreich auf den Höhepunkt seiner Geltung“ vorantrieb. Unter ihm dehnte sich das deutsche Reich zu einer europäischen Großmacht aus. Mit der Gefangennahme von Richard Löwenherz gelang ihm ein kluger Schachtzug. Damit konnte er die Engländer unter Druck setzen und die welfischen Gegner im Reich entkräften. Und fast hätte er es durch eine taktische Meisterleistung erreicht, die staufische Herrschaft im Reich mit seinem Erbreichsplan dauerhaft sicherzustellen. Mit diesem Vorhaben hat Heinrich VI. den Versuch unternommen, das deutsche Reich in ein Erbreich umzuwandeln und damit die fürstliche Königswahl abzuschaffen. Nach mühsamen Verhandlungen mit Papst Coelestin III. und den geistlichen und weltlichen Fürsten, die beide starken Widerstand zeigten, hat er das Projekt aufgegeben. Die Arbeit hat das Anliegen, den Erbreichsplan als eine politische Neuerung Heinrichs VI. darzustellen. Im Mittelpunkt soll der Verlauf der Verhandlungen stehen und dabei wird versucht die Taktik der jeweiligen Partei nachzubilden. Des Weiteren sollen die Motive Heinrichs erörtert werden. Eine Zusammenfassung, sowie die Bedeutung und Beurteilung des Erbprojektes erfolgt in der Schlussbetrachtung. Bei der Darlegung des Themas war eine intensive Quellenarbeit und z.T. Quellenkritik erforderlich. Bei der Erörterung von Thesen werden die verschiedenen Forschungsstandpunkte dargestellt. Einzelne Forschungsdiskussionen können aufgrund von Seitenvorgaben aber nur angedeutet werden. Die maßgebende Fachliteratur für diese Untersuchung bildeten die Abhandlungen von Ernst Perels und Johannes Haller. Perels‘ Werk war besonders für die Rekonstruktion der Chronologie fundamental. Hilfreich waren aber auch die neueren Schriften von Hartmut Jericke und Ulrich Schmidt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellung der Quellen
- Vorgeschichte
- Der Verlauf des Erbreichsplans
- Der Designationsversuch von 1195
- Mainzer Reichstag
- Die Verabschiedung auf dem Würzburger Reichstag
- Scheitern des Erbreichsplans
- Die Opposition der Fürsten
- Die Verhandlungen mit Papst Coelestin III.
- Weitere Forschungsfragen
- Motive
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Erbreichsplan Kaiser Heinrichs VI. als politische Neuerung. Der Fokus liegt auf dem Verlauf der Verhandlungen und der Darstellung der jeweiligen Taktiken. Zusätzlich werden die Motive Heinrichs VI. beleuchtet.
- Der Erbreichsplan als politische Innovation Heinrichs VI.
- Der Verlauf der Verhandlungen zwischen Kaiser, Papst und Fürsten.
- Die Motive und Ziele Heinrichs VI. beim Entwurf des Erbreichsplans.
- Analyse der Opposition gegen den Erbreichsplan.
- Die Rolle der Quellenlage bei der Rekonstruktion des Erbreichsplans.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung betont die historische Bedeutung, aber auch die bisherige Forschungslücke bezüglich Kaiser Heinrichs VI. und seines Erbreichsplans. Die Vorstellung der Quellen beschreibt die Schwierigkeiten aufgrund der spärlichen und unpräzisen Überlieferungen, wobei die Marbacher Annalen und die Reinhardsbrunner Chronik als wichtigste Quellen genannt werden. Die Vorgeschichte wird in Kapitel 4 behandelt, während Kapitel 5 den Verlauf des Erbreichsplans detailliert beschreibt, beginnend mit dem Designationsversuch von 1195, über die Reichstage in Mainz und Würzburg, bis hin zum Scheitern des Plans aufgrund von Fürstenopposition und den Verhandlungen mit Papst Coelestin III. Kapitel 6 befasst sich mit den Motiven Heinrichs VI.
Schlüsselwörter
Kaiser Heinrich VI., Erbreichsplan, Staufer, Papst Coelestin III., Reichspolitik, Fürstenopposition, mittelalterliches Reich, Quellenkritik, Verhandlungen, mittelalterliche Geschichte.
- Citar trabajo
- Juliane Schadeck (Autor), 2008, Ein novum et inauditum decretum - Der Erbreichsplan Kaiser Heinrichs VI., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122566