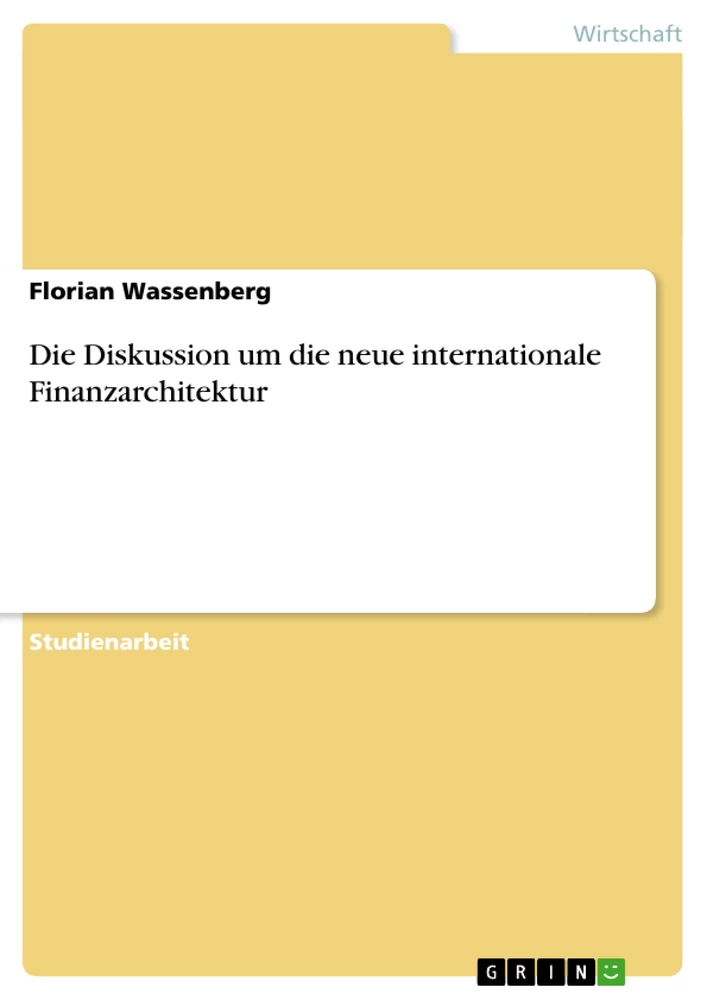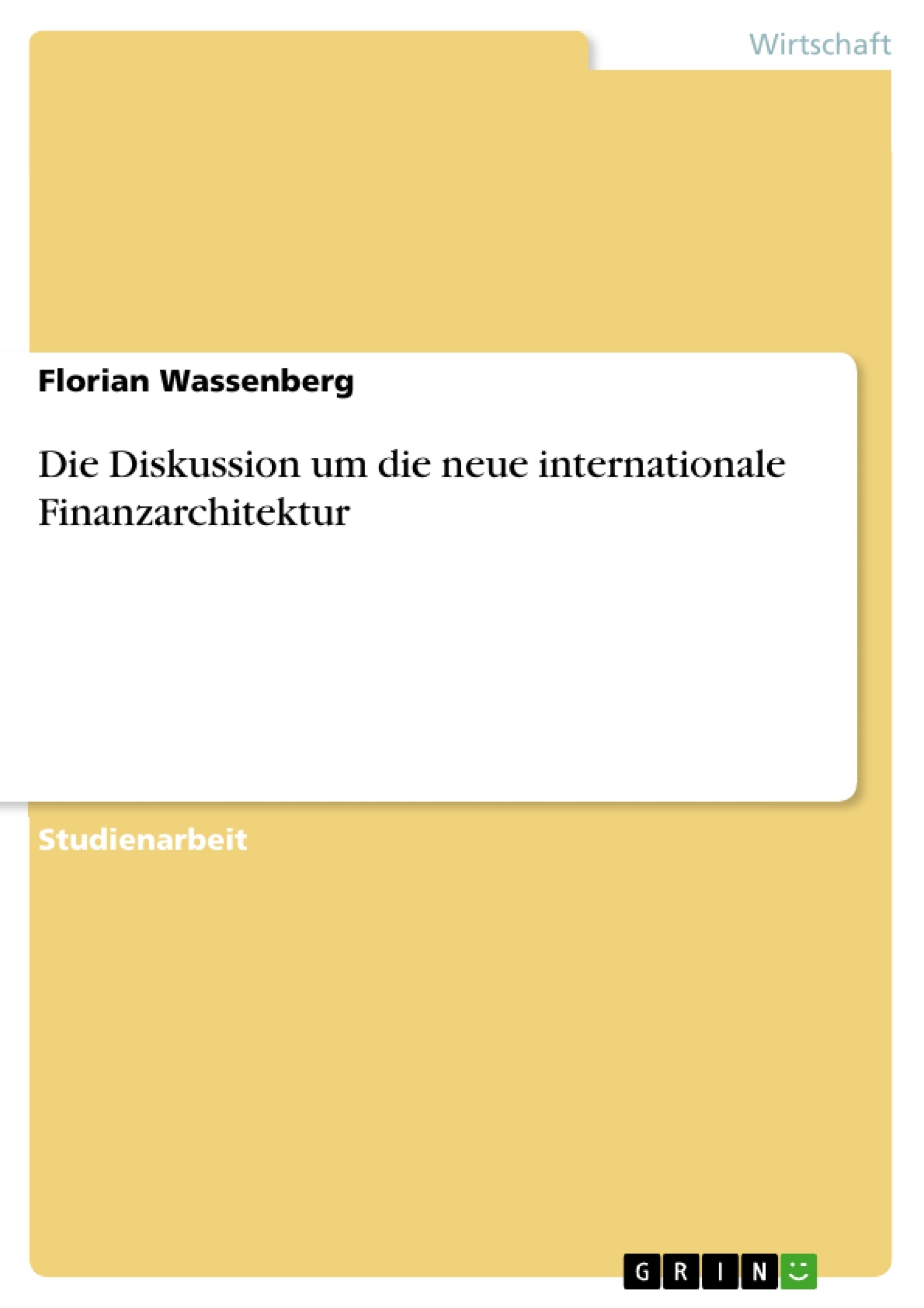Mit den Jahren wurden immer wieder Rufe nach einer Reform der aktuellen
internationalen Finanzarchitektur laut. Die Diskussion darüber, wie die neue internationale Finanzarchitektur gestaltet werden sollte,
bringt seither eine Vielzahl an Vorschlägen und Reformansätzen ins Gespräch. Ziel der
Diskussion ist es, Maßnahmen und Reformen zur Verbesserung der globalen Finanzstrukturen
zu entwickeln. Dazu gehört auch ein effektiver und effizienter Umgang mit den spürbaren
Folgen einer Krise für die Volkswirtschaft.
In dieser Arbeit soll nun ein Überblick über die Diskussion zur neuen internationalen
Finanzarchitektur gegeben werden. Der Fokus liegt auf ausgewählten Ansätzen, wie sie z.Z.
in Wirtschaft und Politik diskutiert werden. Gleichsam außer Acht gelassen werden solche
Vorschläge, die als nicht umsetzbar oder zielinkongruent betrachtet werden können. Hierzu
sei als Beispiel die Errichtung einer Weltzentralbank zu erwähnen. In Kapitel zwei werden
zunächst die ordnungspolitischen Zielsetzungen einer weitgreifenden Reform der
internationalen Finanzarchitektur dargestellt. Unter Berücksichtigung der Problematik des
Konzeptes der Impossible Trinity wird erläutert, warum Schwierigkeiten bei der Anwendung
dieser Reformen auftreten können und warum der Reformprozess trotz Bemühens aller
Beteiligten und einer intensiven Debatte bislang nur unzureichende Fortschritte macht. Die
Kapitel drei und vier geben einem Überblick über die bereits erwähnten Reformansätze,
wobei zwischen makroökonomischen und mikroökonomischen Ansätzen getrennt wird.
Als makroökonomische Reformansätze werden Wechselkurszielzonen zwischen den drei
wesentlichen globalen Leitwährungen US-Dollar, Euro und Yen aufgeführt, eine
Einschränkung des ungehinderten Kapitalverkehrs, z.B. mit sog. Tobin-Steuer vorgeschlagen
und die Umstrukturierung des IWF sowie des privaten Kreditsektors, dem sog. Bail-In
angesprochen. Auf mikroökonomischer Ebene werden Ansätze zur Reform der
Finanzmarktregulierung, z.B. durch die Einrichtung einer globalen Aufsichtsbehörde, die
Entwicklung zuverlässiger Frühwarnsysteme für Krisen und die Verbesserung der
Transparenz der globalen Finanzverflechtungen behandelt. Zu den jeweiligen Ansätzen wird
eine Analyse der Vor- und Nachteile und der Umsetzbarkeit in Hinblick auf das Konzept der
Impossible Trinity durchgeführt. Abschließend werden alle gewonnenen Erkenntnisse in
Kapitel fünf zusammengefasst und eine Handlungsempfehlung formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Ordnungspolitische Zielsetzungen und das Problem der Impossible Trinity
- Makroökonomische Ansätze zur Reform der internationalen Finanzarchitektur
- Wechselkurszielzonen
- Einschränkung des ungehinderten Kapitalverkehrs
- Umstrukturierung des Internationalen Währungsfonds (IWF)
- Der private Kreditsektor
- Mikroökonomische Ansätze zur Reform der internationalen Finanzarchitektur
- Der Grundsatz der Transparenz
- Finanzmarktregulierung
- Frühwarnsysteme
- Schlussbemerkungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Diskussion zur Reform der internationalen Finanzarchitektur. Der Fokus liegt auf ausgewählten, aktuell diskutierten Ansätzen aus Wirtschaft und Politik, wobei nicht umsetzbare oder zielinkongruente Vorschläge (z.B. die Errichtung einer Weltzentralbank) ausgeklammert werden. Die Arbeit analysiert ordnungspolitische Zielsetzungen im Kontext der "Impossible Trinity" und untersucht makro- und mikroökonomische Reformansätze.
- Ordnungspolitische Zielsetzungen und die "Impossible Trinity"
- Makroökonomische Reformansätze (Wechselkurse, Kapitalverkehr, IWF, privater Kreditsektor)
- Mikroökonomische Reformansätze (Transparenz, Finanzmarktregulierung, Frühwarnsysteme)
- Analyse der Vor- und Nachteile verschiedener Reformansätze
- Umsetzbarkeit der Reformansätze im Lichte der "Impossible Trinity"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Hintergrund der Diskussion um die Reform der internationalen Finanzarchitektur, ausgelöst durch verheerende Wirtschafts- und Währungskrisen der vergangenen Jahrzehnte. Sie umreißt den Fokus der Arbeit und die ausgewählte Methodik.
Ordnungspolitische Zielsetzungen und das Problem der Impossible Trinity: Dieses Kapitel stellt das wirtschaftspolitische Konzept der "Impossible Trinity" vor und erläutert die damit verbundenen Zielkonflikte bei der Gestaltung einer internationalen Finanzarchitektur. Es werden die Schwierigkeiten bei der gleichzeitigen Verfolgung von nationaler geldpolitischer Autonomie, freiem Kapitalverkehr und stabilem Wechselkurs beleuchtet.
Makroökonomische Ansätze zur Reform der internationalen Finanzarchitektur: Dieses Kapitel behandelt makroökonomische Reformansätze wie Wechselkurszielzonen, Einschränkungen des Kapitalverkehrs (z.B. Tobin-Steuer), Umstrukturierung des IWF und Reformen im privaten Kreditsektor (Bail-In).
Mikroökonomische Ansätze zur Reform der internationalen Finanzarchitektur: Hier werden mikroökonomische Ansätze diskutiert, wie die Verbesserung der Transparenz, Reformen der Finanzmarktregulierung (z.B. globale Aufsichtsbehörde) und die Entwicklung von Frühwarnsystemen.
Schlüsselwörter
Internationale Finanzarchitektur, Impossible Trinity, Wirtschaftskrisen, Währungskrisen, Makroökonomische Ansätze, Mikroökonomische Ansätze, Wechselkurszielzonen, Kapitalverkehrskontrollen, Tobin-Steuer, Internationaler Währungsfond (IWF), Finanzmarktregulierung, Transparenz, Frühwarnsysteme, Emerging Markets, Entwicklungs- und Schwellenländer.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Konzept der "Impossible Trinity"?
Es beschreibt den Zielkonflikt, dass ein Land nicht gleichzeitig feste Wechselkurse, freien Kapitalverkehr und eine eigenständige Geldpolitik haben kann.
Welche makroökonomischen Reformvorschläge werden diskutiert?
Diskutiert werden Wechselkurszielzonen, die Einschränkung des Kapitalverkehrs (z.B. Tobin-Steuer), die Umstrukturierung des IWF und die Einbindung privater Gläubiger (Bail-In).
Was ist das Ziel einer neuen internationalen Finanzarchitektur?
Ziel ist die Verbesserung globaler Finanzstrukturen, um Krisen zu verhindern oder deren Folgen für Volkswirtschaften effizienter zu bewältigen.
Welche mikroökonomischen Ansätze gibt es zur Finanzmarktreform?
Dazu gehören die Erhöhung der Transparenz, die Einrichtung globaler Aufsichtsbehörden und die Entwicklung von Frühwarnsystemen für Krisen.
Warum wurde die Idee einer Weltzentralbank in der Arbeit ausgeklammert?
Vorschläge wie die Errichtung einer Weltzentralbank werden als aktuell nicht umsetzbar oder zielinkongruent betrachtet und daher im Fokus der Analyse vernachlässigt.
- Arbeit zitieren
- Florian Wassenberg (Autor:in), 2009, Die Diskussion um die neue internationale Finanzarchitektur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122571