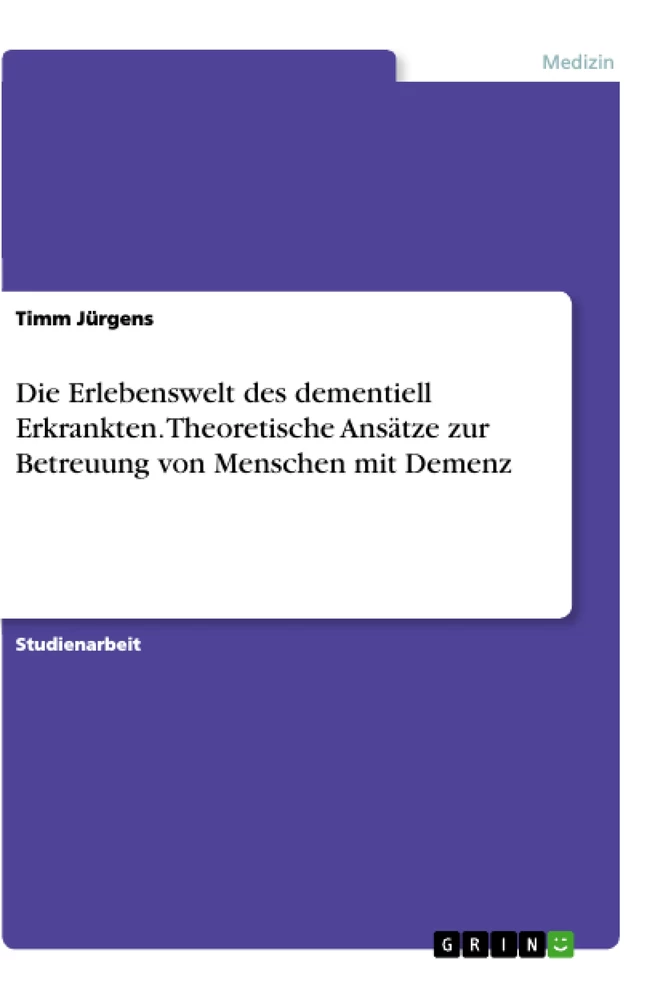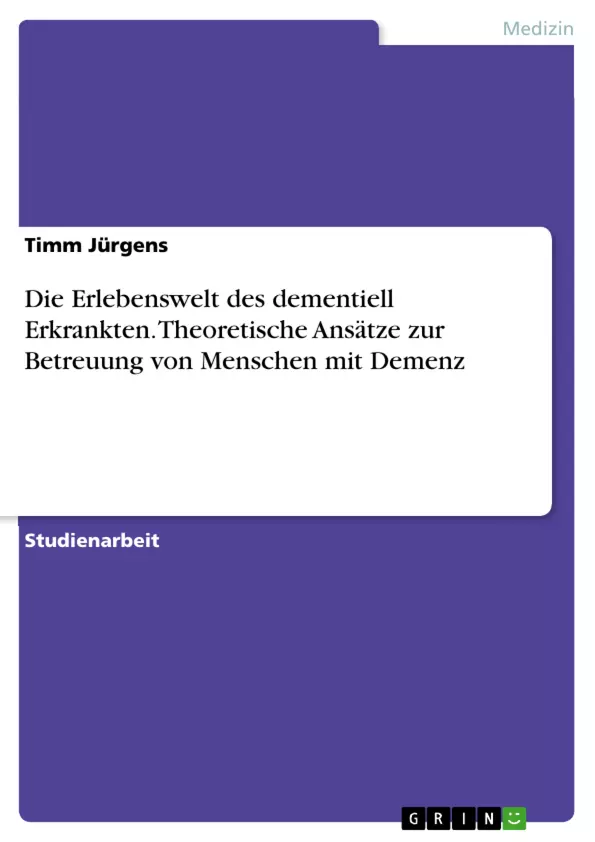In der Arbeit wird beschreiben, wie man die zum Teil verwirrten Verhaltensweisen verstehen und einen Zugang zur inneren Welt des dementen Menschen finden kann, damit ihm auch weiterhin mit Empathie und Wertschätzung begegnet wird.
„Wer dement ist, kann nichts mehr“ ist eine häufig geäußerte Meinung. Der Erkrankte kostet nur noch Geld, ist in seinem Handeln nicht mehr kalkulierbar und wird „zum Unglück“ seiner Angehörigen. Die professionelle und würdige Begleitung von Menschen, die an einer Demenz, z. B. der Alzheimer-Demenz leiden, gilt zu Recht zu den schwierigsten und anspruchvollsten Herausforderungen in der Pflege.
In meiner Beruflichkeit in der Altenpflege merke ich immer deutlicher, welche Ansprüche dementiell Erkrankte an mich als Mitarbeiter stellen. Sie bedürfen einer ganz besonderen Betreuung; einer Betreuung mit viel Geduld und Verständnis. In der vorliegenden Abschlussarbeit werden entsprechende Ansätze, Instrumente und Methoden vorgestellt, die das Ziel verfolgen, den an Demenz Erkrankten ein Leben in weitestgehender Zufriedenheit zu ermöglichen. Erfassen zu können, was demenzkranke Menschen in ihrem Dasein brauchen, setzt einen Einblick in ihre individuelle, subjektive Welt voraus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Dementielle Erkrankungen
- 2.1 Definition
- 2.2 Klassifikationen
- 2.2.1 Primäre Demenzen
- 2.2.2 Sekundäre Demenzen
- 2.3 Stadien der Demenz
- 2.4 Symptome der Demenzerkrankten
- 2.5 Die einfache Logik der Demenz
- 2.6 Gesetze der Demenz
- 2.6.1 Erstes Demenzgesetz: Gestörte Einprägung
- 2.6.2 Zweites Demenzgesetz: Der Gedächtnisabbau
- 2.7 Gesellschaftliche Aspekte zum Umgang mit dementiell erkrankten Menschen
- 2.8 Die Bedürfnispyramide nach Maslow im Bezug auf das Krankheitsbild Demenz
- 2.9 Die Bedürfnisblume für dementiell Erkrankte nach Kitwood
- 2.10 Das Erleben der Wirklichkeit bei Demenz
- 2.10.1 Allgemeine Betrachtungen zur Wirklichkeit
- 2.10.2 Der Krankheitsverlauf
- 2.10.3 Die Begleitungsbedürftigkeit
- 2.10.4 Die Versorgungsbedürftigkeit
- 2.10.5 Die Phase der Pflegebedürftigkeit
- 3. Professionelle Begleitung von Menschen mit Demenz
- 4. Kommunikation
- 5. Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abschlussarbeit untersucht die Erlebenswelt dementiell erkrankter Menschen und präsentiert Ansätze für eine professionelle und würdige Betreuung. Ziel ist es, Methoden und Instrumente vorzustellen, die den Betroffenen ein möglichst zufriedenstellendes Leben ermöglichen. Die Arbeit beleuchtet die individuellen Bedürfnisse dieser Menschen und zeigt Wege auf, ihr Verhalten zu verstehen und mit Empathie zu begegnen.
- Definition und Klassifizierung dementieller Erkrankungen
- Symptome, Stadien und die "Logik" der Demenz
- Gesellschaftliche Aspekte im Umgang mit Demenzkranken
- Professionelle Begleitung und Kommunikation mit Betroffenen
- Bedürfnisse dementiell erkrankter Menschen (Maslow, Kitwood)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die oft negative Wahrnehmung von Demenz und betont die Herausforderungen der professionellen Betreuung. Sie unterstreicht die Notwendigkeit einer besonderen Betreuung mit Geduld und Verständnis und kündigt die Präsentation von Ansätzen an, die dementiell Erkrankten ein zufriedenes Leben ermöglichen sollen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der individuellen, subjektiven Welt der Betroffenen und darauf, wie man verwirrte Verhaltensweisen verstehen und einen empathischen Zugang finden kann.
2. Dementielle Erkrankungen: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Darstellung dementieller Erkrankungen. Es beginnt mit der Definition von Demenz als chronische Verwirrtheit und Abbauerkrankung des Gehirns, wobei die Einschränkung kognitiver und geistiger Fähigkeiten hervorgehoben wird. Es differenziert zwischen primären und sekundären Demenzen, beschreibt die verschiedenen Stadien der Erkrankung und geht auf die gesellschaftlichen Aspekte des Umgangs mit dementiell erkrankten Menschen ein. Die Kapitelteile zu den Bedürfnissen dementiell erkrankter Menschen nach Maslow und Kitwood bieten wichtige theoretische Grundlagen für eine bedürfnisorientierte Pflege. Die Diskussion des Erlebens der Wirklichkeit bei Demenz inklusive der Krankheitsverläufe, Begleitungs- und Versorgungsbedürfnisse bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Betrachtung dieser komplexen Erkrankung.
3. Professionelle Begleitung von Menschen mit Demenz: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext, hier muss eine Zusammenfassung basierend auf dem gegebenen Text erstellt werden. Möglicherweise muss diese Zusammenfassung aus den bereits gegebenen Informationen zu den Bedürfnissen, der Kommunikation und den Stadien der Demenz abgeleitet werden. Es sollte der Fokus auf professionelle Betreuung, mögliche Ansätze und Methoden gelegt werden.)
4. Kommunikation: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext, hier muss eine Zusammenfassung basierend auf dem gegebenen Text erstellt werden. Die Zusammenfassung sollte sich auf die Kommunikation mit Demenzkranken konzentrieren und berücksichtigen, wie die Kommunikation an die Bedürfnisse und das Verständnisvermögen der Betroffenen angepasst werden kann.)
5. Kritische Würdigung: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext, hier muss eine Zusammenfassung basierend auf dem gegebenen Text erstellt werden. Diese Zusammenfassung sollte eine kritische Reflexion der vorgestellten Ansätze und Methoden enthalten. Es sollten Stärken und Schwächen der beschriebenen Ansätze bewertet und mögliche Verbesserungen oder Forschungslücken aufgezeigt werden.)
Schlüsselwörter
Demenz, Alzheimer-Demenz, dementielle Erkrankungen, Betreuung, Pflege, Kommunikation, Bedürfnisse, Maslow, Kitwood, gesellschaftliche Aspekte, professionelle Begleitung, Symptome, Stadien, kognitive Fähigkeiten, Therapieansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Abschlussarbeit über die Erlebenswelt Demenzkranker
Was ist der Hauptfokus dieser Abschlussarbeit?
Die Abschlussarbeit untersucht die Erlebenswelt dementiell erkrankter Menschen und präsentiert Ansätze für eine professionelle und würdige Betreuung. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der individuellen Bedürfnisse dieser Menschen und darauf, wie man ihr Verhalten verstehen und mit Empathie begegnen kann, um ihnen ein möglichst zufriedenstellendes Leben zu ermöglichen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Klassifizierung dementieller Erkrankungen (inkl. primärer und sekundärer Demenzen), Symptome, Stadien und die "Logik" der Demenz, gesellschaftliche Aspekte im Umgang mit Demenzkranken, professionelle Begleitung und Kommunikation mit Betroffenen, sowie die Bedürfnisse dementiell erkrankter Menschen nach Maslow und Kitwood. Die Arbeit beleuchtet auch das Erleben der Wirklichkeit bei Demenz und den damit verbundenen Krankheitsverläufen, Begleitungs- und Versorgungsbedürfnissen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Dementielle Erkrankungen, Professionelle Begleitung von Menschen mit Demenz, Kommunikation und Kritische Würdigung. Das Kapitel "Dementielle Erkrankungen" beinhaltet detaillierte Informationen zu Definition, Klassifizierung, Stadien, Symptomen und gesellschaftlichen Aspekten. Es werden außerdem die Bedürfnispyramiden nach Maslow und Kitwood im Kontext von Demenz erläutert. Die anderen Kapitel befassen sich mit professionellen Betreuungsansätzen, der Kommunikation mit Demenzkranken und einer kritischen Reflexion der vorgestellten Methoden.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Demenz, Alzheimer-Demenz, dementielle Erkrankungen, Betreuung, Pflege, Kommunikation, Bedürfnisse, Maslow, Kitwood, gesellschaftliche Aspekte, professionelle Begleitung, Symptome, Stadien, kognitive Fähigkeiten und Therapieansätze.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die oft negative Wahrnehmung von Demenz und betont die Herausforderungen der professionellen Betreuung. Sie unterstreicht die Notwendigkeit einer besonderen Betreuung mit Geduld und Verständnis und kündigt die Präsentation von Ansätzen an, die dementiell Erkrankten ein zufriedenes Leben ermöglichen sollen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der individuellen, subjektiven Welt der Betroffenen und darauf, wie man verwirrte Verhaltensweisen verstehen und einen empathischen Zugang finden kann.
Was wird im Kapitel "Dementielle Erkrankungen" behandelt?
Dieses Kapitel liefert eine umfassende Darstellung dementieller Erkrankungen, beginnend mit der Definition von Demenz als chronische Verwirrtheit und Abbauerkrankung des Gehirns. Es differenziert zwischen primären und sekundären Demenzen, beschreibt die verschiedenen Stadien der Erkrankung und geht auf die gesellschaftlichen Aspekte des Umgangs mit dementiell erkrankten Menschen ein. Es beinhaltet auch die Bedürfnispyramiden nach Maslow und Kitwood und eine Diskussion des Erlebens der Wirklichkeit bei Demenz, inklusive der Krankheitsverläufe, Begleitungs- und Versorgungsbedürfnisse.
Welche Informationen fehlen in der Zusammenfassung der Kapitel 3, 4 und 5?
Im Originaltext fehlen die Kapitelzusammenfassungen für die Kapitel 3 ("Professionelle Begleitung von Menschen mit Demenz"), 4 ("Kommunikation") und 5 ("Kritische Würdigung"). Diese Zusammenfassungen müssten basierend auf den gegebenen Informationen zu den Bedürfnissen, der Kommunikation und den Stadien der Demenz erstellt werden.
Wie können die fehlenden Kapitelzusammenfassungen ergänzt werden?
Die fehlenden Kapitelzusammenfassungen können durch eine Ableitung aus den bereits gegebenen Informationen ergänzt werden. Kapitel 3 sollte sich auf professionelle Betreuung, mögliche Ansätze und Methoden konzentrieren. Kapitel 4 sollte sich auf die Kommunikation mit Demenzkranken und deren Anpassung an die Bedürfnisse und das Verständnisvermögen der Betroffenen konzentrieren. Kapitel 5 sollte eine kritische Reflexion der vorgestellten Ansätze und Methoden enthalten, Stärken und Schwächen bewerten und mögliche Verbesserungen oder Forschungslücken aufzeigen.
- Citation du texte
- Timm Jürgens (Auteur), 2006, Die Erlebenswelt des dementiell Erkrankten. Theoretische Ansätze zur Betreuung von Menschen mit Demenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122625