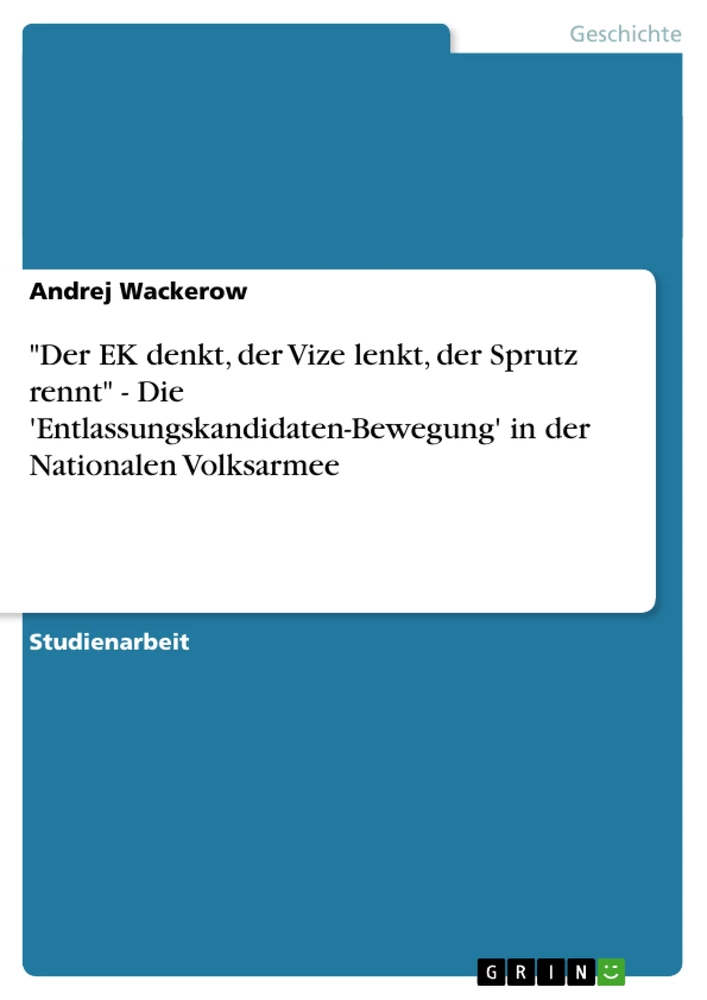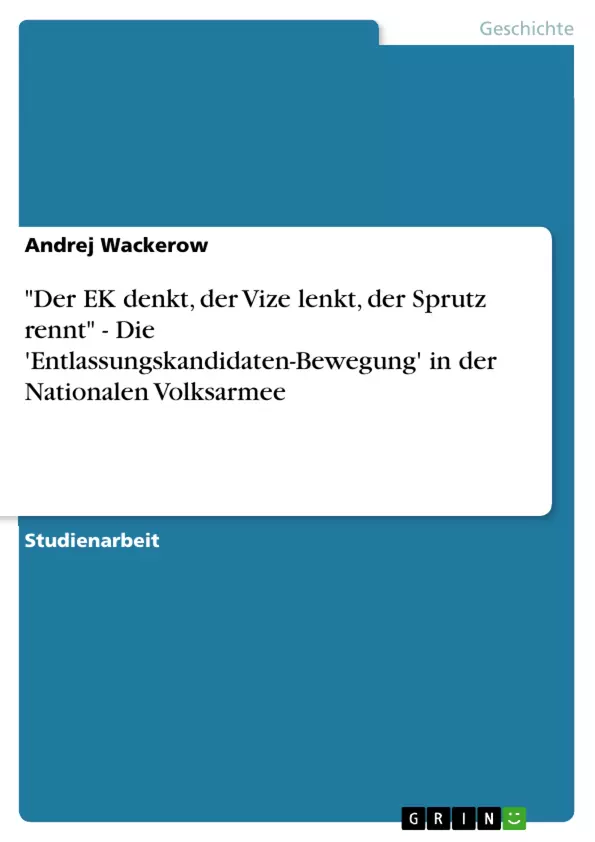Die 'EK-Bewegung' ist wohl eine der ungewöhnlichsten und auch am weitesten verbreitete sozio-kulturelle Erscheinung innerhalb der modernen Armeen des 20. Jahrhunderts. Es finden sich zwar auch innerhalb der Armeen des Warschauer Paktes und denen der NATO-Staaten vergleichbare Strukturen unter den Wehrpflichtigen1, jedoch bildet die Ausprägung der 'EK-Bewegung' in der NVA durch die Vielzahl an Gegenständen und Bräuchen ein Spezifikum, wie es unter den Armeen des 19. und 20. Jahrhunderts einzigartig ist. Die Herausbildung von Sozialistischen Soldatenpersönlichkeiten in der NVA wurde durch die als sekundäre Anpassung bekannt gewordene hierarchische Struktur der 'EK-Bewegung' oft unterwandert und zum Teil auch konterkariert. [...] Zentrales Untersuchungsthema der Arbeit wird sein, welches die Gründe waren, die die Entstehung der informellen Hierarchie unter den Wehrdienstleistenden begünstigen und wie sich diese auf den militärischen Gesamtkontext auswirkte. Was waren die Rituale, deren sich die EKs bedienten? Warum war die Zeit das zentrale Instrument der Bewegung gewesen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Wesen und zur Geschichte der 'EK-Bewegung'
- Wesen und Entstehung – die sechziger Jahre
- Die Manifestierung der 'EK-Bewegung' – die siebziger und achtziger Jahre
- Das Ende der 'EK-Bewegung': 1989 – 1990
- Rolle der 'EK-Bewegung' im militärischen Alltag
- Bräuche, Gegenstände und Riten
- Der Kult um die Zeit
- Die drei Diensthalbjahre: Sprutz, Vitze, EK
- Die 'EK-Bewegung' im Spiegel der Vorgesetzten und Offiziellen
- Ambivalenz zwischen Entlassungskandidaten und Unteroffizieren
- Prinzipien der Dienstverweigerung - Militärischer Ungehorsam der EK's
- Die Reaktion der Institutionen - Militärjustiz
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung, Entwicklung und Auswirkungen der informellen „EK-Bewegung“ innerhalb der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR. Sie analysiert die Gründe für die Entstehung dieser sozialen Struktur unter Wehrpflichtigen und deren Einfluss auf den militärischen Alltag und das Verhältnis zu Vorgesetzten. Die Arbeit beleuchtet die Rituale, Symbole und den „Kult um die Zeit“, die die EK-Bewegung prägten.
- Entstehung und Entwicklung der EK-Bewegung in der NVA
- Rituale, Bräuche und Symbole der EK-Bewegung
- Die Rolle der Zeit als zentrales Element der EK-Bewegung
- Das Verhältnis zwischen EKs und Vorgesetzten
- Die Reaktion der Institutionen auf die EK-Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die „EK-Bewegung“ als eine informelle Hierarchie unter Wehrpflichtigen der NVA, die durch den Wunsch nach Entlassung geprägt war. Sie hebt die Besonderheit dieser Bewegung im Kontext anderer Armeen hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung verdeutlicht, dass die Arbeit auf existierender Literatur und Militärhandbüchern basiert, da eine umfassende Aktenanalyse den Rahmen sprengen würde.
Zum Wesen und zur Geschichte der 'EK-Bewegung': Dieses Kapitel behandelt die Entstehung und Entwicklung der EK-Bewegung. Es wird der Einfluss der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und der damit verbundenen Einschränkungen der Freizeit auf die Stimmung der Wehrpflichtigen beleuchtet. Der Wunsch nach der Entlassung und die damit verbundene informelle Hierarchie werden als zentrale Aspekte dargestellt. Der Abschnitt differenziert zwischen den Entstehungsgründen und der konkreten Ausprägung der Bewegung in den 1960er, 70er und 80er Jahren.
Rolle der 'EK-Bewegung' im militärischen Alltag: Dieses Kapitel analysiert die Bräuche, Gegenstände und Rituale, die die EK-Bewegung kennzeichneten. Der „Kult um die Zeit“ als zentrales Element wird ausführlich behandelt, genauso wie die unterschiedlichen Phasen des Wehrdienstes (Sprutz, Vitze, EK) und ihre Auswirkungen auf die soziale Dynamik innerhalb der Truppe. Der Fokus liegt darauf, wie die informelle Struktur der EK-Bewegung den militärischen Alltag beeinflusste.
Die 'EK-Bewegung' im Spiegel der Vorgesetzten und Offiziellen: Dieses Kapitel untersucht die ambivalente Rolle der EKs im Verhältnis zu ihren Vorgesetzten. Es wird die Frage behandelt, inwieweit die informelle Macht der EKs das offizielle militärische Rangverhältnis untergrub und wie die Institutionen auf diese Herausforderung reagierten. Der Fokus liegt auf der Reaktion der Militärjustiz und der Strategien der EKs, um den Wehrdienst zu „überstehen“.
Schlüsselwörter
EK-Bewegung, Nationale Volksarmee (NVA), DDR, Wehrpflicht, informelle Hierarchie, Soldatenkultur, Rituale, Symbole, Zeit, Militärjustiz, sekundäre Anpassung, Entlassungskandidaten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur "EK-Bewegung" in der NVA
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die informelle „EK-Bewegung“ innerhalb der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR. Sie analysiert Entstehung, Entwicklung und Auswirkungen dieser sozialen Struktur unter Wehrpflichtigen auf den militärischen Alltag und das Verhältnis zu Vorgesetzten.
Was ist die „EK-Bewegung“?
Die „EK-Bewegung“ bezeichnet eine informelle Hierarchie unter Wehrpflichtigen der NVA, die durch den Wunsch nach Entlassung (EK = Entlassungskandidat) geprägt war. Sie entwickelte sich als Reaktion auf die Bedingungen des Wehrdienstes und die damit verbundenen Einschränkungen.
Welche Aspekte der „EK-Bewegung“ werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte, darunter die Entstehung und Entwicklung der Bewegung, ihre Rituale und Symbole, den „Kult um die Zeit“, das Verhältnis zwischen EKs und Vorgesetzten sowie die Reaktion der Militärjustiz.
Wann und warum entstand die „EK-Bewegung“?
Die Entstehung der „EK-Bewegung“ wird im Kontext der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und der damit verbundenen Einschränkungen der Freizeit der Wehrpflichtigen betrachtet. Die Arbeit differenziert die Entwicklung in den 1960er, 70er und 80er Jahren.
Welche Rolle spielte die Zeit in der „EK-Bewegung“?
Der „Kult um die Zeit“ wird als zentrales Element der „EK-Bewegung“ beschrieben. Die Arbeit analysiert, wie die Wahrnehmung und das Erleben der Zeit den Alltag und die soziale Dynamik innerhalb der Truppe beeinflussten.
Wie war das Verhältnis zwischen EKs und Vorgesetzten?
Die Arbeit analysiert die ambivalente Rolle der EKs im Verhältnis zu ihren Vorgesetzten. Sie untersucht, inwieweit die informelle Macht der EKs das offizielle militärische Rangverhältnis untergrub und wie die Institutionen darauf reagierten.
Wie reagierten die Institutionen auf die „EK-Bewegung“?
Die Reaktion der Militärjustiz und die Strategien der EKs, um den Wehrdienst zu „überstehen“, werden im Kontext der institutionellen Reaktion auf die „EK-Bewegung“ untersucht.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf existierender Literatur und Militärhandbüchern, da eine umfassende Aktenanalyse den Rahmen sprengen würde.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Wesen und zur Geschichte der „EK-Bewegung“, ein Kapitel zur Rolle der Bewegung im militärischen Alltag, ein Kapitel zum Verhältnis zu Vorgesetzten und Offiziellen, und eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: EK-Bewegung, Nationale Volksarmee (NVA), DDR, Wehrpflicht, informelle Hierarchie, Soldatenkultur, Rituale, Symbole, Zeit, Militärjustiz, sekundäre Anpassung, Entlassungskandidaten.
- Quote paper
- Andrej Wackerow (Author), 2008, "Der EK denkt, der Vize lenkt, der Sprutz rennt" - Die 'Entlassungskandidaten-Bewegung' in der Nationalen Volksarmee, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122634