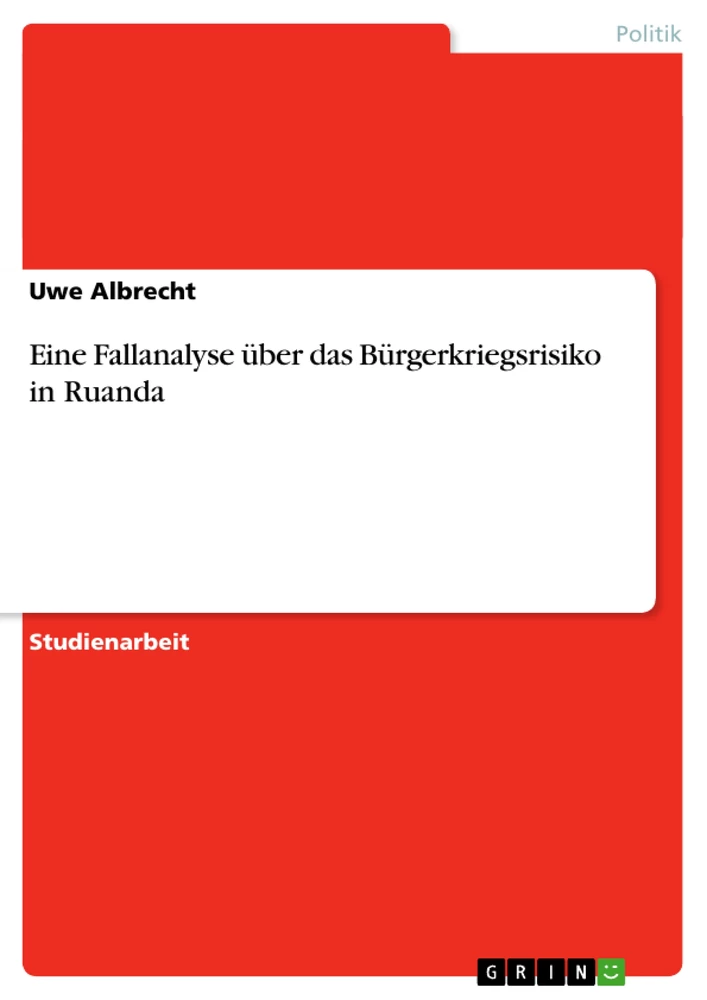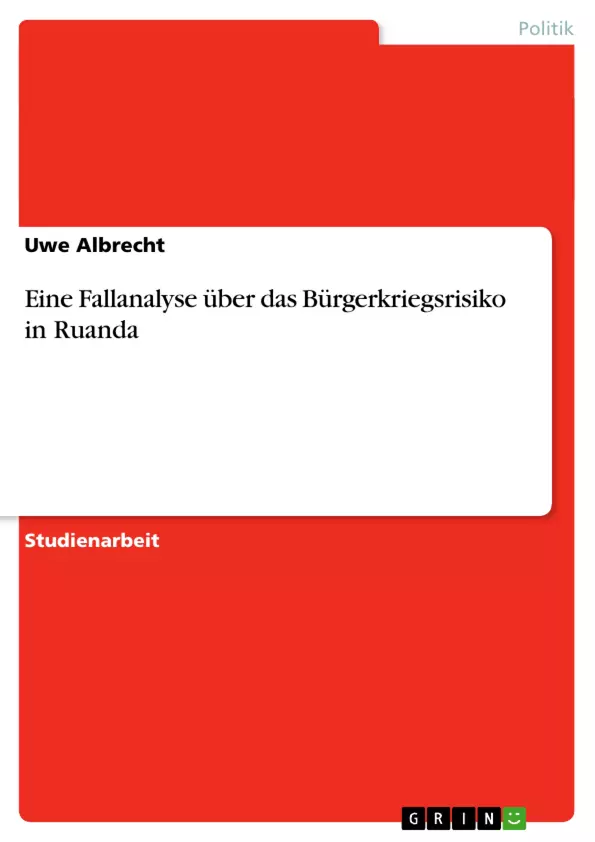Das ostafrikanische Land Ruanda erlangte in den 1990er Jahren durch den Genozid zu trauriger Berühmtheit in der Welt. In dem Land, welches flächenmäßig vergleichbar mit dem Bundesland Brandenburg ist, kamen damals schätzungsweise 500.000 bis 1.000.000 Menschen ums Leben. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt indes nicht auf diesem dramatischen Ereignis, sondern betrachtet den Zeitraum der 1980er Jahre. Auf der Grundlage zweier Ansätze soll für diesen Zeitraum das Bürgerkriegsrisiko in Ruanda analysiert werden. Dementsprechend orientiert sich die Arbeit an der Frage, in wie weit das Bürgerkriegsrisiko in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre in Ruanda vorhanden war? Aus dieser Frage wurde folgende Hypothese abgleitet:
In der zweiten Hälfte der 80er Jahre existierte in Ruanda sowohl in ökonomischer, als auch in politischer Hinsicht ein erhöhtes Bürgerkriegsrisiko.
Bevor das weitere Vorgehen dargestellt wird, sollen noch einige Anmerkungen gemacht werden.
A) Bei der Bemessung des Risikos handelt es sich lediglich um eine Wahrscheinlichkeitsanalyse. Mit anderen Worten, es kommt zur Überprüfung von Faktoren, die im Verdacht stehen einen Bürgerkrieg zu begünstigen. Allein ein hohes Risiko muss demnach nicht unweigerlich in einem Bürgerkrieg münden.
B) Bekanntermaßen brach 1990 in Ruanda ein Bürgerkrieg aus. Es ist aber nicht das Ziel dieser Arbeit, einen Erklärungsansatz für diesen zu liefern. Die Bemessung des Bürgerkriegsrisikos muss daher strikt von dem stattgefundenen Bürgerkrieg getrennt gesehen werden.
C) Aufgrund der genannten Trennung wurde bei der vorliegenden Arbeit Wert darauf gelegt, dass die zu ziehenden Schlüsse nicht auf Ereignissen oder Tatsachen basieren, welche in den Zeitraum nach 1989 zu verorten sind.
Um die aufgestellte Hypothese zu überprüfen, soll zunächst näher auf den Untersuchungsgegenstand ‚Ruanda’ eingegangen werden. Im Anschluss daran wird sowohl eine Definition von Bürgerkriegen, als auch die dieser Arbeit zugrunde liegenden Erklärungsmodelle vorgestellt. Ein Erklärungsmodell verfolgt dabei einen ökonomischen Ansatz und geht auf Collier und Hoeffler zurück. Bei dem Anderen handelt es sich um einen politischen Ansatz von Schlichte. Die darauf folgende Analyse findet im dritten Kapitel statt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Historischer Abriss
2. Definition & Theorien zur Erklärung
2.1 Definition Bürgerkrieg
2.2 Theorien zur Bemessung des Bürgerkriegsrisikos
2.2.1 Der ökonomische Ansatz nach Coullier und Hoeffler
2.2.2 Der politische Ansatz nach Schlichte
3. Analyse des Bürgerkriegsrisikos
3.1 Das Bürgerkriegsrisiko – ökonomischer Ansatz
3.1.1 Finanzierungsmöglichkeiten
3.1.2 Die Kostenseite der Revolution
3.1.3 Weitere Faktoren mit Einfluss auf das Bürgerkriegsrisiko
3.1.4 Ökonomische Anreizstrukturen für Rebellen in Ruanda
3.2 Das Bürgerkriegsrisiko – der politische Ansatz
3.2.1 Die politischen Strukturen in Ruanda
3.2.2 Der Einfluss der wirtschaftlichen Rezession auf das politische System
4. Fazit
5. Quellenverzeichnis
Einleitung
Das ostafrikanische Land Ruanda erlangte in den 1990er Jahren durch den Genozid zu trauriger Berühmtheit in der Welt. In dem Land, welches flächenmäßig vergleichbar mit dem Bundesland Brandenburg ist, kamen damals schätzungsweise 500.000 bis 1.000.000 Menschen ums Leben. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt indes nicht auf diesem dramatischen Ereignis, sondern betrachtet den Zeitraum der 1980er Jahre. Auf der Grundlage zweier Ansätze soll für diesen Zeitraum das Bürgerkriegsrisiko in Ruanda analysiert werden. Dementsprechend orientiert sich die Arbeit an der Frage, in wie weit das Bürgerkriegsrisiko in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre in Ruanda vorhanden war? Aus dieser Frage wurde folgende Hypothese abgleitet:
In der zweiten Hälfte der 80er Jahre existierte in Ruanda sowohl in ökonomischer, als auch in politischer Hinsicht ein erhöhtes Bürgerkriegsrisiko.
Bevor das weitere Vorgehen dargestellt wird, sollen noch einige Anmerkungen gemacht werden.
A) Bei der Bemessung des Risikos handelt es sich lediglich um eine Wahrscheinlichkeitsanalyse. Mit anderen Worten, es kommt zur Überprüfung von Faktoren, die im Verdacht stehen einen Bürgerkrieg zu begünstigen. Allein ein hohes Risiko muss demnach nicht unweigerlich in einem Bürgerkrieg münden.
B) Bekanntermaßen brach 1990 in Ruanda ein Bürgerkrieg aus. Es ist aber nicht das Ziel dieser Arbeit, einen Erklärungsansatz für diesen zu liefern. Die Bemessung des Bürgerkriegsrisikos muss daher strikt von dem stattgefundenen Bürgerkrieg getrennt gesehen werden.
C) Aufgrund der genannten Trennung wurde bei der vorliegenden Arbeit Wert darauf gelegt, dass die zu ziehenden Schlüsse nicht auf Ereignissen oder Tatsachen basieren, welche in den Zeitraum nach 1989 zu verorten sind.
Um die aufgestellte Hypothese zu überprüfen, soll zunächst näher auf den Untersuchungsgegenstand ‚Ruanda’ eingegangen werden. Im Anschluss daran wird sowohl eine Definition von Bürgerkriegen, als auch die dieser Arbeit zugrunde liegenden Erklärungsmodelle vorgestellt. Ein Erklärungsmodell verfolgt dabei einen ökonomischen Ansatz und geht auf Collier und Hoeffler zurück. Bei dem Anderen handelt es sich um einen politischen Ansatz von Schlichte. Die darauf folgende Analyse findet im dritten Kapitel statt.
1. Historischer Abriss
Bereits in der vorkolonialen Zeit existierte in der ruandischen Monarchie die Unterscheidung zwischen Tutsis, Hutus und Twas. Allerdings basierten diese Kategorien in der damaligen Gesellschaftsstruktur weniger auf ethnischen Merkmalen, sondern waren vielmehr ein Produkt auf der Grundlage von Abstammung, materiellem Besitz, Status und weiteren sozialen Faktoren. Am oberen Ende des streng hierarchischen Systems standen die Tutsis, welche die herrschende Elite stellte und ca. 14% an der Gesamtbevölkerung ausmachten. Unter den Hutus, mit rund 85% die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe, verstand man im Allgemein die arbeitende Landbevölkerung und die Twas, welche mit 1% einen marginalen Anteil an der Bevölkerung einnahmen, waren Jäger und Sammler Entgegen einer ethnischen Konzeption teilten sich die Twas, Hutus und Tutsis eine gemeinsame Sprache, es gab keine regionale Trennung wie z.B. Hutu- oder Tutsiland und Mischehen waren nicht unüblich. (vgl. Prunier 1995, S.5) Bemerkenswert an diesem sozialen Kastensystem war dessen Durchlässigkeit, was dazu führte, dass aus einem Hutu ein Tutsi werden konnte oder umgekehrt.
Durch die europäische Kolonialherrschaft erfuhr das hochkomplexe Kastensystem einen drastischen Wandel. Zunächst die Deutschen und im Anschluss des 1. Weltkrieges auch die Belgier, interpretierten die bestehenden Kategorien innerhalb der damaligen ruandischen Gesellschaft als Ausdruck einer Rassenzugehörigkeit. Die Kolonialherren übernahmen nicht nur die bestehende Hierarchie, sondern es kam während dieser Zeit auch zu einer Zementierung der gesellschaftlich dominanten Stellung der Tutsis gegenüber den Hutus und Twas. Diese drückte sich u.a. in einem privilegierten Zugang zu Bildung und Arbeit aus. Eine bürokratische Dimension erhielt das Rassensystem durch die im Jahre 1933 von den Belgiern eingeführten Ausweise, auf denen die Rassenzugehörigkeit vermerkt wurde. Die Sympathien der Belgier für die Tutsis hielten bis in die 50er Jahre an, schlug dann allerdings in das Gegenteil um. Der Grund für den Stimmungswandel auf Seiten der Belgier wird zum einen auf die verschobenen Machtverhältnisse in Belgien selber und zum anderen auf die Forcierung des Unabhängigkeitsprozesses durch die Tutsis zurückgeführt. (vgl. Minear/Guillot 1996, S.54; Prunier 1995, S.47f.)
Bei den im Zuge des Unabhängigkeitsprozesses abgehaltenen Wahlen Anfang der 60er Jahre ging die Hutu Partei PARMEHUTU als eindeutiger Sieger hervor. Der erste Präsident des seit dem 1. Juli 1962 unabhängigen Landes, wurde Grégoire Kayibanda. Wie sehr die Ethnisierung durch die Kolonialzeit von der Bevölkerung verinnerlicht wurde lässt sich nicht nur am Wahlergebnis ablesen, dieses spiegelte im Großen und Ganzen die bestehende Gruppenkonstellation wider, sondern wurde vor allem durch die blutigen Geburtsstunden der Republik mehr als offensichtlich. Bereits 1959, als die Tutsi-Monarchie durch den Tod des Königs ihr Ende fand, brach eine Welle der Gewalt über das Land, bei der geschätzte 10.000 Tutsis den Tod fanden und weitere 130.000 Tutsis in die Nachbarländer flohen. In den ersten Jahren der Republik kam es immer wieder zu Angriffen durch die in die Nachbarländer geflohenen Tutsis. Diese Aktionen blieben erfolglos und führten letztendlich dazu, dass die Repressionen gegenüber den Tutsis in Ruanda zunahmen und die Zahlen der Toten und Flüchtlinge weiter anstiegen. Auch wenn es durch die Unabhängigkeit Ruandas zu einem Austausch der Führungselite kam, blieben die streng hierarchischen Strukturen der Machtausübung die Gleichen. Die Rassenvermerke in den Ausweispapieren wurden weitergeführt und die Gruppe der Tutsi wurde sowohl politisch als auch gesellschaftlich marginalisiert. „After independence, those officially classified as Batutsi [andere Bezeichnung für Tutsi; Anmerk. d. Ver.] were subjected to strict quotas in secondary and higher education, and in public employment.” (Hintjens 1999, S.247)
In der zweiten Hälfte der 60er Jahre nahm die Gefahr einer Invasion durch die in den Nachbarländern lebenden Tutsis ab. Parallel hierzu traten allerdings Spannungen innerhalb der Hutu-Gemeinde auf. Die zugrunde liegenden Differenzen resultierten u.a. aufgrund der Machtstruktur von Präsident Kayibanda, welche auf der Hutu-Elite aus dem Süden des Landes basierte. Nachdem es 1972 im benachbarten Burundi zu einem von den dortigen Tutsis initiierten Massaker an den Hutus kam, versuchte Kayibanda die Hutus gegen die Tutsis in Ruanda aufzubringen, um so seinen drohenden Machtverlust zu unterbinden. In der Folge von repressiven Maßnahmen kam es zu einer weiteren Flüchtlingswelle auf Seiten der Tutsis in die umliegenden Länder. Der Machtverfall konnte indes nicht aufgehalten werden und so kam es am 5. Juli 1973 zu einem unblutigen Umsturz, aus dem Juvénal Habyarimana als neuer Präsident hervorging. (vgl. Prunier 1995, S.60f.) Auch wenn sich der neue Präsident offiziell zu der Vormachtstellung der Hutus im Gesamten bekannte, verschob sich das Machtzentrum vom Süden des Landes in den Norden. „Where President Kayibanda relied on Southernes, President Habyarimana favoured North-westerners.” (Minear/Guillot 1996, S.55) Neben der Etablierung einer neuen Machtelite aus dem Norden des Landes führte Habyarimana das Einparteiensystem ein. Lediglich die neu geschaffene Partei Mouvement républicain national pour le développment (MRND) war zugelassen und die Parteizugehörigkeit war für die gesamte Bevölkerung verpflichtend.
Bis in die zweite Hälfte der 80er Jahre kam es weder zu weiteren Wellen der Gewalt gegen die Tutsis, noch wurde der Staat durch die im Exil lebenden Tutsis militärisch herausgefordert. Auch wenn weiterhin eine strukturelle Diskriminierung gegenüber den Tutsis bestand, so verbesserte sich jedoch deren Alltagssituation gegenüber den Jahren unter der Herrschaft von Kayibanda. „Unitl the early 1990s, Batutsi business people were allowed to operate relatively freely in private business and in the professions, but were strictly limited in terms of access to public office or official state employment.“ (Hintjens 1999, S.257)
Eine weitere bedeutende Entwicklung für Ruanda fand in den 80er Jahren im benachbarten Uganda statt, wo es eine große Exilgemeinschaft ruandischer Tutsis gab. Wie viele Menschen dieser Gemeinschaft letztendlich angehörten, ist bis heute Bestandteil kontroverser Auseinandersetzungen und die Angaben divergieren zum Teil beträchtlich.[1] Indes unbestritten scheint die Bedeutung der ruandischen Exilgemeinschaft in den kriegerischen Auseinandersetzungen Ugandas im selbigen Jahrzehnt. An der Seite des ugandischen Rebellenführers Museveni, der 1986 in Uganda an die Macht kam, kämpften zeitweise bis zu 8.000 Tutsis aus Ruanda. 1986 stellten die Exiltutsis ca. 20% der Soldaten in Musevenis National Resistance Army (NRA). (vgl. Prunier 1995, S.71) Zum engsten Kreis des ugandischen Führers zählten die beiden ruandischen Exilanten Fred Rwigyema und Paul Kagame. Beide spielten eine wichtige Rolle in der 1987 entstandenen Rwandese Patriotic Front (RPF), deren Ziel die Rückführung der Tutsis nach Ruanda war. Rwigyema stieg unter Museveni gar bis zum Oberbefehlshaber der Armee und zum Verteidigungsminister auf. Allerdings wurden die ruandischen Tutsis in den Reihen von Museveni zunehmend zu einer Belastung der Ende der 80er Jahre stattfindenden Friedensgespräche in Uganda. Als Konsequenz darauf wurde Rwigyeam 1989 von seinen Ämtern enthoben.
2. Definition & Theorien zur Erklärung
2.1 Definition Bürgerkrieg
Da das Ziel der vorliegenden Arbeit die Einschätzung des Bürgerkriegsrisikos in Ruanda ist, so ist es unerlässlich kurz darzustellen, welche Definition von Bürgerkrieg zugrunde gelegt wird. Um Bürgerkriege als solches zu identifizieren, existieren in der Wissenschaft Kriterien, die versuchen, den Charakter dieser Konfliktform zu fassen. So groß die Übereinstimmung unter den Experten ist, dass Bürgerkriege heutzutage wesentlich häufiger auftreten als zwischenstaatliche Kriege und demnach erstere stark an Bedeutung gewonnen haben, so unterschiedlich sind die zugrunde liegenden Definitionen bezüglich der Konfliktart ‚Bürgerkriege’. Offensichtlich wird die Diskrepanz, wenn es darum geht, ab wie vielen Opfern eine Situation als Bürgerkrieg bezeichnet werden kann. Small und Singer beispielsweise bezeichnen einen Konflikt als Bürgerkrieg, wenn, neben weiteren Kriterien, die Opferzahl mindestens 1000 pro Jahr beträgt. (vgl. Singer/Small 1982, S.213) Als differenzierter erweist sich hierbei Sambanis, bei dem der Beginn eines Bürgerkrieges in das Jahr terminiert wird, indem mindestens zwischen 500 und 1.000 Opfer zu verzeichnen sind, oder wenn es innerhalb von drei Jahren zu insgesamt 1000 Opfer kommt, wobei in diesem Falle das erste Jahr als Beginn des Bürgerkrieges terminiert wird. Aufgrund der differenzierteren Definition Sambanis wird dieser der Vorzug gegenüber der von Small und Singer gegeben und in der Folge weiter ausgeführt. Neben dem bereits genannten Kriterium müssen a) die teilnehmenden Parteien politisch und militärisch organisiert sein und dabei für ein öffentliches Ziel eintreten, b) die Regierung muss eine der Kriegsparteien stellen, c) die Rebellenarmee muss in der Lage sein, im Bürgerkriegsland Mitglieder zu rekrutieren und muss demnach auch in diesem Land präsent sein, d) der Bürgerkrieg dauert so lange an, wie der Konflikt in einem Drei-Jahres Intervall mindestens 500 Opfer verzeichnet und e) muss die überlegende Kriegspartei auf effektiven Widerstand treffen, was numerisch mindestens 100 Opfer bedeutet. (vgl. Sambanis 2004, S. 829f.)
[...]
[1] Ausführlich wird diese Problematik Diskutiert in Prunier 1995, S. 61-67. Geringere Schwankungen zeigen die Angaben bezüglich der Flüchtlinge im Jahre 1964 auf. Demnach befanden sich zwischen 78.000 (vgl. Prunier 1995, S.62) und ca. 100.000 (vgl. Khadiagala 2002, S.464) ruandische Flüchtlinge in Uganda.
Häufig gestellte Fragen zum Bürgerkriegsrisiko in Ruanda
Gab es in Ruanda bereits in den 80er Jahren ein Bürgerkriegsrisiko?
Ja, die Hypothese der Arbeit ist, dass in der zweiten Hälfte der 80er Jahre sowohl ökonomisch als auch politisch ein erhöhtes Risiko bestand.
Was ist der ökonomische Ansatz nach Collier und Hoeffler?
Dieser Ansatz untersucht Faktoren wie Finanzierungsmöglichkeiten für Rebellen und ökonomische Anreizstrukturen als Auslöser für Bürgerkriege.
Wie unterschieden sich Hutu und Tutsi ursprünglich?
In vorkolonialer Zeit basierte der Unterschied primär auf sozialem Status, Besitz und Abstammung und war durchlässig, nicht rein ethnisch definiert.
Welchen Einfluss hatte die Kolonialzeit?
Die Kolonialherren (Deutsche und Belgier) interpretierten soziale Klassen als Rassen um und zementierten die Vorherrschaft der Tutsis, was zu späteren Spannungen führte.
Was war der politische Ansatz zur Risikoanalyse?
Der Ansatz nach Schlichte analysiert politische Strukturen und den Einfluss wirtschaftlicher Rezessionen auf die Stabilität des politischen Systems.
- Quote paper
- Uwe Albrecht (Author), 2008, Eine Fallanalyse über das Bürgerkriegsrisiko in Ruanda , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122672