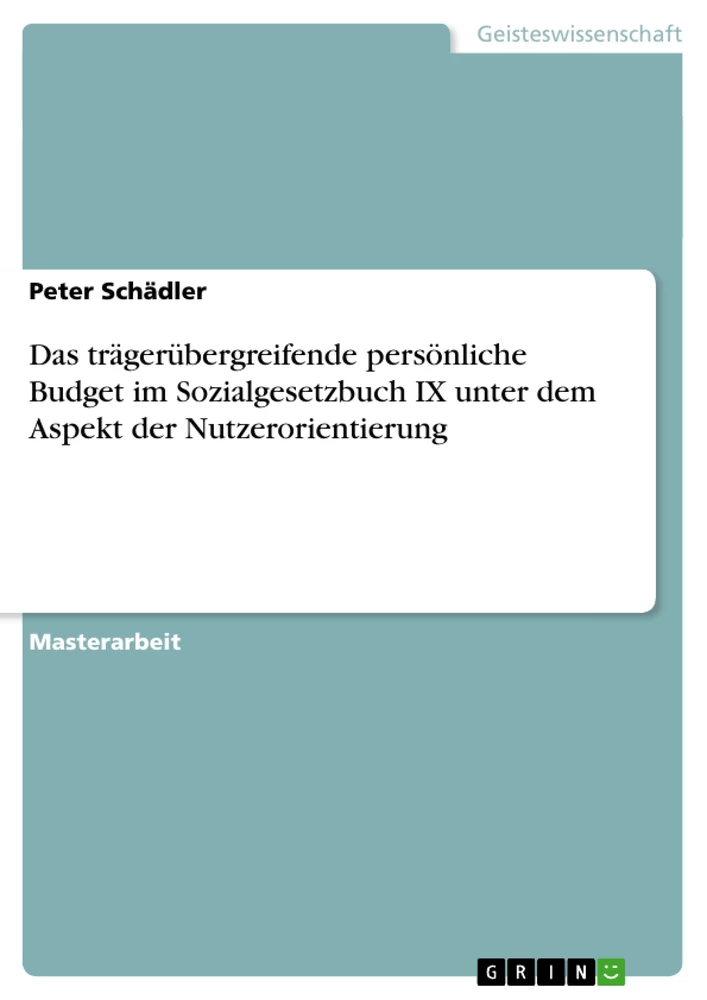1 Einleitung***
Anfang 2001 wurde mit dem Projekt „Selbst bestimmen – Hilfe nach Maß“ in Rhein-land-Pfalz in Modellkommunen eingeführt, 2004 wurde es landesweit eingeführt. „Mit dem Persönlichen Budget können sich die behinderten Menschen selbstbestimmt diejenigen Leistungen einkaufen, die sie individuell benötigen“ (Ministerium für Arbeit, 2006 S. 1). Ebenfalls ein persönliches Budget ist das bundesweit in Modellprojekten erprobte trägerübergreifende persönliche Budget (TPB). Nach dreieinhalb jähriger Erprobungsphase besteht seit 01.01.2008 ein Rechtsanspruch auf das TPB. Mit dem TPB kann der Mensch mit Behinderung oder der von Behinderung bedrohte Mensch seine Hilfe selbst zukaufen. Er entscheidet, wann er welche Hilfe durch wen in Anspruch nimmt. Trägerübergreifend heißt, dass sich das Budget aus Geld- oder Sachleistungen verschiedener Träger zusammensetzen (kann).
Der damalige Bundesminister für Arbeit und Soziales Franz Müntefering lobte in sei-ner Rede anlässlich der Auftaktveranstaltung der Infotour „Selbstbestimmt leben: Persönliches Budget“ in Berlin am 3. September 2007, dass ein Paradigmenwechsel bei der selbstbestimmten Teilhabe und Gleichstellung behinderter Menschen in allen Be-reichen des gesellschaftlichen Lebens stattfindet. Franz Müntefering spricht davon, dass
„das klassische Leistungsdreieck zwischen Leistungsträger, Leistungserbringer und Leistungsempfänger wird damit aufgelöst. Der Budgetnehmer wird zum Käufer, Kunden oder Arbeitgeber. Er bestimmt wann, wie und durch wen die Leistung erbracht wird – eine wesentliche Voraussetzung für selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“ (Müntefering, 2007 S. 12).
Windisch meint, dass mit der Einrichtung persönlicher Budgets eine Stärkung der selbstbestimmten Lebensgestaltung, Autonomie und der individuellen Ressourcen (Wahloptionen) gewährleistet wird. (Windisch, 2006 S. 110)
[...]
I. Inhaltsverzeichnis
II. Abkürzungsverzeichnis
III. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Das Konzept der Nutzerorientierung
2.1 Die Begriffe Nutzer, Anbieter und Kunde
2.2 Was bedeutet Nutzerorientierung?
2.3 Nutzerorientierung im Sozial- und Gesundheitswesen
2.4 Argumente für ein nutzerorientiertes Versorgungssystem
2.4.1 Das ethische Argument
2.4.2 Das ökonomische Argument
2.5 Die Nutzerorientierung beim trägerübergreifenden persönlichen Budget
3 Entwicklung, Rechtliche Grundlagen und verwaltungsrelevante Fragestellungen
3.1 Grundlagen des Persönlichen Budgets
3.2 Leistungserbringung und Zuständigkeiten
3.3 Gemeinsame Servicestellen
3.4 Gestaltung des Verwaltungsverfahrens
3.5 Bedarfsfeststellungsverfahren
3.6 Zielvereinbarungen
3.7 Budgetberatung und Budgetunterstützung („Budgetassistenz“)
4 Überprüfung der Nutzerorientierung in den Modellprojekten
4.1 Vorstellung der Modellprojekte
4.1.1 Deutsche Modelle und Erfahrungen
4.1.2 Europäische Modelle und Erfahrungen
4.2 Überprüfung der Nutzerorientierung im Antragsverfahren
4.3 Nutzerorientierung im persönlichen Bereich
4.4 Rechtsfragen im persönlichen Budget in Bezug zur Nutzerorientierung
5 Zusammenfassung - Diskussion
6 Literaturverzeichnis
IV. Anhang
II. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
III. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildungen
Abbildung 1: Verfahren nach Budgetverordnung (Narbeshuber, et al., 2007 S. 10)
Abbildung 2: Dauer der Antragsbearbeitung in den Modellregionen und Regionen außerhalb (Meyer, et al., 2007 S. 124)
Abbildung 3: Fallaktivitäten und Zeitaufwand nach inhaltlicher Relevanz sowie Beteiligung der Antragsteller (Meyer, et al., 2007 S. 130)
Abbildung 4: Bedarfsbereiche in Instrumenten zur Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe im Vergleich zu ICF-Kategorien in Verbindung mit dem konzeptionellen Rahmen einer funktionsbezogenen Bedarfsfeststellung (Meyer, et al., 2007 S. 139 - 140)
Abbildung 5: Verbesserungen im Leben seit Erhalt des Persönlichen Budgets (Anzahl der Nennungen) (Mehrfachnennungen, n=283) (Meyer, et al., 2007 S. 215)
Abbildung 6: Nachteile des Persönlichen Budgets aus Sicht der Budgetnehmer/innen (Anzahl der Nennungen, Mehrfachantworten, n=130) (Meyer, et al., 2007 S. 219)
Tabellen
Tabelle 1: Verankerung des Persönlichen Budgets in den einzelnen Leistungsgesetzen (Kastl, et al., 2005 S. 24)
Tabelle 2: Die Umsetzung der Nutzerorientierung im TPB
1 Einleitung
Anfang 2001 wurde mit dem Projekt „Selbst bestimmen – Hilfe nach Maß“ in Rhein- land-Pfalz in Modellkommunen eingeführt, 2004 wurde es landesweit eingeführt. „Mit dem Persönlichen Budget können sich die behinderten Menschen selbstbestimmt die- jenigen Leistungen einkaufen, die sie individuell benötigen“ (Ministerium für Arbeit, 2006 S. 1). Ebenfalls ein persönliches Budget ist das bundesweit in Modellprojekten erprobte trägerübergreifende persönliche Budget (TPB). Nach dreieinhalb jähriger Erprobungsphase besteht seit 01.01.2008 ein Rechtsanspruch auf das TPB. Mit dem TPB kann der Mensch mit Behinderung oder der von Behinderung bedrohte Mensch seine Hilfe selbst zukaufen. Er entscheidet, wann er welche Hilfe durch wen in Ans- pruch nimmt. Trägerübergreifend heißt, dass sich das Budget aus Geld- oder Sachleis- tungen verschiedener Träger zusammensetzen (kann).
Der damalige Bundesminister für Arbeit und Soziales Franz Müntefering lobte in sei- ner Rede anlässlich der Auftaktveranstaltung der Infotour „Selbstbestimmt leben: Per- sönliches Budget“ in Berlin am 3. September 2007, dass ein Paradigmenwechsel bei der selbstbestimmten Teilhabe und Gleichstellung behinderter Menschen in allen Be- reichen des gesellschaftlichen Lebens stattfindet. Franz Müntefering spricht davon, dass
„das klassische Leistungsdreieck zwischen Leistungsträger, Leistungserbringer und Leistungs- empfänger wird damit aufgelöst. Der Budgetnehmer wird zum Käufer, Kunden oder Arbeitge- ber. Er bestimmt wann, wie und durch wen die Leistung erbracht wird – eine wesentliche Vor- aussetzung für selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“ (Müntefering, 2007 S. 12).
Windisch meint, dass mit der Einrichtung persönlicher Budgets eine Stärkung der selbstbestimmten Lebensgestaltung, Autonomie und der individuellen Ressourcen (Wahloptionen) gewährleistet wird. (Windisch, 2006 S. 110)
„ … über ein Persönliches Budget [kann] ein bedarfsdeckendes Unterstützungsarrangement ge- schaffen werden, welches sowohl den subjektiven Vorstellungen und Wünschen der Budget- nehmer/innen entspricht als auch zu einer Erweiterung personaler Handlungsspielräume, Selbst- bestimmungsmöglichkeiten und Teilhabechancen führt („Outcome“)?“ (Kastl, et al., 2005 S. 41)
Anlässlich des 7. Vormundschaftsgerichtstags wies Westecker darauf hin, dass „der oft geforderte Paradigmenwechsel vom defizitorientierten Rehabilitationsparadigma hin zum nutzerorientierten, Behindert-Sein als Normalität akzeptierenden Paradigma, in dem die Betroffenen selbstbestimmt über ihre Hilfe und ihr Leben entscheiden kön- nen, ist eine Voraussetzung für das Persönliche Budget.“ (Vormundschaftsgerichtstag, 2001 S. 92 - 93) Er erläutert weiter, dass das persönliche Budget nur nutzerorientiert sein kann, wenn es keinen Menschen mit einer bestimmten Behinderung oder einem bestimmten Hilfebedarf ausschließt. (Vormundschaftsgerichtstag, 2001 S. 93)
„Mit dem Persönlichen Budget erhalten Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, notwendi- ge Unterstützung bedarfsgerecht und wunschgemäß selbst zu organisieren. Dieses neue Steue- rungsinstrument intendiert eine Stärkung der Position der Leistungsberechtigten im Rehabilitati- onssystem und eine höhere Passgenauigkeit und Wirksamkeit rehabilitativer Leistungen.“ (Meyer, et al., 2007 S. 37)
In der Masterarbeit „Das trägerübergreifende persönliche Budget im Sozialgesetzbuch IX unter dem Aspekt der Nutzerorientierung“ möchte ich nun untersuchen, in wie weit sich der beschriebene Paradigmenwechsel in einer Nutzerorientierung beim träger- übergreifende persönliche Budget niedergeschlagen hat.
Da das trägerübergreifende persönliche Budget in der überwiegenden Mehrzahl nicht trägerübergreifend ist, sondern ein persönliches Budget (nur ein Leistungsträger!) verwende ich in der weiteren Masterarbeit stellvertretend das persönliche Budget.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differen- zierung, wie z.B. Budgetnehmer/Innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
2 Das Konzept der Nutzerorientierung
2.1 Die Begriffe Nutzer, Anbieter und Kunde
Ein Nutzer ist eine Person, die ein Hilfsmittel oder eine Leistung in Anspruch nimmt oder nehmen möchte zur Erzielung eines Vorteils (eines Nutzens). (Wikipedia, Enzyklopädie, 2008) In Sinne des persönlichen Budgets sind die Nutzer die behinder- ten Menschen oder von Behinderung bedrohte Menschen. Die Nutzer erhalten Dienst-, Geld- und Sachleistungen.
Anbieter leitet sich von Angebot ab. Im betriebswirtschaftlichen Sinne versteht man darunter eine verbindliche Angabe für potentielle Kunden (Nutzer), unter welchen Bedingungen Waren geliefert oder Dienstleistungen erbracht werden. (Wikipedia, Enzyklopädie, 2008)
Die Anbieter, die Dienst-, Geld- und Sachleistungen anbieten, sind in diesem Falle zum einen die für das trägerübergreifende persönliche Budget zuständigen Behörden und Versicherungen und zum anderen die Dienstleister, die den Budgetnehmer unters- tützen.
Die „Wirtschaft“ sieht in einem Kunden eine Organisation oder eine Person, die Güter oder Dienstleistungen bezieht. (Wikipedia, Enzyklopädie, 2008)
Auf dem Markt treffen Kunden und Anbieter zusammen und es bildet sich der Preis. Der Kundenbegriff beinhaltet im Sprachgebrauch aber auch Vertrags- und Entschei- dungsfreiheit und Kundenautonomie. Auch im Gesundheits- und Sozialwesen wird zusehends der Begriff Kunde anstatt Nutzer gebraucht. Allerdings gelten die oben ge- nannten betriebswirtschaftlichen Charakteristika im Gesundheits- und Sozialwesen eingeschränkt oder gar nicht. (Ruprecht, 2005 S. 1) Wichtige Unterschiede zwischen Nutzer und Kunden:
- Bei der Absicherung wesentlicher Lebensrisiken (Krankheit, Erwerbslosigkeit) ist die Vertragsfreiheit beschränkt. Die Risiken sind für keinen Menschen „ab- wählbar“. Viele Gesellschaftsordnungen erzwingen die Mitgliedschaft in Ver- sorgungssystemen mit der Verpflichtung zur Zahlung (z.B. gesetzliche Kran- kenversicherung). Je teurer und aufwendiger eine Leistung, desto strikter sind die Zugangsvoraussetzungen und das Angebot ist sehr begrenzt. Für den Nut- zer sind die Wahlmöglichkeiten geschränkt.
- Da Sozial- und Gesundheitsleistungen häufig über Versicherungen angeboten werden, besteht die Gefahr des „moral hazard“, d.h. dass die Tendenz besteht, dass das Versicherungsverhältnis durch ungerechtfertigte Inanspruchnahme ge- lenkt wird (opportunistisches Verhalten). (Frick, 2005 S. 16)
- Die Preisbildung auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage führt bei komplexen Angeboten zu hohen Preisen und zu brisanten Verteilungsproble- men (Zwei-Klassen-Medizin).
- Ohne vertrauensvolles Verhältnis zum Dienstanbieter (z.B. Arzt-Patient) ist ein Erfolg der Maßnahme nur eingeschränkt oder nicht möglich.
- Es besteht ein Gefälle bezüglich der Sachkenntnis zwischen Anbieter (Exper- ten) und Nutzer (Laien). Während sich auf dem freien Markt der Kunde und Lieferant auf gleicher Augenhöhe begegnen, nimmt der Nutzer mit steigender Bedürftigkeit eine immer schlechtere Position ein. Zumal die Wahlmöglichkei- ten noch eingeschränkt sind.
- Kauft ein Kunde ein Produkt, kann er es bei „Nicht-Gefallen“ zurückgeben.
Diese Marktmacht ist beim Nutzer geringer. Hinzu kommt noch, dass dem
Nutzer nur bestimmte Produkte angeboten werden. Ein Boykott ist auch nicht möglich. (Ruprecht, 2005 S. 2 - 3)
In vielen Fällen ist der Nutzer von Gesundheits- und Sozialleistungen kein oder nur zum Teil direkter Kunde des Anbieters. Üblich im Gesundheitswesen ist die Sachleis- tung ohne oder nur mit geringer Zuzahlung. Die eigentliche Vergütung übernimmt ein Dritter. Hinzu kommt, dass die Preise nicht für die Leistung in der marktüblichen Weise zu Stande kommen, sondern durch die Politik festgelegt werden. Es handelt sich also um eine Dreiecksbeziehung. Die rechtlichen Verhältnisse folgen auch nicht der üblichen Vertragsfreiheit. Bei Mängeln kann der Kunde vom Vertrag nicht zurück- treten und sein Geld verlangen. Bei Sozialleistungen muss der Kunde, wenn er die Leistungen in Anspruch nehmen will, seiner Mitwirkungspflicht nachkommen. (Beck- Texte, 2008 S. 21 - 22) Diese Unterschiede im Kunden-Anbieter-Verhältnis lassen klar werden, dass der Kundenbegriff nicht einfach auf den Empfänger von Versor- gungsleistungen übertragen werden kann. Hier ist der Begriff Nutzer („user“), wie er auch im angelsächsischen Sprachraum benutzt wird, die bessere Wahl. (Frick, 2005 S. 4)
2.2 Was bedeutet Nutzerorientierung?
Die Nutzerorientierung ist trotz der begrifflichen Abgrenzung zwischen Kunde und Nutzer im Prinzip das gleiche wie die Kundenorientierung. Die Kundenorientierung ist das wichtigste, wenn nicht sogar das entscheidende Qualitätsmerkmal eines Produkts oder einer Dienstleistung, auch im Sozial- und Gesundheitswesen. Der optimale Fall wäre, dass der Anbieter alle Wünsche des Kunden bzw. Nutzers erfüllt und somit die bestmögliche Qualität liefert. Eine Definition für die Kundenorientierung liefert Bruhn:
„Kundenorientierung ist die umfassende, kontinuierliche Ermittlung und Analyse der individuel- len Kundenerwartungen sowie deren interne und externe Umsetzung in unternehmerische Leis- tungen sowie Interaktionen im Rahmen eines Relationship-Marketing-Konzeptes mit dem Ziel, langfristig stabile und ökonomisch vorteilhafte Kundenbeziehungen zu etablieren.“ (Bruhn, 2003 S. 15)
Da dies in den seltensten Fällen der Fall ist, arbeiten viele Anbieter an der ständigen Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Infolgedessen arbeiten viele Un- ternehmen an der Einführung und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsys- tems um am Markt bestehen zu können (Qualitätspolitik, Qualitätsziele, Qualitätsver- besserung, Qualitätsplanung, Qualitätslenkung, Qualitätssicherung). (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, 2003 S. 58).
2.3 Nutzerorientierung im Sozial- und Gesundheitswesen
In den Bereichen mit Dienstleistungen in der karitativen, gemeinnützigen oder obrig- keitsstaatlichen Tradition (Gesundheits- und Sozialwesen) ist der Begriff des Kunden bzw. der Kundenorientierung nicht einfach übertragbar. In der Marktwirtschaft erwirbt der Kunde das Produkt oder verzichtet auf den Erwerb. Er hat durch den Verzicht kei- nen (lebensbedrohlichen) Nachteil. Bei einer Krankheit, seelischer oder körperlicher Behinderung oder materieller Not ist dies gerade nicht möglich. Je größer die Not oder ernster die Krankheit, desto größer ist die Macht des Anbieters. (Ruprecht, 2005 S. 5) Im Europa nach dem 2. Weltkrieg entwickelte sich von einem Verkäufer- zu einem Käufermarkt. In der heutigen Zeit herrschen die Kundengewinnung und vor allem die Kundenbindung („Relationship-Marketing“ – siehe auch Bruhn Seite 9) vor. Rela- tionship-Marketing und Kundenorientierung können im Grundsatz auf das Gesund- heits- und Sozialsystem übertragen werden. Aber es bleiben beachtenswerte Unter- schiede. Zufriedene Kunden bleiben in der Regel dem Unternehmen „treu“. Patienten oder Empfänger von Sozialleistungen versuchen ihre „Kunden-Rolle“ (selbst wenn sie hoch zufrieden sind) so schnell wie möglich aufzugeben. Aus diesem Grund wird ein Relationship-Marketing ins Leere laufen, sofern es sich nicht um chronisch Kranke oder dauerhaft hilfsbedürftige handelt. Ein geeigneter Adressat von Relationship- Marketing sind die Leistungsträger wie Krankenversicherungen oder Kommunen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Gesundheits- und Sozialsys- teme oft noch weit davon entfernt sind, nutzer- oder kundenzentrierte Leistungen lie- fern zu können. Im sich abzeichnenden Wettbewerb versuchen viele Anbieter ihre Qualität zu verbessern und zu messen. Allerdings fehlt es oft nicht nur am (politi- schen) Willen, sondern an der existentiellen Notwendigkeit. (Ruprecht, 2005 S. 8)
Der Sachverständigenrat hat in seinem Gutachten darauf hingewiesen, dass
„… die Selbsthilfekompetenz, Mündigkeit und Selbstverantwortung des Nutzers durch nutzer- orientierte soziale Dienstleistungen besser gestützt wird als durch angebotsorientierte Dienstleis- tungen.“ (Sachverständigenrat, 2003 S. 226)
Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik merkte bei einer Tagung 2003 an, dass
„ … Markt- und Nutzerorientierung, Produktdefinitionen, Monetarisierung und die Orientierung auf Ergebnisse werden jedoch in Zukunft wesentliche Entwicklungspotentiale auch und gerade für soziale Dienste bleiben.“ (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, 2003 S. 108)
2.4 Argumente für ein nutzerorientiertes Versorgungssys- tem
2.4.1 Das ethische Argument
Das Gesundheits- und Sozialsystem wird von der Bevölkerung finanziert und wurde von ihr geschaffen. Es soll die Bevölkerung mit dem versorgen, was sie braucht bzw. für wichtig erachtet. Es soll keinen Schaden zufügen und hat ich aus der christlich- abendländischen Tradition in Verbindung mit der Entwicklung demokratischer Staaten ausgebildet. Mitentwickelt hat sich ein humanitärer Leitfaden, der in vielen Varianten kodifiziert wurde (Erklärung der Menschenrechte, Standesordnung des Weltärztebun- des, Sozialgesetzbuch V usw.). Die Nutzerorientierung stellt somit das wichtigste (Qualitäts-) Merkmal eines Versorgungssystems dar. Ohne dieses Merkmal hat das System keine Legitimität und keine Überlebenschance. (Ruprecht, 2005 S. 8)
2.4.2 Das ökonomische Argument
Allein in Deutschland werden für die Gesundheits- und Sozialsysteme ca. 12% des Bruttoinlandsprodukts verwendet. Dadurch kommt die Frage auf, da es nachgewiesene Qualitätsmängel gibt, ob die eingesetzten Ressourcen nicht anderswo besser eingesetzt werden könnten (Opportunitätskostenfrage). Es lassen sich allerdings nur Näherungs- werte für die systemischen Mängel im deutschen Versorgungssystem angeben. Diese belaufen sich auf 7,5 bis 10 Milliarden Euro pro Jahr. Durch mangelhafte Nutzerorien- tierung (fehlende oder ungenügende Kommunikation) im Arzneimittelsektor entstehen z. B. durch „Therapieuntreue“ Kosten in Milliardenhöhe. Durch Verbesserungen in den Arbeitsabläufen und effizienteren Einsatz von Ressourcen ließen sich die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung senken. Studien verdeutlichen, wo die großen Problemfelder liegen und welche Opportunitätskosten durch mangelhafte Nutzerorien- tierung entstehen. (Ruprecht, 2005 S. 9 - 10)
2.5 Die Nutzerorientierung beim trägerübergreifenden per- sönlichen Budget
„Die Grundidee Persönlicher Budgets lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: Menschen mit Behinderung erhalten einen bedarfsbezogenen Geldbetrag, mit dem sie selbst die für sie er- forderlichen Unterstützungsleistungen auswählen und diese finanzieren. Intendiert ist mit diesem Ansatz, Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume für ihr Alltagsleben auszuweiten sowie ihre sozialen Teilhabechancen zu erhöhen.“ (Kastl, et al., 2005 S. 13)
Der Abschlussbericht des Modellprojektes in Baden-Württemberg leitet aus der obi- gen Definition folgende Implikationen ab:
- Persönliche Budgets sind eine Form von Geldleistungen.
- Das Budget hat einen Aspekt der Planung bzw. der Planbarkeit. Budget heißt in der Verwaltung, dass Geld für ein Haushaltsjahr (Ein- und Ausgaben) ein- geplant/verplant ist.
- Das persönliche Budget ist auf den individuellen Bedarf zugeschnitten und muss die festgestellten Bedarfslagen abdecken.
- Das persönliche Budget soll den Menschen mit Behinderung Dispositionsspiel- räume zur Verfügung stellen. Dazu gehört die sachliche Disposition (Wer? Was?), soziale Disposition (Wer?) und die zeitliche Disposition (Wann? Wie oft?)
(Kastl, et al., 2005 S. 13 - 14)
Die obigen Kriterien können als Definition der Nutzerorientierung angesehen werden, da sie ganz neutral formuliert sind. Windisch stellt beim TPB die folgenden Kriterien und detaillierte Bedingungen für eine umfangreiche Nutzerorientierung auf:
- Finanzielle Deckung des individuellen Pflege- und Hilfebedarfs,
- Sicherstellung der Teilhabe an gemeindeintegrierten Lebensformen in der ge- wünschten Wohnform,
- Beratung und Unterstützung bei der Budgetberatung, -beantragung und
-verwaltung bei der Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs,
- Erstellen eines individuellen Hilfeplans unter Berücksichtigung der individuel- len Ressourcen,
- Begleitung und Sicherstellung bei der Umsetzung durch neutrale Instanzen (Budgetassistenz),
- Wirksame Partizipation des Betroffenen bei der Festlegung budgetfähiger Leis- tungen,
- Fortbildung und Schulung der Budgetnutzer im Umgang mit dem persönlichen Budget und den angebotenen Dienstleistungen, Förderung des Erfahrungsaus- tausches,
- Entscheidungskompetenz des Budgetnutzers über die Inanspruchnahme und Gestaltung der Leistungen,
- Errichtung einer unabhängigen Beratungs- und Unterstützungsstruktur für Nut- zer des PBs,
- Kontrolle des Budgetnutzers über die Leistung,
- Entscheidungskompetenz und Wahloption beim Abschluss von Verträgen mit Leistungsanbietern,
- Einhaltung von gesetzlichen Mindestlöhnen und Tarifen bei den Dienstleistun- gen. Kein Einsatz von „Schwarzmarktdienstleistungen“ aus ökonomischen Gründen,
- Variable Nutzung des Budgets über einen größeren Zeitraum („Ansparmög- lichkeit überschüssiger Budgetmittel“).
(Windisch, 2006 S. 111 - 112)
Der Abschlussbericht formuliert eine Reihe von Festlegungen bezüglich der Gestal- tung des Verwaltungsverfahrens, welche speziell auf Nutzer orientiert sind:
- Eine auf den Einzelfall abgestimmte Bedarfsfeststellung,
- Partizipation der Leistungsberechtigten,
- zügige Antragsbearbeitung,
- kooperative Leistungsbewilligung und –gestaltung. (Meyer, et al., 2007 S. 121)
Die Inanspruchnahme eines PBs stellt aber auch neue Anforderungen an Leistungserb- ringer und an die ambulante Versorgungsstruktur:
- Differenzierte Dienstleistungsangebote mit der Möglichkeit der Wahl be- stimmter Leistungselemente („Warenhauskatalog“),
- Orientierung der Angebote an den Bedürfnissen und Wünsche der Nutzer (in- dividuelle Leistungspakete),
- Dienstleistungen durch professionelle Leistungserbringer. (Windisch, 2006 S. 112 - 113)
3 Entwicklung, Rechtliche Grundlagen und verwal- tungsrelevante Fragestellungen
3.1 Grundlagen des Persönlichen Budgets
Wie schon Franz Müntefering (s. S. 6) in seiner Rede im September 2007 erwähnte, soll die Einführung des TPBs einen Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik ein- leiten. Die Einführung des Persönlichen Budgets gilt als neue Form der Leistungser- bringung, als Ausdruck sozialpolitischer Reformbemühungen und eines grundlegen- den Richtungswechsels in der Behindertenpolitik. Der Leistungsberechtigte soll nicht länger als Objekt staatlicher Fürsorge (mit standardisierten Leistungen) versorgt wer- den. Sondern vielmehr wird ein neuer Kurs verfolgt, der
- die Subjektstellung des Einzelnen fördert,
- eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht,
- die Eigenverantwortlichkeit für die Bewältigung von Lebenslagen unter-stützt,
- Risiken der Ausgrenzung mindert und
- die umfassende Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben der Ge- sellschaft verwirklichen soll.
(Meyer, et al., 2007 S. 25) Die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung der oben aufgeführten Forderungen der Politik wurden schon wesentlich früher geschaffen. Be- reits im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) wurde im § 101a die Experimentierklausel eingeführt. (Koehler, 2008) Grundlage war hier die Pauschalierung von Sozialhilfe- leistungen. In diesem Kontext wird der Begriff „Persönliches Budget“ nicht erwähnt. Das BSHG wurde durch das Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) am 01.01.2005 abgelöst. (Beck-Texte, 2008 S. 1438) Persönliche Budgets wurden im deutschen Sozialrecht erstmals seit der Einführung des Sozialgesetzbuches IX „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ vom 19. Juni 2001 festgelegt. Im Speziellen geschieht dies im § 17 dieses Gesetzes. Die Bestimmungen zum PB wurden bis 2005 zweimal geändert. Einmal durch das „Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetz- buch“ vom 27.12.2003 (u.a. Eigenverantwortung des Budgetnehmers wird stärker be- tont, es wird explizit der Gedanke eines „trägerübergreifenden Budgets“ eingeführt, Bestimmungen zur Durchführung von Modellprojekten). (Bundesgesetzblatt, 2008) Und durch das „Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im Sozialrecht (Verwaltungsvereinfachungsgesetz)“ vom 21.3.2005 (u.a. einbeziehen von medizini- schen und pflegerischen Leistungen auf alltägliche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe). (Bundesgesetzblatt, 2008) Die Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI - Soziale Pflegeversicherung) nehmen im Rahmen des TPBs eine Sonderrolle ein. Die Möglichkeit, eine Geldleistung zu erhalten, wird eingeschränkt. Pflegebedürftige kön- nen nach § 35a SGB XI Pflegeleistungen zwar auch als Teil eines trägerübergreifen- den Budgets erhalten. Bei der Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI ist aber nur das anteilige Pflegegeld als Geldleistung budgetfähig. Sachleistungen dürfen nur in Form von Gutscheinen ausgestellt werden und es ist die Inanspruchnahme von zuge- lassenen Pflegeeinrichtungen verpflichtend. Die Gutscheinlösung schränkt die Spiel- räume der Budgetnehmer erheblich ein, da die Gutscheine z.B. nicht für integrierte Assistenzlösungen im sog. Arbeitgebermodell Anwendung finden können. (Meyer, et al., 2007 S. 33)
Ferner erließ die Bundesregierung am 27.5.2004 eine weitere Rechtsverordnung zum Persönlichen Budget („Verordnung zur Durchführung des § 17 Abs. 2-4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Budgetverordnung“), welche die Kooperation und Koordi- nation ggf. mehrerer beteiligter Leistungsträger („trägerübergreifend“) regelt. Vorge- sehen sind dabei u.a. ein trägerübergreifendes Bedarfsfeststellungsverfahren sowie der verbindliche Abschluss von Zielvereinbarungen. (Budgetverordnung, 2004) Die Bud- getverordnung soll die Koordination und Kooperation der Leistungsträger regeln. Die- se Regelung zeigt ein Grundproblem des deutschen Rehabilitationsrechts auf. In Deutschland besteht, im Gegensatz z. B. zu den Niederlanden, keine einheitliche Zu- ständigkeit für Rehabilitation. Die Leistungen gliedern sich auf in eine Vielzahl von Zuständigkeiten. Diese folgen zusätzlich noch den unterschiedlichsten sozialstaatli- chen Prinzipien. Dem Fürsorgeprinzip, dem Versicherungsprinzip und dem Entschädi- gungsprinzip. Sie sind also auch unterschiedlichen sozialen Sicherungssystemen zu- geordnet. Die daraus resultierenden Probleme stellen sich daher vor allem:
- bei der Feststellung der Zuständigkeit und
- beim Ineinandergreifen rehabilitativer Maßnahmen im Zeitablauf (z.B. bei der Abstimmung medizinischer, beruflicher und sozialer Rehabilitation) bei paral- lelen Zuständigkeiten.
Angesprochen sind zunächst die in § 6 SGB IX als Rehabilitationsträger definier- ten Leistungsträger. Im Einzelnen sind dies:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Verankerung des Persönlichen Budgets in den einzelnen Leistungsgesetzen (Kastl, et al., 2005 S. 24)
Ergänzungen zur Tabelle 1 (s. S 16):
Zu 1: Die Bundesagentur für Arbeit hat die Aufgabe, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und zu verkürzen und eine besondere Verantwortung für behinderte Menschen, die im SGB III §§ 97 ff. formuliert ist.
„Behinderten Menschen können Leistungen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben er- bracht werden, die wegen Art und Schwere der Behinderung erforderlich sind, um ihre Erwerbs- fähigkeit zu erhalten, zu bessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Ar- beitsleben zu sichern.“ (Beck-Texte, 2008 S. 121)
Zu 2: Bei der gesetzlichen Krankenversicherung steht die Rehabilitation im Zusam- menhang mit dem Ziel der Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung des Ge- sundheitszustandes, welches über eine Krankheits- und Akutbehandlung hinausgeht. (Beck-Texte, 2008 S. 364)
Zu 3: Die gesetzliche Rentenversicherung hat die rehabilitative Aufgaben der Vermei- dung von Invalidität, der (Wieder-)Herstellung von Erwerbsfähigkeit nach dem Grundsatz „Rehabilitation vor Rente“. (Beck-Texte, 2008 S. 718)
Zu 4: Nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder bei Berufskrankheiten soll die gesetzliche Unfallversicherung eine möglichst vollständige „Wiederherstellung“ der Gesundheit und körperlichen Leistungsfähigkeit anstreben. Dabei steht das Entschädigungsprinzip im Vordergrund. (Beck-Texte, 2008 S. 1017 - 1018)
Zu 5: Über ihre Leistungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche im Rah- men des § 35a ff. SGB VIII haben die Träger der Kinder- und Jugendhilfe zu ent- scheiden. (Beck-Texte, 2008 S. 1150 - 1151)
Zu 6: Die Pflegeversicherung hat die Aufgabe, Pflegebedürftigen trotz ihres Hilfebe- darfs zu einem möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Leben zu verhelfen (§ 2 Abs.1 SGB XI). (Beck-Texte, 2008 S. 1354)
Zu 7: die Träger der Sozialhilfe sind für die Eingliederungshilfe zuständig. Diese ist formuliert in § 53 Abs. 3 SGB XII:
„Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Be- hinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern“. (Beck-Texte, 2008 S. 1461)
Zu 8: Bei dem Träger der Kriegsopferversorgung/Kriegsopferfürsorge geht es um Leistungen, die im Zusammenhang mit Verpflichtungen gegenüber dem Staat entstan- denen Schädigungen und Behinderungen erforderlich werden. Als Grundlage gilt das Bundesversorgungsgesetz (BVG), welches umfassende Rehabilitationsleistungen ein- schließlich Leistungen zur beruflichen Rehabilitation enthält. (Bundesministerium der Justiz, 2008)
Zu 9: Integrationsämter haben insbesondere als Träger der begleitenden Hilfe im Ar- beitsleben rehabilitative Funktionen. Die Hilfe „soll dahin wirken, dass die schwerbe- hinderten Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht absinken, auf Arbeitsplätzen be- schäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln können …“. (Beck-Texte, 2008 S. 1256)
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das trägerübergreifende persönliche Budget (TPB)?
Es ist eine Leistung für Menschen mit Behinderung, die es ermöglicht, Hilfen selbst einzukaufen, anstatt Sachleistungen zu empfangen.
Seit wann besteht ein Rechtsanspruch auf das persönliche Budget?
Nach einer Erprobungsphase in Modellprojekten besteht seit dem 1. Januar 2008 ein bundesweiter Rechtsanspruch.
Was bedeutet „Nutzerorientierung“ in diesem Kontext?
Nutzerorientierung bedeutet, dass der behinderte Mensch als „Kunde“ oder „Arbeitgeber“ selbst entscheidet, wann, wie und durch wen Leistungen erbracht werden.
Welche Rolle spielt das Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)?
Das SGB IX bildet die rechtliche Grundlage für die Teilhabe behinderter Menschen und die Ausgestaltung des persönlichen Budgets.
Was sind die Vorteile des persönlichen Budgets für Betroffene?
Vorteile sind eine höhere Autonomie, die Stärkung der Selbstbestimmung und eine passgenaue, individuelle Unterstützung.
- Quote paper
- Peter Schädler (Author), 2008, Das trägerübergreifende persönliche Budget im Sozialgesetzbuch IX unter dem Aspekt der Nutzerorientierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122679