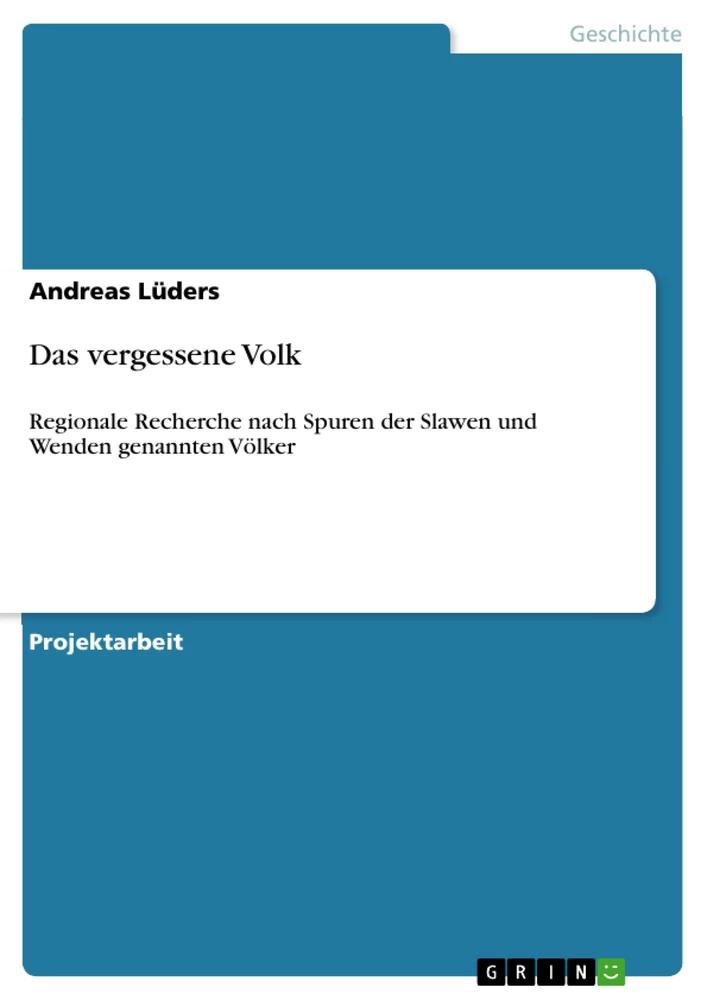Mit der Wende 1989 und der beständigen Erweiterung der Europäischen Union hat sich ein wenig erforschter Geschichtsraum geöffnet, der durch aufsehen erregende Funde unsere kulturhistorischen Erkenntnisse verändert. Die inzwischen weltweit bekannte Himmelsscheibe von Nebra und weitere archäologische Funde mit astronomischen Bezügen belegen die Existenz einer sehr viel älteren Kulturlandschaft, als bisher angenommen. Aber auch die Zeit der großen Wende vor etwa 1000 Jahren, die Zeit der Christianisierung der Slawen und Wenden genannten Völker zwischen Elbe und Oder, wird durch immer neue archäologische Befunde aus dem Vergessen gerückt.
Anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung des märkischen Ortes Eggersdorf, der an der Grenze zwischen niederem und hohem Barnim gelegen ist, entstand bei der regionalen Recherche nach Spuren der Slawen und Wenden genannten Völker die Frage, wie es zu dieser radikalen Auslöschung der Erinnerung an ein gesamtes Volk kommen konnte. Der Verein „Bauernvolk Eggersdorf e.V.“ hat der Spurensuche ein Projekt gewidmet und mit einer Ausstellung über „Das vergessene Volk“ im Januar 2008 die Vorträge zum 675ten Jubiläum der Ersterwähnung eröffnet.
Eggersdorf wurde 1333 erstmals urkundlich erwähnt, als Markgraf Ludwig der Ältere den Ort an Johannes Trebus aus Strausberg verkaufte. Als der Ort somit seine erste urkundliche Erwähnung fand, hatte er freilich schon eine lange Besiedlungsgeschichte hinter sich. Über die Menschen und die Lebensumstände dieser Vorgeschichte ist wenig bekannt. Dennoch öffnet sich beim näheren Hinsehen der Blick auf eine vielfältige Geschichte mit äußerst nachhaltigen Folgen, die heute noch ihre Auswirkungen zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Giertz-Chronik
- 3. Der Gamengrund
- 4. Der Blumenthal – eine wendische Stadt?
- 5. Das Königsgrab an der Gielsdorfer Mühle
- 6. Burgwall Spitzmühle
- 7. Geheimnis im Jagen 57
- 8. Die Posentsche
- 9. Die Macht der Steine
- 10. Slawen oder Wenden?
- 11. Heveller, Sprewanen, Liutizen…
- 12. Der große Aufstand 983
- 13. Wendische Blütezeit
- 14. Der Untergang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Spuren der slawisch-wendischen Bevölkerung im Raum Eggersdorf anlässlich des 675-jährigen Jubiläums des Ortes. Die regionale Recherche zielt darauf ab, die nahezu vollständige Auslöschung der Erinnerung an dieses Volk zu beleuchten und die erhaltenen kulturellen und archäologischen Zeugnisse zu analysieren.
- Archäologische Funde und ihre Bedeutung für das Verständnis der wendischen Kultur
- Die Rolle der Giertz-Chronik und anderer Quellen für die regionale Geschichtsforschung
- Die politischen und religiösen Konflikte zwischen den Wenden und den christlichen Eroberern
- Die Lebensweise und die kulturellen Praktiken der wendischen Bevölkerung
- Die sprachliche und identitäre Entwicklung der wendischen Bevölkerung bis in die Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der Forschung und die Motivation des Projekts, die Auslöschung der Erinnerung an das wendische Volk zu untersuchen. Kapitel 2 (Die Giertz-Chronik): Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Giertz-Chronik als Quelle für die regionale Spurensuche und ihren Grenzen. Kapitel 3 (Der Gamengrund): Hier wird der Gamengrund als wendischer Siedlungsraum beschrieben, inklusive der Bedeutung des Flusses und der Wassermühle. Kapitel 4 (Der Blumenthal – eine wendische Stadt?): Dieses Kapitel analysiert die historischen Berichte über Blumenthal und die Möglichkeit einer größeren wendischen Siedlung an diesem Ort. Kapitel 5 (Das Königsgrab an der Gielsdorfer Mühle): Das Kapitel behandelt die Sage um ein Königsgrab und archäologische Funde in der Nähe. Kapitel 6 (Burgwall Spitzmühle): Hier wird eine größere Anlage, der Burgwall Spitzmühle, untersucht und ihre mögliche Funktion als Verteidigungsanlage diskutiert. Kapitel 7 (Geheimnis im Jagen 57): Der gut erhaltene Ringwall im Jagen 57 wird beschrieben, mit der Hypothese einer möglichen astronomischen Kultstätte. Kapitel 8 (Die Posentsche): Eine eingeebnete Anlage, die Posentsche, wird im Hinblick auf ihre slawische Bedeutung beleuchtet. Kapitel 9 (Die Macht der Steine): Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Findlingen und einem Sühnekreuz in der Nähe der Eggersdorfer Kirche im Kontext des wendischen Glaubens. Kapitel 10 (Slawen oder Wenden?): Hier wird die sprachliche und historische Problematik der Begriffe "Slawen" und "Wenden" diskutiert. Kapitel 11 (Heveller, Sprewanen, Liutizen…): Eine Übersicht über die verschiedenen westslawischen Stämme und ihre Rolle im historischen Kontext. Kapitel 12 (Der große Aufstand 983): Das Kapitel beschreibt den Aufstand der Wenden im Jahr 983 als Reaktion auf die Christianisierung.
Schlüsselwörter
Wenden, Slawen, Eggersdorf, Barnim, Archäologie, Giertz-Chronik, Christianisierung, Liutizen, Ringwall, Kultstätte, Sprachverlust, kulturelle Identität.
Häufig gestellte Fragen
Wer war das „vergessene Volk“ der Wenden?
Die Wenden (oder Slawen) waren Völker, die zwischen Elbe und Oder siedelten. Ihre Kultur und Geschichte gerieten nach der Christianisierung und Eroberung durch deutsche Markgrafen weitgehend in Vergessenheit.
Was geschah beim großen Wendenaufstand von 983?
Der Aufstand war eine massive Reaktion der wendischen Stämme gegen die christliche Missionierung und deutsche Herrschaft, die die Christianisierung in diesem Raum für über 150 Jahre stoppte.
Welche archäologischen Spuren gibt es im Raum Eggersdorf?
Es finden sich Überreste wie der Burgwall Spitzmühle, ein Ringwall im Jagen 57 und Sagen über Königsgräber, die auf eine lange slawisch-wendische Besiedlung hinweisen.
Was ist die Giertz-Chronik?
Die Giertz-Chronik ist eine wichtige regionale historische Quelle für den Barnim, die zur Spurensuche nach der wendischen Vergangenheit genutzt wird, aber auch ihre Grenzen hat.
Hatten die Wenden astronomische Kenntnisse?
Archäologische Befunde an Kultstätten wie dem Ringwall im Jagen 57 legen nahe, dass die wendische Kultur astronomische Bezüge in ihren religiösen Anlagen nutzte.
- Quote paper
- Andreas Lüders (Author), 2008, Das vergessene Volk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122685