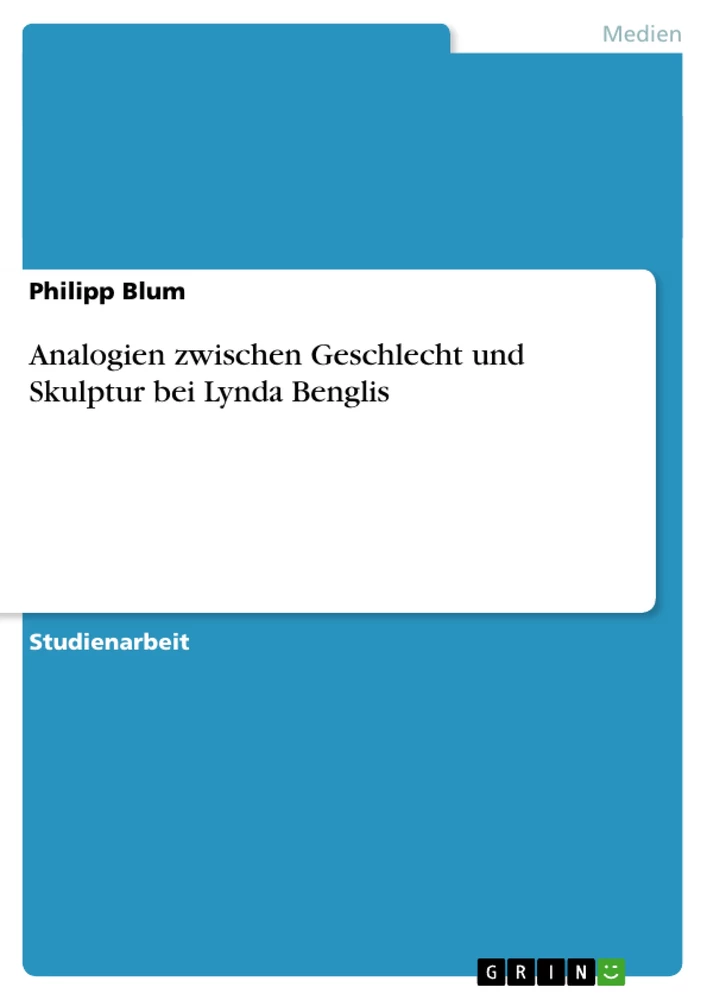In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit den Wechselwirkungen zwischen theoretischer Kunstreflexion und praktischer Kunstausübung am Beispiel von Lynda Benglis
„Polyurethanskulpturen“ 1 und einigen Vorformen dieser auseinandersetzen. Ausgangsthese dieser Arbeit ist, dass sich Bedeutung in der gegenwärtigen Kunst in erster Linie über einen reflexiven, theoretischen Zugang erschließen lässt, weswegen ein naives Betrachten von Kunst heute - solange es an dem Erkennen objektiver Bedeutung orientiert ist - scheitern muss, da solche Prozesse einer Bedeutungskonstruktion, die auf eine Eindeutigkeit - ferner einen sinnfälligen Appell an eine außerästhetische Wirklichkeit des Kunstwerks - der Bedeutung abzielen, nicht länger aktuell sind. Schon der Versuch einer unfassenden Einordnung der Kunst nach 1960, die oft mit dem Begriff postmodern etikettiert wird, zeigt die Schwierigkeiten auf, die der Umgang mit „postmoderner Kunst“ bereitet. Beschreibt der Begriff „postmodern“ doch in erster Linie eine geistesgeschichtliche Strömung soziologischer und philosophischer Provenienz, die erst sekundär über die Semiotik zum Mittel der Kunstreflexion geworden ist. Um Missverständnisse auszuräumen: Es wird hier kein Zweifel an der Charakterisierung einer Kunst als postmodern geäußert; im Gegenteil, eine solche Charakterisierung wird hier ausdrücklich bejaht: einerseits, weil nicht nur die postmoderne Geisteshaltung, sondern auch die Kunst nach 1960 im Allgemeinen wie auch das Werk Benglis’ im Speziellen das Festhalten an Eindeutigkeiten negiert; andererseits, weil eine solche Zuschreibung die Verschränkung theoretischer Perspektiven mit Kunstwerken und deren Wechselwirkungen vorführt.
Während das gewohnte Bild einer Kunstepoche neben einer geistes- und/oder gesellschaftsgeschichtlichen Strömung (es gibt keine barocke Philosophie, wohl aber eine Philosophie im Zeitalter des Barock) bis zu den zahlreichen Ismen der klassischen Avantgarden bestand hatte, die ihrerseits meist mit eigenem theoretischen Manifest aufwarteten, zeigt sich für die darauf folgende Kunst häufig eine Tendenz zur Verbundenheit von allgemein theoretisch philosophischen Strömungen und den eigentlichen Kunstobjekten
wie es eben in der Phrase von der postmodernen Kunst 2 zum Ausdruck kommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neue Kunst und neues Denken – Was ist „Postmoderne Kunst“?
- Zwischen Beliebigkeit und Pluralität - Postmoderne oder postmodern
- Zwischen Skulptur und Malerei - Lynda Benglis
- Reflexionen des Materials - Farbe und Polyuritan
- Erschüttung der Form als Erschütterung der Form
- Sex/Genderaspekte in Benglis Kunst
- Kunstform Frau – Benglis und Feminismus
- Theoretischer Zugang: Dekonstruktion nach Judith Butler
- Die Macht des Diskurses - Foucaults Einfluss auf Butler
- Dekonstruktion des Geschlechts nach Judith Butler
- Analogien zwischen Geschlecht und Skulptur bei Benglis und Butler
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Wechselwirkungen zwischen theoretischer Kunstreflexion und der praktischen Arbeit von Lynda Benglis, insbesondere ihrer Polyurethanskulpturen. Die Arbeit argumentiert, dass die Bedeutung gegenwärtiger Kunst primär über einen reflexiven, theoretischen Zugang erschlossen werden kann. Sie analysiert die Schwierigkeiten, die mit der Einordnung von Kunst nach 1960 (oft als „postmodern“ bezeichnet) verbunden sind. Die Arbeit konzentriert sich auf die Verbindung zwischen theoretisch-philosophischen Strömungen und Kunstwerken, wobei der Begriff „Postmoderne“ kritisch beleuchtet wird.
- Die Problematik der Definition und Anwendung des Begriffs „Postmoderne“ in der Kunst
- Die Kunst von Lynda Benglis und ihre Polyurethanskulpturen
- Der Einfluss von Gender Studies und Judith Butlers Dekonstruktionstheorie auf die Kunstinterpretation
- Analogien zwischen Geschlecht und Skulptur im Werk von Lynda Benglis
- Die Bedeutungskonstruktion in der gegenwärtigen Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und benennt die zentrale Fragestellung: die Wechselwirkung zwischen theoretischer Kunstreflexion und der künstlerischen Praxis am Beispiel von Lynda Benglis' Polyurethanskulpturen. Es wird die These aufgestellt, dass die Bedeutung gegenwärtiger Kunst primär durch einen reflexiven, theoretischen Zugang erschlossen werden kann und dass ein naives Betrachten aufgrund der komplexen Bedeutungskonstruktion scheitern muss. Die Arbeit kündigt den Fokus auf den Begriff „Postmoderne“ und dessen Anwendung auf die Kunst nach 1960 an, wobei betont wird, dass es sich um eine mögliche Betrachtung unter vielen handelt und nicht um eine umfassende Analyse der gesamten zeitgenössischen Kunst.
Neue Kunst und neues Denken - Was ist „Postmoderne Kunst“?: Dieses Kapitel befasst sich mit der problematischen Verwendung des Begriffs „Postmoderne“ in der Kunstgeschichte. Es wird zwischen einem diffusen und einem präzisen Verständnis von Postmoderne unterschieden, wobei der diffuse Postmodernismus als unscharf und beliebig angewendet kritisiert wird. Der Fokus liegt auf der Klärung des Begriffs und seiner Anwendbarkeit auf die Kunst nach 1960, unter Berücksichtigung der Pluralität von Bedeutungen und dem Verschwinden klarer Grenzen zwischen Realität und Virtualität. Welsch's Definition von Postmoderne als Verfassung radikaler Pluralität wird als Grundlage der Analyse verwendet.
Zwischen Skulptur und Malerei - Lynda Benglis: Dieses Kapitel präsentiert Lynda Benglis' Werk und ihre Polyurethanskulpturen. Es analysiert die Materialität (Farbe, Polyurethan) und die „Erschütterung der Form“ in Benglis' Kunst, wobei der Fokus auf den Sex/Gender-Aspekten und der Frage nach einer „Kunstform Frau“ liegt. Die Kapitel unterstreichen Benglis' Beitrag zum Feminismus und untersuchen ihre künstlerischen Verfahren im Kontext der Postmoderne. Die einzelnen Unterkapitel untersuchen die Materialität, die Formgebung und den Bezug zum Feminismus und Gender.
Theoretischer Zugang: Dekonstruktion nach Judith Butler: Dieses Kapitel entwickelt einen theoretischen Zugang zu Benglis' Kunst anhand der Dekonstruktionstheorie von Judith Butler. Es untersucht Butlers Bezug auf Foucault und deren Theorie der Geschlechterdekonstruktion. Der zentrale Punkt ist die Erarbeitung von Analogien zwischen Butlers Dekonstruktion des Geschlechts und der „Erschütterung der Form“ in Benglis' Skulpturen. Die Kapitel analysieren den Einfluss von Foucaults Diskursanalyse und Butlers Konzept der Performativität des Geschlechts auf die Interpretation von Benglis’ Werken.
Schlüsselwörter
Lynda Benglis, Postmoderne Kunst, Polyurethanskulptur, Gender Studies, Judith Butler, Dekonstruktion, Bedeutungskonstruktion, Pluralität, Form, Materialität, Feminismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Lynda Benglis und die Postmoderne
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Wechselwirkungen zwischen theoretischer Kunstreflexion und der praktischen Arbeit von Lynda Benglis, insbesondere ihrer Polyurethanskulpturen. Es wird analysiert, wie ein reflexiver, theoretischer Zugang notwendig ist, um die Bedeutung gegenwärtiger Kunst, im Speziellen der Kunst nach 1960, zu erschließen. Ein Fokus liegt auf der Verbindung zwischen theoretisch-philosophischen Strömungen und Kunstwerken, sowie einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff „Postmoderne“.
Welche Künstlerin steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die amerikanische Künstlerin Lynda Benglis und ihre Polyurethanskulpturen. Ihre Kunstwerke dienen als Fallbeispiel für die Analyse der komplexen Bedeutungskonstruktion in der gegenwärtigen Kunst.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Hausarbeit nutzt die Dekonstruktionstheorie von Judith Butler, insbesondere deren Bezug auf Michel Foucault und das Konzept der Performativität des Geschlechts. Diese Theorie wird angewendet, um Analogien zwischen Butlers Geschlechterdekonstruktion und der „Erschütterung der Form“ in Benglis' Skulpturen aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt der Begriff „Postmoderne“?
Die Hausarbeit befasst sich kritisch mit dem Begriff „Postmoderne“ und seiner Anwendung auf Kunst nach 1960. Es wird zwischen einem diffusen und einem präzisen Verständnis von Postmoderne unterschieden, wobei die Problematik einer klaren Definition und Anwendung im Kontext der Kunst diskutiert wird. Der Fokus liegt auf der Pluralität von Bedeutungen und dem Verschwinden klarer Grenzen zwischen Realität und Virtualität.
Welche Aspekte von Benglis' Kunst werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Materialität (Farbe, Polyurethan), die „Erschütterung der Form“, die Sex/Gender-Aspekte in Benglis’ Kunst und die Frage nach einer „Kunstform Frau“. Der Beitrag Benglis’ zum Feminismus wird ebenfalls untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist gegliedert in eine Einleitung, ein Kapitel über den Begriff „Postmoderne Kunst“, ein Kapitel über Lynda Benglis und ihre Kunst, ein Kapitel über den theoretischen Zugang mittels Butlers Dekonstruktionstheorie und ein Fazit. Jedes Kapitel enthält Unterkapitel, die die einzelnen Aspekte vertiefen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Lynda Benglis, Postmoderne Kunst, Polyurethanskulptur, Gender Studies, Judith Butler, Dekonstruktion, Bedeutungskonstruktion, Pluralität, Form, Materialität, Feminismus.
Was ist die zentrale These der Hausarbeit?
Die zentrale These ist, dass die Bedeutung gegenwärtiger Kunst primär durch einen reflexiven, theoretischen Zugang erschlossen werden kann und dass ein naives Betrachten aufgrund der komplexen Bedeutungskonstruktion scheitern muss. Die Bedeutung von Kunstwerken, wie den Skulpturen von Benglis, wird nicht allein durch ihre Form oder Materialität bestimmt, sondern auch durch ihre Einbettung in einen komplexen kulturellen und theoretischen Kontext.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Philipp Blum (Autor:in), 2007, Analogien zwischen Geschlecht und Skulptur bei Lynda Benglis, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122687