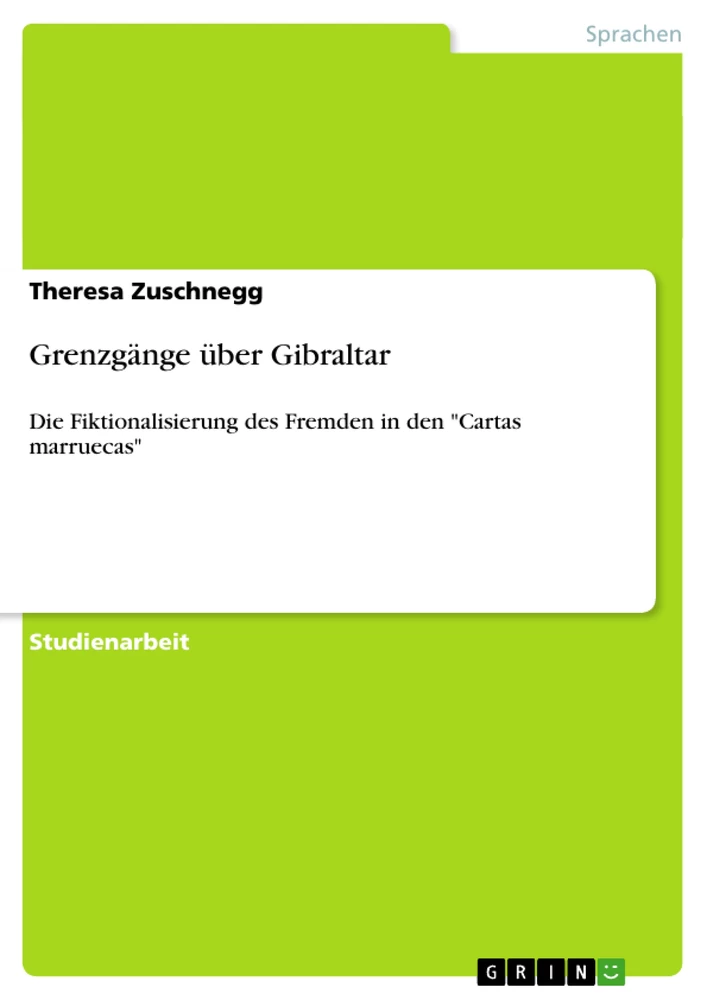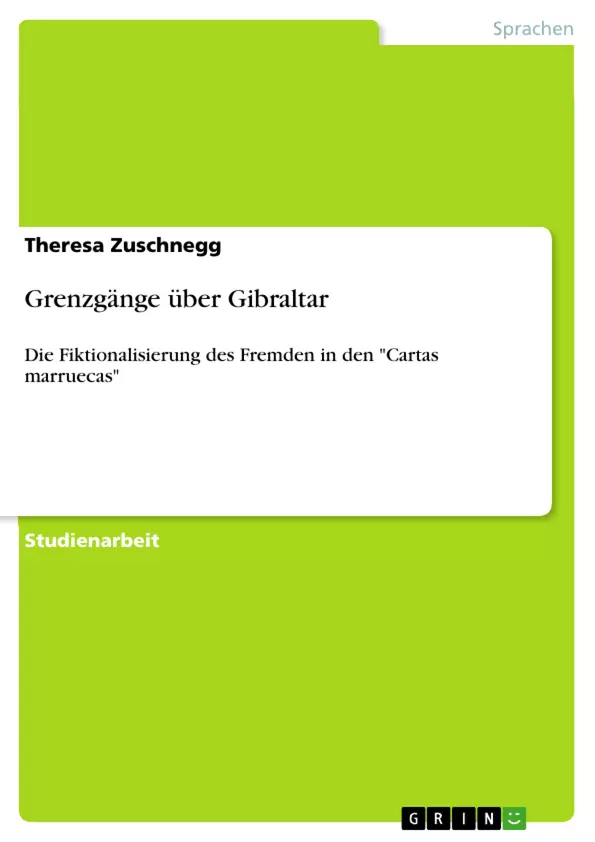Im 18. Jahrhundert wurde der spanische Nation, die einst zu den größten Europas gehörte, immer deutlicher bewusst, dass sie eine Außenseiterposition innerhalb des Okzidents eingenommen hatte. Spanien befand sich in einer Stagnation, durch die es nur durch ein Umdenken herauszuführen war. Ein Umdenken, das in ganz Europa zwar in einer viel radikaleren Form umgesetzt wurde als auf der iberischen Halbinsel, das aber trotzdem maßgebend für eine neue Positionierung Spaniens verantwortlich war. So setzte sich auch José Cadalso y Vázquez für ein fortschrittliches Spanien ein, das aber nach wie vor seine ganz spezielle Mentalität wahren sollte – ein Seiltanz zwischen Traditionalismus und französischem Gedankengut. In seinem Werk Cartas marruecas versuchte er seine Landsleute aus einem Jahrhundertschlaf wachzurütteln und griff wie sein französischer Vorgänger, Charles de Secondat Montesquieu, in dieser neuen literarischen Gattung zu einem bisher unbekannten rhetorischen Mittel: Das Fremde als Kritikerinstanz.
In der Epoche der Aufklärung begann man sich ernsthaft mit fremden Kulturen in der Literatur auseinanderzusetzen. Dem Fremden wurde erstmals das Fantastische und Irreale genommen und man versuchte nach dem Hervorkommen der Empirie wissenschaftlich an die Kulturforschung heranzugehen und sie kritisch zu beobachten.
Das Fremde, das zum Spiegel des Eigenen wird, soll im Folgenden behandelt werden. Was macht die Faszination am Fremden aus und inwiefern wird deren Einzug in die Literatur als rhetorisches Mittel gehalten? Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Umsetzung in der Sprache gelegt.
Welche Stereotypen sind enthalten und was bewirken sie beim Leser? Was will Cadalso bewirken? Wo wird die Autorenintention besonders sichtbar? Neben diesen Fragestellungen soll auch die Dichotomie des Fremden behandelt werden.
Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass sich die Arbeit bei vielen Punkten auf Theorien des Postkolonialismus und der Systemtheorie stützt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Fremde
- Definition des Fremden
- Die Rolle des Fremden in der Identitätsbildung oder das Eigene
- Das Fremde in der Aufklärung
- Leseverständnis fremder Texte
- Erzähltheoretische Rahmung der Cartas marruecas
- Ein didaktischer Briefroman
- Die Sprachrohrfunktion Gazels
- Cadalsos Versuch einer Irreführung
- El justo medio. Der Objektivitätsanspruch in den Cartas marruecas.
- Der fremde Blick
- Die Positionierung
- Transportierung des Fremden durch die Sprache
- Verwendung von Artikel und Demonstrativpronomen
- Personalpronomen und Possessivpronomen
- Sprachliche Darstellung der räumlichen Distanz
- Die Benennung des Fremden
- Schreibstil und Lexik
- Sprachlosigkeit des Fremden
- Stereotypen
- Versuch einer Definition
- Funktion der Stereotypen
- Die Stereotypen in den Cartas marruecas
- Montesquieus Klimatheorie
- Hybridität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung des Fremden in José Cadalsos "Cartas marruecas" im Kontext des 18. Jahrhunderts. Sie analysiert, wie Cadalso das Fremde als rhetorisches Mittel einsetzt, um seine Landsleute zum Umdenken anzuregen und Spanien aus einer Phase der Stagnation zu führen. Dabei werden die sprachlichen Mittel und die Wirkung von Stereotypen im Werk untersucht.
- Die Definition und Darstellung des Fremden in den "Cartas marruecas"
- Die Rolle des Fremden in der Identitätsbildung und Selbstreflexion Spaniens
- Die sprachliche Konstruktion des Fremden und die Verwendung von Stereotypen
- Der Einfluss von Montesquieu und die Aufklärungsideen im Werk
- Die erzähltheoretische Rahmung des Briefromans
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die historische Situation Spaniens im 18. Jahrhundert und die Bedeutung des Fremden in der Aufklärungsliteratur. Das Kapitel "Das Fremde" definiert den Begriff "fremd" und untersucht seine Rolle in der Identitätsbildung. Es beleuchtet auch die Bedeutung des Fremden in der Aufklärung. Das Kapitel zur erzähltheoretischen Rahmung der "Cartas marruecas" analysiert die Briefromanform und die Funktion der verschiedenen Charaktere. Das Kapitel "Der fremde Blick" befasst sich mit der sprachlichen Darstellung des Fremden, der Verwendung von Stereotypen und der Hybridität von Kulturen im Werk.
Schlüsselwörter
Cartas marruecas, José Cadalso, Fremdheit, Stereotypen, Aufklärung, Identitätsbildung, Briefroman, Sprache, Hybridität, Montesquieu, Spanien, Orientalismus, Okzident.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema von Cadalsos „Cartas marruecas“?
Das Werk nutzt den Blick eines Fremden (Gazel), um die spanische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts kritisch zu reflektieren und Reformen anzustoßen.
Wie wird „das Fremde“ als rhetorisches Mittel eingesetzt?
Der Fremde dient als objektive Kritikerinstanz, die den Landsleuten ihre eigenen Fehler und Traditionen wie in einem Spiegel vorhält.
Welche Rolle spielen Stereotypen im Werk?
Stereotypen werden genutzt, um nationale Identitäten zu definieren und gleichzeitig die Vorurteile der Aufklärungsepoche zu illustrieren.
Was bedeutet „El justo medio“ bei Cadalso?
Es beschreibt den Versuch einer objektiven Mitte zwischen blindem Traditionalismus und radikalem französischem Gedankengut.
Welchen Einfluss hatte Montesquieu auf dieses Werk?
Montesquieus „Persische Briefe“ dienten als literarisches Vorbild für die Form des Briefromans und die Nutzung der fremden Perspektive.
- Citation du texte
- Theresa Zuschnegg (Auteur), 2007, Grenzgänge über Gibraltar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122693