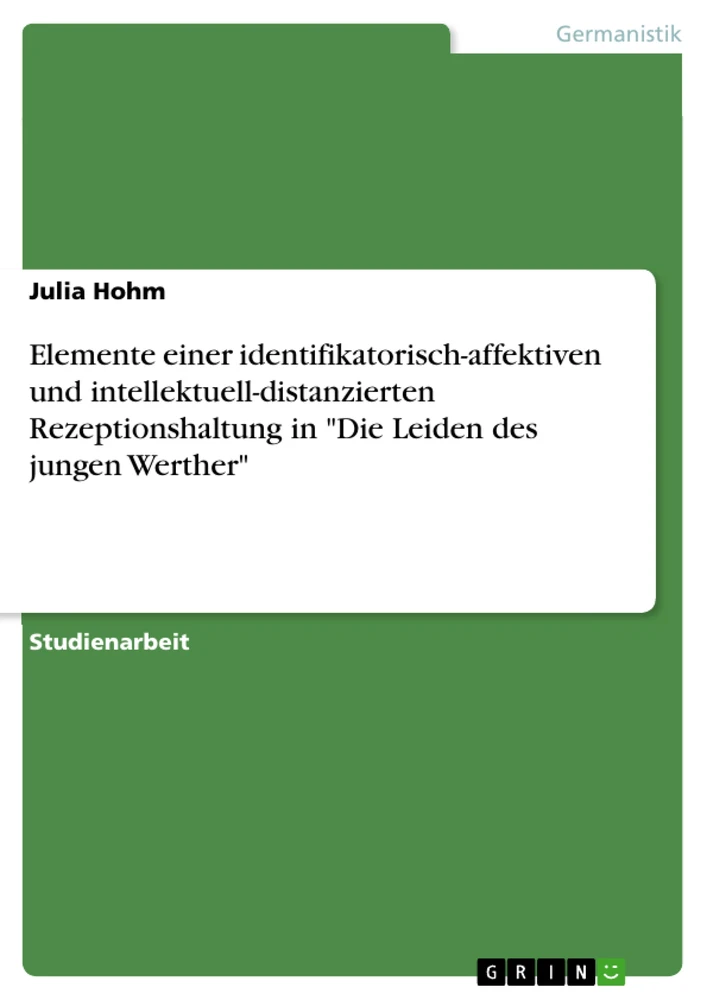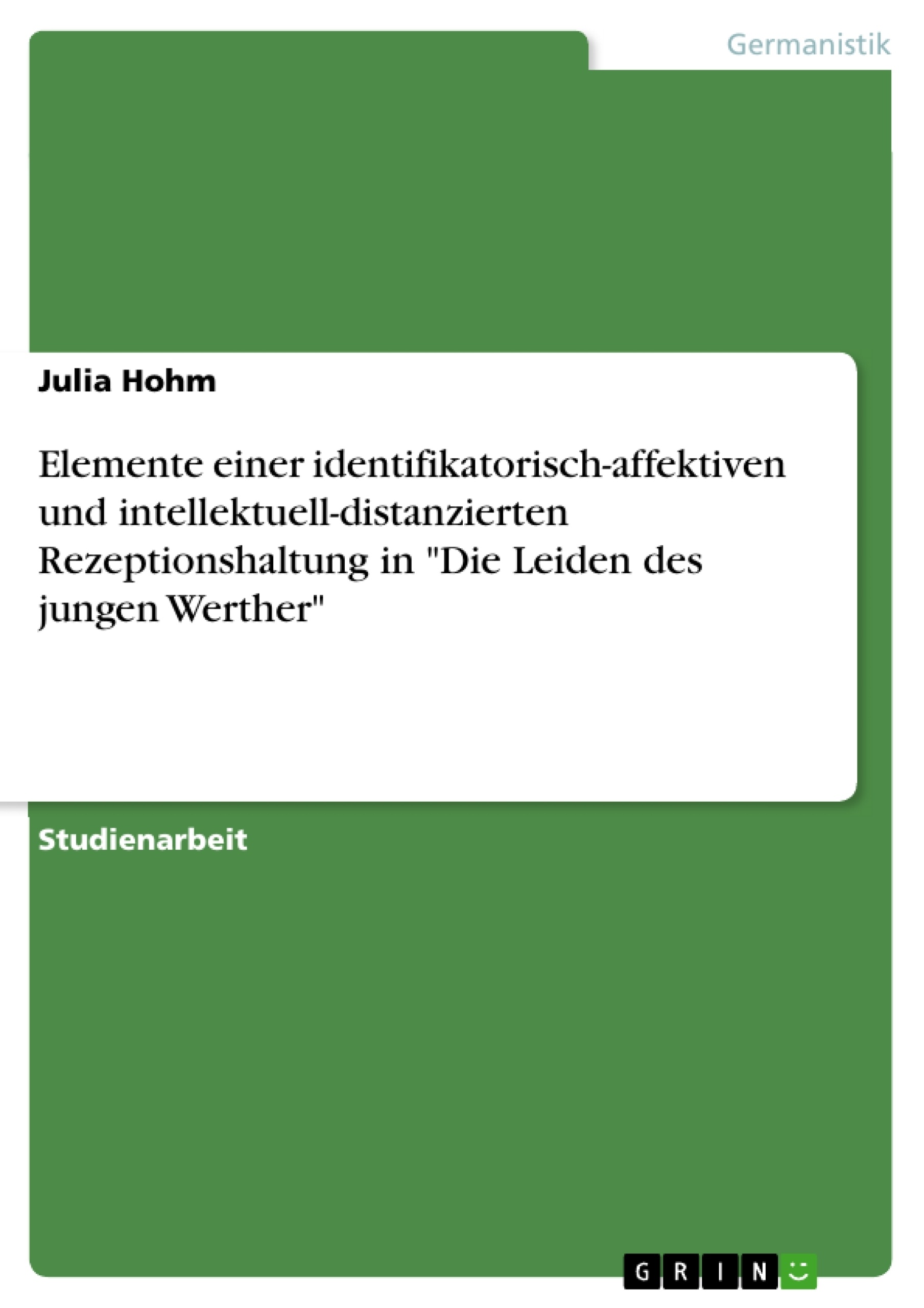Wie ist es zu erklären, dass Publikum und Autor in Bezug auf Die Leiden des jungen Werthers ein verschiedenartiges Verständnis des Romans hatten? Die Differenzen zwischen der empirisch belegten zeitgenössischen und der von Goethe erwarteten Rezeption können sich damit begründen lassen, dass es in diesem Text sowohl Signale gibt, die bei den Lesern eine identifikatorisch-affektive Rezeptionshaltung gefördert haben, aber auch Elemente, die eine eher intellektuell-distanzierte Lektürehaltung – wie sie im Sinne Goethes gewesen wäre – nahe gelegt hätten. Hinweise auf die unterschiedlichen Wirkungsintentionen sollen im Folgenden aufgezeigt und ihre Wirkung beim Leser erklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Elemente einer identifikatorisch-affektiven Rezeptionshaltung
- Anlegung als monologischer Briefroman
- Vorwort erster Teil
- Sprache und Satzbau Werthers
- Leseverhalten Werthers
- Neue Thematik und fehlende ästhetische Distanz
- Elemente einer intellektuell-distanzierten Rezeptionshaltung
- Vorwort zweiter Teil
- Entwurf eines Modells der distanzierten Identifikation in den ersten Briefen
- Herausgeber
- Leseverhalten Werthers
- Das Motiv der Krankheit
- Resümee und kurzer Ausblick auf die 2. Fassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rezeption von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ und analysiert die gegensätzlichen Wirkungsintentionen des Autors: eine identifikatorisch-affektive und eine intellektuell-distanzierte Rezeption. Sie beleuchtet, wie textuelle Strategien die Leser in eine bestimmte Richtung lenken können.
- Identifikatorisch-affektive Rezeptionshaltung: Die Gestaltung des Romans, die Sprache und der Aufbau fördern das Einfühlen des Lesers in Werther.
- Intellektuell-distanzierte Rezeptionshaltung: Elemente im Text, die den Leser zur Reflexion und distanzierten Betrachtung anregen sollen.
- Der monologische Charakter des Briefromans und seine Wirkung auf die Leseridentifikation.
- Die Rolle des Herausgebers und seine Einflussnahme auf die Rezeption.
- Der Vergleich der intendierten und der tatsächlichen Rezeption des Werkes.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den immensen Erfolg von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ und Goethes Unzufriedenheit mit der überwiegend identifikatorischen Rezeption durch die junge Leserschaft. Sie führt in die Thematik der unterschiedlichen Wirkungsintentionen von Briefromanen ein: einer identifikatorisch-affektiven und einer intellektuell-distanzierten, und kündigt die Analyse der entsprechenden Elemente im Text an. Der Fokus liegt auf der Diskrepanz zwischen der von Goethe intendierten und der tatsächlich stattgefundenen Rezeption.
Elemente einer identifikatorisch-affektiven Rezeptionshaltung: Dieses Kapitel analysiert die textlichen Strategien, die eine emotionale Identifikation des Lesers mit Werther fördern. Der monologische Charakter des Romans, der unmittelbare Stil der Briefe, die Konzentration auf Werthers Innerlichkeit und das Ausbleiben von Antwortbriefen lenken die Aufmerksamkeit des Lesers auf Werthers Gefühle und Erfahrungen, wodurch eine intensive Identifikation begünstigt wird. Der Verzicht auf eine distanzierte, mehrperspektivische Darstellung verstärkt diesen Effekt. Die Tagebuchähnlichkeit der Briefe und die Darstellung der Gefühlswelt Werthers im Moment des Erlebens verkürzen die Distanz zwischen Leser und Text und fördern die Identifikation.
Elemente einer intellektuell-distanzierten Rezeptionshaltung: Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel untersucht dieses Kapitel die Elemente des Romans, die eine distanzierte, reflexive Lektüre fördern könnten. Es analysiert die Rolle des Herausgebers, dessen Anmerkungen und Bericht eine distanzierte Perspektive bieten könnten, jedoch im Roman nicht dominant sind. Der Fokus liegt auf der Analyse von Strategien, die der Leserreflexion dienen sollten, aber offenbar von der zeitgenössischen Rezeption übersehen wurden. Das Motiv der Krankheit wird als ein weiterer Aspekt betrachtet, der zur distanzierten Betrachtung der Handlung anregen könnte.
Schlüsselwörter
Die Leiden des jungen Werthers, Goethe, Briefroman, Rezeption, Identifikation, Distanzierung, Wirkungsintention, monologisch, polylogisch, Herausgeber, Sturm und Drang, Hypochondrie.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ und analysiert die gegensätzlichen Wirkungsintentionen des Autors: eine identifikatorisch-affektive und eine intellektuell-distanzierte Rezeption. Der Fokus liegt auf der Frage, wie textuelle Strategien die Leser in eine bestimmte Richtung lenken können.
Welche Rezeptionshaltungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht zwei gegensätzliche Rezeptionshaltungen: eine identifikatorisch-affektive Rezeption, die auf emotionaler Identifikation mit dem Protagonisten Werther beruht, und eine intellektuell-distanzierte Rezeption, die eine reflexive und kritische Auseinandersetzung mit dem Text fordert.
Welche textlichen Strategien werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf textuelle Strategien, die eine der beiden Rezeptionshaltungen fördern. Dazu gehören der monologische Charakter des Briefromans, die Sprache und der Satzbau, die Rolle des Herausgebers, die Darstellung von Werthers Innerlichkeit und das Motiv der Krankheit.
Wie fördert der Roman eine identifikatorisch-affektive Rezeption?
Der monologische Charakter, der unmittelbare Stil der Briefe, die Konzentration auf Werthers Innerlichkeit und das Fehlen von Antwortbriefen lenken den Leser auf Werthers Gefühle und begünstigen so eine intensive Identifikation. Der Verzicht auf eine distanzierte, mehrperspektivische Darstellung verstärkt diesen Effekt.
Wie fördert der Roman eine intellektuell-distanzierte Rezeption?
Elemente, die eine distanzierte, reflexive Lektüre fördern könnten, sind die Rolle des Herausgebers und seine Anmerkungen, sowie das Motiv der Krankheit. Die Arbeit analysiert, inwiefern diese Elemente der Leserreflexion dienen, aber möglicherweise von der zeitgenössischen Rezeption übersehen wurden.
Welche Rolle spielt der Herausgeber?
Die Rolle des Herausgebers und dessen Anmerkungen werden als ein Element untersucht, das eine distanzierte Perspektive bieten könnte, jedoch im Roman nicht dominant ist. Die Analyse untersucht den Einfluss des Herausgebers auf die Rezeption.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Elementen einer identifikatorisch-affektiven Rezeptionshaltung, ein Kapitel zu den Elementen einer intellektuell-distanzierten Rezeptionshaltung und ein Resümee mit Ausblick auf eine zweite Fassung des Werks.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Die Leiden des jungen Werthers, Goethe, Briefroman, Rezeption, Identifikation, Distanzierung, Wirkungsintention, monologisch, polylogisch, Herausgeber, Sturm und Drang, Hypochondrie.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass Goethe in „Die Leiden des jungen Werthers“ zwei gegensätzliche Wirkungsintentionen verfolgte: eine emotionale Identifikation des Lesers mit Werther und eine intellektuell-distanzierte, reflexive Auseinandersetzung mit dem Text. Die Arbeit analysiert, wie diese Intentionen durch textuelle Strategien umgesetzt werden und welche Auswirkungen sie auf die Rezeption hatten.
Welche Diskrepanz wird untersucht?
Die Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen der von Goethe intendierten Rezeption (sowohl identifikatorisch-affektiv als auch intellektuell-distanziert) und der tatsächlich stattgefundenen Rezeption, die vorwiegend identifikatorisch war.
- Citar trabajo
- Julia Hohm (Autor), 2006, Elemente einer identifikatorisch-affektiven und intellektuell-distanzierten Rezeptionshaltung in "Die Leiden des jungen Werther", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122805