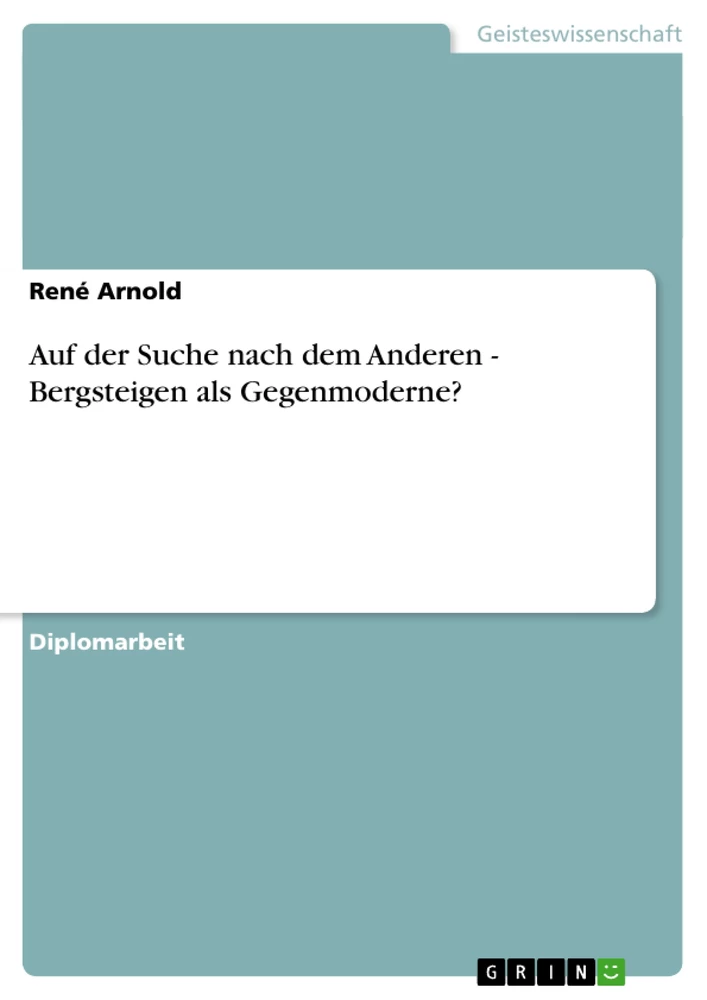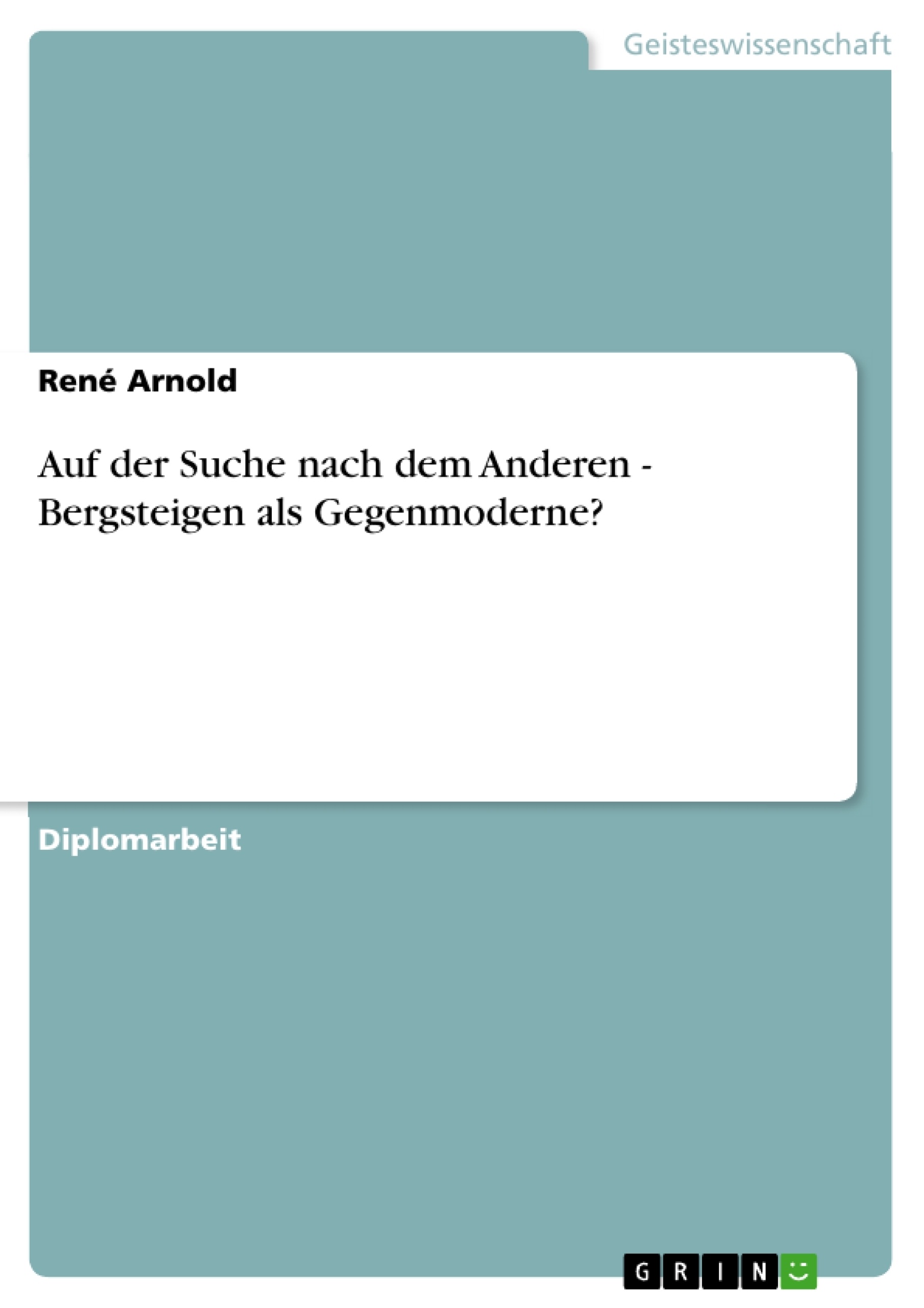Die Arbeit setzt dort an, wo für viele Akteure das Ende einer langen Tour erreicht ist: auf den Gipfeln der Welt. Die höchsten Berge sind Orte, von denen durch die Handlungen ambitionierter Zeitgenossen Geschichten des Glücks und Unglücks, der Erfolge und Misserfolge berichtet werden. Angesichts der publizierten Erfahrungen der Aktiven und der zu beobachtenden Ruhelosigkeit am Berg, hat die Arbeit das Ziel, die Motive und Erklärungen des Phänomens Bergsteigen auszuloten. Dabei reichte es nicht, die jeweiligen Akteure zum Sprechen zu bringen. Es musste ebenso die Gesellschaft analysiert werden, in der die Handlungen stattfinden.
Gerade das Phänomen Bergsteigen zeigt in seiner Entwicklung eine immense Koppelung an den jeweiligen Entwicklungsstand der modernen Gesellschaft. Erst in dem Zusammenhang mit der Moderne und den Modernisierungsprozessen erklären sich die Motive der Berggänger in einer Weise, wie es die alleinige Interpretation ihrer Aussagen nicht zulässt. Denn es sind aus soziologischer Sicht die funktionale Differenzierung, die Dynamik der fortgeschrittenen Moderne und der Individualisierungsschub, welche die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen sich freiwillig in die Gefahren einer extremen Bergbesteigung bringen und ihre Handlungen als zwangsläufig für die Erlangung von Sinnstabilität ansehen.
Das Bergsteigen beinhaltet als Praxis selbstorganisierter Handlungen und selbstinszenierter Erfahrungen einen Erlebnisraum, der den Verworrenheiten des Alltags entgegentritt. Der Bergsteiger sucht das „Besondere im Alltag“, und findet sich in den eisigen Höhen der Bergwelt oder an den kargen Felswänden wieder. Er schafft sich eine vermeintliche Gegenwelt, in der er gegen die Erfahrungen von Alltagsroutine, Wohlfahrtsorientierung, Sicherheitsfixierung, Spannungsarmut und Trägheit das Abenteuer und das Erlebnis findet. Sein Gegenentwurf bietet die Möglichkeit, Gewissheit über das Handeln und über das Selbst zu erlangen, Sinn zu erfahren, physische und psychische Grenzen zu erforschen, konkrete Situationen, Klarheit und Spannung im Risiko wahrzunehmen. Je nach theoretischen Ansatz können die Aktivitäten als Rückbettungsversuch im Sinne von Anthony Giddens, als Phänomen der Zweiten Moderne im Sinne Ulrich Becks, als Sinnbastelei im Sinne von Ronald Hitzler und Anne Honer oder als Inklusionsversuch im Rahmen der Systemtheorie interpretiert werden.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemdarstellung
- 1.2 Ziele, Fragestellung, Hypothesen
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Individuelle Darstellungen in der alpinen Gegenwartsliteratur
- 2.1 Die Diskursanalyse
- 2.1.1 Der Begriff „Diskurs“
- 2.1.2 Der Diskursbegriff Foucaults
- 2.1.3 Die wissenssoziologische Diskursanalyse
- 2.1.4 Methodische Umsetzung
- 2.2 Ziele und Fragestellung der Untersuchung
- 2.3 Datenkorpus
- 2.3.1 Reinhold Messner – Eroberer des Nutzlosen
- 2.3.2 Hans Kammerlander – Der Bergsüchtige
- 2.3.3 Helga Hengge – Die Erlebnisbergsteigerin
- 2.3.4 Jon Krakauer – Der Besessene
- 2.3.5 Kurt Diemberger – Auf der Suche nach dem Ungewissen
- 2.4 Datenauswertung
- 2.4.1 Erlebnissuche und Abenteuer in einer Gegenwelt
- 2.4.2 Herausforderung und Grenzsuche
- 2.4.3 Leistungsorientierung, Konkurrenz, Prestige
- 2.4.4 Identität durch Sinngebung
- 2.4.5 Angst, Risiko und Lust
- 2.4.6 Körpererleben
- 2.4.7 Verhältnis zur Natur
- 2.5 Verdichtung und Thesenbildung
- 3 Alpinismus als modernes Phänomen
- 3.1 Die Entwicklung
- 3.1.1 Der Präalpinismus
- 3.1.2 Der frühe Alpinismus
- 3.1.3 Der klassische Alpinismus
- 3.1.4 Der Alpinismus des 20. Jahrhunderts
- 3.1.5 Zusammenfassung
- 3.2 Höhenbergsteigen als Phänomen der Moderne
- 3.2.1 Kennzeichen von Moderne und Modernisierung
- 3.2.2 Folgen der Moderne
- 3.2.2.1 Funktionale Differenzierung
- 3.2.2.2 Dynamik
- 3.2.2.3 Individualisierung
- 3.2.3 Höhenbergsteigen als Antwort auf die Moderne
- 3.2.3.1 Lebendigkeit im Abenteuer
- 3.2.3.2 Selbstermächtigung und Subjektaufwertung
- 3.2.3.3 Fluchtpunkt Gesellschaftsumwelt
- 3.2.3.4 Die Herstellung von Individualität und Distinktion
- 3.2.3.5 Inszenierte Körperlichkeit
- 3.2.3.6 Eindeutiges und evidentes Handeln
- 3.2.3.7 Wiederaneignung der Zwischenräume
- 3.2.3.8 Rückeroberung der Gegenwart
- 4 Zwischenfazit
- 5 Interviews mit aktiven Höhenbergsteigern
- 5.1 Methodendarlegung
- 5.1.1 Erhebungsinstrument – Narratives Interview
- 5.1.2 Auswahl und Kontaktaufnahme
- 5.1.3 Transkriptionsverfahren
- 5.1.4 Interpretationsverfahren – Qualitative Inhaltsanalyse
- 5.2 Interviewauswertung
- 5.2.1 Allgemeine Angaben
- 5.2.2 Auswertung: Bedeutung alpinistischer Literatur
- 5.2.3 Auswertung: Erlebnissuche und Abenteuer
- 5.2.4 Auswertung: Herausforderung und Grenzsuche
- 5.2.5 Auswertung: Identität durch Sinngebung
- 5.2.6 Auswertung: Angst und Risiko
- 5.2.7 Auswertung: Leistungsorientierung, Konkurrenz, Prestige
- 5.2.8 Auswertung: Körpererleben
- 5.2.9 Auswertung: Verhältnis zur Natur
- 6 Diskussion
- 7 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Motive von Höhenbergsteigern anhand einer Diskursanalyse und Interviews. Ziel ist es, die Bedeutung des Höhenbergsteigens im Kontext der Moderne zu beleuchten und die individuellen Beweggründe der Bergsteiger zu erforschen.
- Die Darstellung des Höhenbergsteigens in der Gegenwartsliteratur
- Die Analyse der Diskurslandschaft um das Thema Bergsteigen
- Die Untersuchung der individuellen Motive von Bergsteigern
- Der Bezug des Höhenbergsteigens zur Moderne und ihren Herausforderungen
- Die Rolle von Risiko, Abenteuer und Identitätssuche im Höhenbergsteigen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Höhenbergsteigens als Risiko- und Abenteuersport ein und beschreibt den öffentlichen Diskurs um die Motive der Bergsteiger. Sie stellt die Problematik der medialen Inszenierung und des Wettlaufs um Rekorde heraus und leitet zur zentralen Forschungsfrage nach den Beweggründen der Bergsteiger über. Der Fokus liegt auf dem scheinbaren Widerspruch zwischen dem Risiko des Todes und der Faszination, die vom Höhenbergsteigen ausgeht.
2 Individuelle Darstellungen in der alpinen Gegenwartsliteratur: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Höhenbergsteigern in ausgewählten literarischen Werken. Es untersucht, wie die Autoren die Motive und Erfahrungen der Bergsteiger schildern und welche Narrative sie dabei verwenden. Durch die Analyse der ausgewählten Texte – u.a. von Messner, Kammerlander, Hengge, Krakauer und Diemberger – wird ein vielschichtiges Bild der individuellen Beweggründe und der damit verbundenen Herausforderungen entworfen. Die verwendete Diskursanalyse dient als methodisches Werkzeug, um die verschiedenen Perspektiven und Deutungsmuster zu identifizieren.
3 Alpinismus als modernes Phänomen: Dieses Kapitel analysiert den Alpinismus im Kontext der Moderne. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Bergsteigens und beschreibt, wie sich die Motive und Praktiken im Laufe der Zeit verändert haben. Es geht der Frage nach, inwiefern das Höhenbergsteigen als eine Reaktion auf die Herausforderungen und die Charakteristika der modernen Gesellschaft verstanden werden kann. Die Analyse konzentriert sich auf Aspekte wie Individualisierung, die Suche nach Sinn und Identität und die Konfrontation mit dem Risiko. Der Abschnitt beleuchtet die Rolle des Bergsteigens als Ausdruck von Selbstermächtigung und der Suche nach Grenzerfahrungen.
5 Interviews mit aktiven Höhenbergsteigern: Kapitel 5 beschreibt die Methodik der durchgeführten Interviews mit aktiven Höhenbergsteigern. Es erläutert das verwendete Verfahren des narrativen Interviews, die Auswahl der Probanden und die angewandte qualitative Inhaltsanalyse zur Auswertung der Daten. Die detaillierte Beschreibung der methodischen Vorgehensweise soll die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Untersuchung gewährleisten und die Validität der Ergebnisse sichern. Dieses Kapitel legt den Fokus auf die wissenschaftliche Fundierung der Datenerhebung und -auswertung.
Schlüsselwörter
Höhenbergsteigen, Alpinismus, Moderne, Identität, Risiko, Abenteuer, Diskursanalyse, Qualitative Inhaltsanalyse, Motivforschung, Grenzerfahrung, Selbstverwirklichung, Individualisierung, Leistungsorientierung, Naturerfahrung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Individuelle Motive im Höhenbergsteigen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Motive von Höhenbergsteigern im Kontext der Moderne. Sie analysiert, warum Menschen Höhenbergsteigen betreiben und welche Bedeutung diese Aktivität für sie hat.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Studie verwendet eine kombinierte Methodik: Eine Diskursanalyse von literarischen Texten über Bergsteigen (z.B. Werke von Messner, Kammerlander, Hengge, Krakauer und Diemberger) und qualitative Inhaltsanalysen von narrativen Interviews mit aktiven Höhenbergsteigern. Die Diskursanalyse dient der Erforschung der öffentlichen Wahrnehmung und Deutungsmuster rund um das Thema Bergsteigen, während die Interviews Einblicke in die individuellen Beweggründe der Bergsteiger geben sollen.
Welche Literatur wird analysiert?
Die Diskursanalyse basiert auf ausgewählten literarischen Werken von bekannten Bergsteigern wie Reinhold Messner, Hans Kammerlander, Helga Hengge, Jon Krakauer und Kurt Diemberger. Diese Texte bieten verschiedene Perspektiven auf die Erfahrungen und Motive im Höhenbergsteigen.
Wie werden die Interviews durchgeführt und ausgewertet?
Es werden narrative Interviews mit aktiven Höhenbergsteigern geführt. Die Auswertung erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse, um die wiederkehrenden Themen und Motive zu identifizieren und zu interpretieren. Die Methodik wird detailliert im Kapitel 5 beschrieben.
Welche zentralen Themen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des Höhenbergsteigens, darunter die Rolle von Risiko und Abenteuer, die Suche nach Identität und Sinn, die Konfrontation mit Grenzen, die Leistungsorientierung, die Beziehung zur Natur und das Körpererleben. Es wird auch der Bezug zum gesellschaftlichen Kontext der Moderne hergestellt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Literaturanalyse, historische Einordnung des Alpinismus im Kontext der Moderne, Präsentation und Auswertung der Interviews, Diskussion und Resümee. Ein Inhaltsverzeichnis im HTML-Dokument gibt einen detaillierten Überblick über die Kapitel und Unterkapitel.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der individuellen Motive im Höhenbergsteigen zu liefern und deren Bedeutung im Kontext der Moderne zu interpretieren. Die konkreten Schlussfolgerungen ergeben sich aus der Analyse der literarischen Texte und der Interviews.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Höhenbergsteigen, Alpinismus, Moderne, Identität, Risiko, Abenteuer, Diskursanalyse, Qualitative Inhaltsanalyse, Motivforschung, Grenzerfahrung, Selbstverwirklichung, Individualisierung, Leistungsorientierung, Naturerfahrung.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten gedacht, die sich mit dem Thema Höhenbergsteigen, Motiven im Extremsport und der soziologischen Analyse von Risikosportarten auseinandersetzen.
- Quote paper
- René Arnold (Author), 2006, Auf der Suche nach dem Anderen - Bergsteigen als Gegenmoderne?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122811