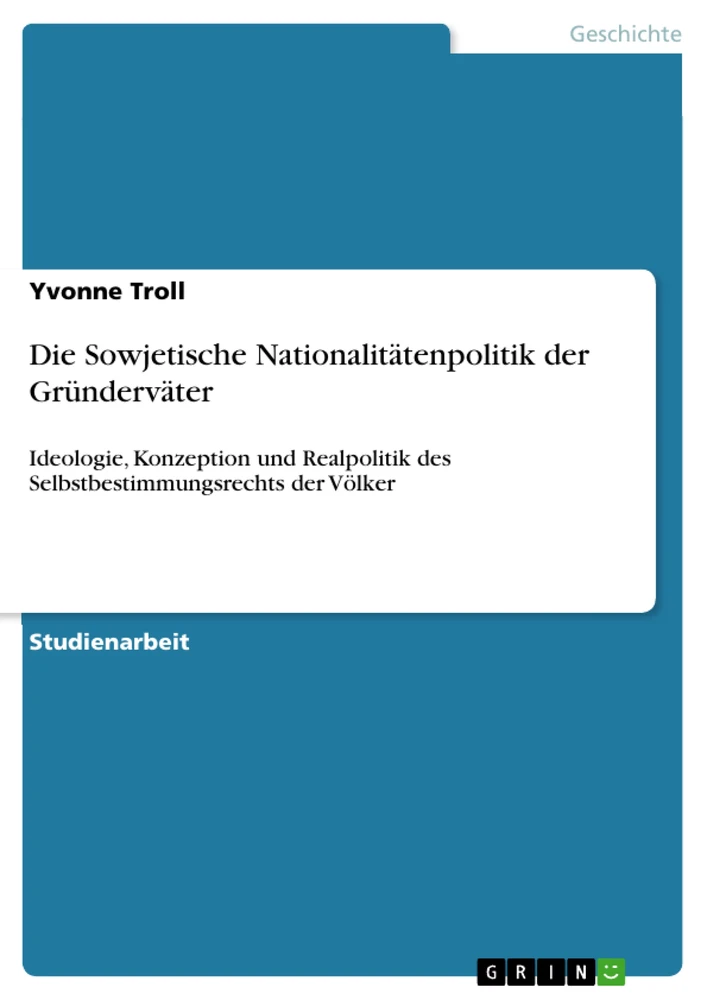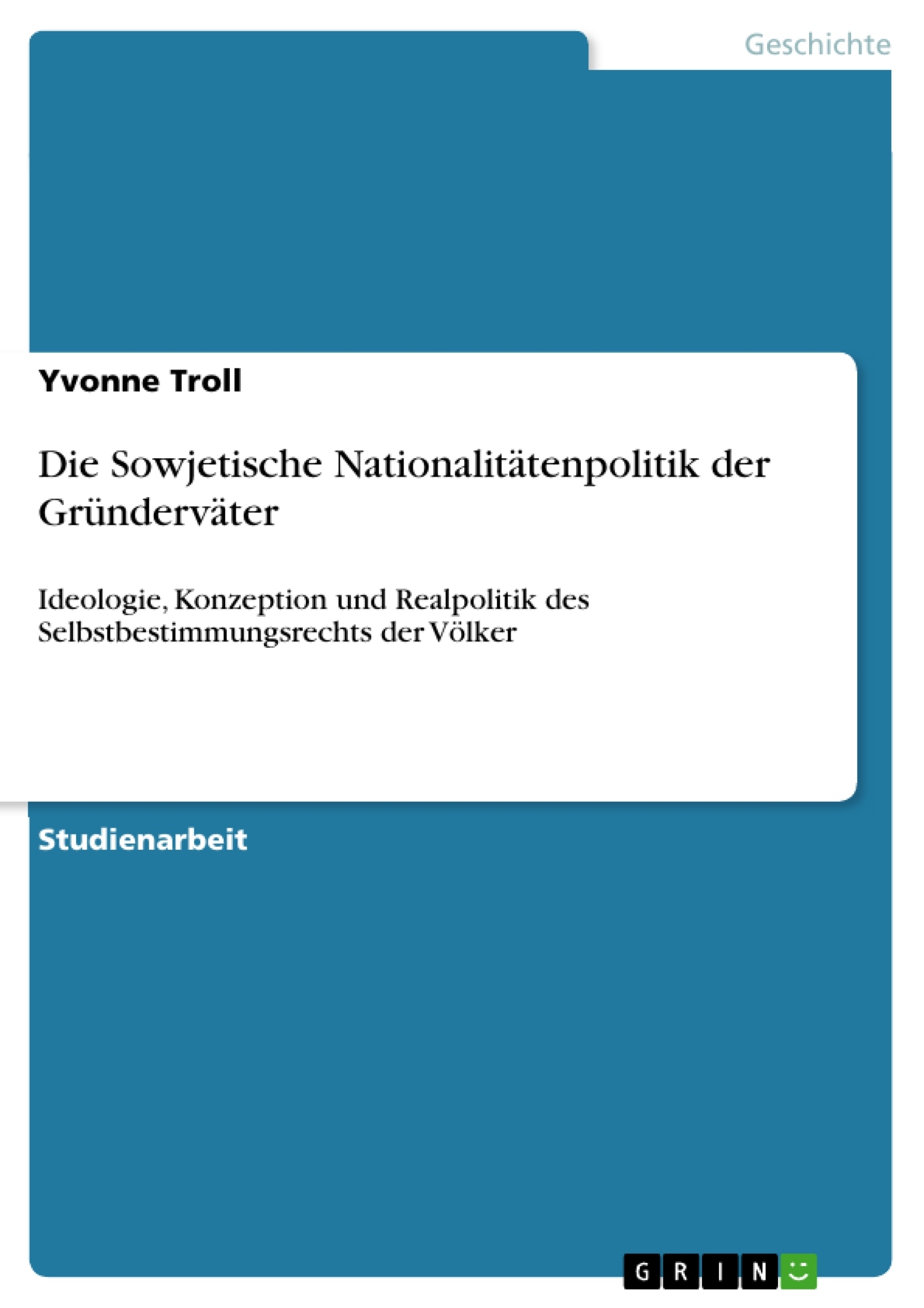Der Begriff des „Selbstbestimmungsrechts der Völker“ war in der bolschewistischen Rhetorik ein Schlüsselbegriff für die Nationalitätenpolitik und diente als das Aushängeschild für den Umgang mit ethnischen Gruppen. Die eindeutig positive Konnotation dieses Rechts auf Freiheit der Selbstbestimmung lässt sich hierbei nicht leugnen, jedoch beweist die historische Realität, dass die sie dem theoretischen Anspruch nicht standhalten konnte.
Das Recht auf Selbstbestimmung ist bei genauerem Hinsehen eine inhaltlich äußerst ungenaue, kontrovers zu interpretierende und demzufolge auf verschiedenste Arten praktisch umsetzbarere Losung. Entsprechend groß waren auch die Differenzen innerhalb des wortführenden Kreises der Bolschewiki, insbesondere in der Zeit zwischen der Oktoberrevolution 1917 und dem Entstehen der Sowjetunion im Dezember 1922. Obwohl das Schlagwort der Selbstbestimmung keineswegs neu war, sondern in früheren Abhandlungen zur nationalen Frage, die im übrigen von Marx selbst nur unzulänglich behandelt wurde und aufgrund dessen keine eindeutigen Richtlinien bezüglich ihrer Handhabung hinterließ, bereits eine erhebliche Rolle spielte, so wuchs doch seine Bedeutung durch die veränderte Situation nach der sozialistischen Revolution beträchtlich.
Das Reich war im Begriff zu zerfallen. Nationale Kräfte wurden frei, die den Willen der Völker, ihr eigener Herr zu werden verdeutlichten. Die Bolschewiki hatten erwartet, dass die sozialistischen Kräfte derart groß sein würden, dass sich nationalistische Tendenzen als bourgeoises Element gewissermaßen von selbst auflösen würden. Klassenkämpfe anstelle von ethnischen Interessen würden überwiegen und die verschiedenen Völker auf den Weg in Richtung Verschmelzung zur sozialistischen Weltgesellschaft bringen.
Dies war nicht der Fall. Die nicht-russischen Völker machten unmittelbar nach der Revolution von ihrem Recht auf Selbstbestimmung Gebrauch. Überall im ehemals gewaltigen russischen Reich gab es ernsthafte Separationstendenzen und die Bolschewiki sahen sich der schwierigen Aufgabe gegenüber, dies zu verhindern. Ein derart in seiner Macht und Größe zusammen-geschmolzenes Russisches Reich würde das Ende sämtlicher weltrevolutionärer Hoffnungen auf den Sieg des Sozialismus über den Kapitalismus bedeuten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorrevolutionäre Theorien zur Nationalen Frage
- Stalins Nationsdefinition
- Lenins frühe Konzeption des Selbstbestimmungsrechts
- Am Vorabend der Revolution
- Russland nach der Revolution
- Die (theoretischen) Rechte der Völker Russlands
- Der drohende Reichszerfall und die Gründung der RSFSR
- Das notwendige Übel der Föderation
- Die UdSSR
- Auf dem Weg zur Sowjetunion
- Die Gründung der UdSSR
- Die Georgische Affäre
- Die „Leninistische“ Nationalitätenpolitik der 20er Jahre
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sowjetische Nationalitätenpolitik der 1920er Jahre. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen des Selbstbestimmungsrechts der Völker im Kontext der bolschewistischen Ideologie und beleuchtet die konkreten Herausforderungen, die sich in der Realpolitik ergaben.
- Das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Schlüsselbegriff der bolschewistischen Nationalitätenpolitik
- Die unterschiedlichen Konzeptionen des Selbstbestimmungsrechts bei Lenin und Stalin
- Die Spannungen zwischen theoretischem Anspruch und praktischer Umsetzung
- Die Rolle des Föderationsprinzips in der Gestaltung der Sowjetunion
- Die Bedeutung der nationalen Frage für den Aufbau und die Stabilität des Sowjetstaates
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff des Selbstbestimmungsrechts der Völker im Kontext der bolschewistischen Rhetorik vor und unterstreicht die Diskrepanz zwischen theoretischem Anspruch und historischer Realität. Sie thematisiert die Komplexität des Selbstbestimmungsrechts und die unterschiedlichen Interpretationen innerhalb der Bolschewiki.
Kapitel 2 beleuchtet die vorrevolutionären Theorien zur Nationalen Frage. Es analysiert Stalins Nationsdefinition und seine Kritik an der österreichischen Sozialdemokratie, sowie Lenins frühe Konzeption des Selbstbestimmungsrechts im Kontext des zaristischen Vielvölkerreiches. Das Kapitel schildert die Situation am Vorabend der Revolution und Lenins Ansicht, dass die nationale Frage durch die sozialistischen Kräfte gelöst werden würde.
Kapitel 3 beschreibt die Situation in Russland nach der Revolution. Es diskutiert die Herausforderungen, die sich durch die Separationstendenzen der nicht-russischen Völker ergaben und die Notwendigkeit der Föderation für die Bolschewiki.
Kapitel 4 beleuchtet die Entstehung der UdSSR. Es beschreibt die Georgische Affäre als ein Beispiel für die schwierigen Prozesse der Einigung. Das Kapitel analysiert die "Leninistische" Nationalitätenpolitik der 1920er Jahre im Kontext der Gründung der Sowjetunion.
Schlüsselwörter
Nationalitätenpolitik, Selbstbestimmungsrecht der Völker, Sowjetunion, Lenin, Stalin, Föderation, Nationale Frage, Russland, Vielvölkerstaat, Revolution, Marxismus, Sozialismus, Bolschewismus, Georgische Affäre
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutete das "Selbstbestimmungsrecht der Völker" für die Bolschewiki?
Es war ein Schlüsselbegriff der Rhetorik, der ethnischen Gruppen Freiheit versprach. In der Realität diente er jedoch oft dazu, den Zerfall des Reiches nach der Revolution zu verhindern.
Wie unterschieden sich die Konzepte von Lenin und Stalin?
Die Arbeit analysiert Stalins strikte Nationsdefinition und Lenins frühere, strategischere Konzeption des Selbstbestimmungsrechts im Kontext des Vielvölkerstaates.
Was war die "Georgische Affäre"?
Die Georgische Affäre war ein politischer Konflikt Anfang der 1920er Jahre, der die Spannungen zwischen zentralistischer Macht und nationalen Autonomiebestrebungen bei der Gründung der UdSSR verdeutlichte.
Warum wurde die Föderation als "notwendiges Übel" betrachtet?
Die Bolschewiki bevorzugten eigentlich einen zentralistischen Staat, mussten aber föderale Strukturen akzeptieren, um die nach Unabhängigkeit strebenden Nationen im sowjetischen Machtbereich zu halten.
Welche Rolle spielten Klassenkämpfe im Vergleich zu ethnischen Interessen?
Die Bolschewiki hofften, dass Klassenkämpfe die nationalen Interessen verdrängen würden. Die Realität nach 1917 zeigte jedoch, dass nationalistische Tendenzen weiterhin eine prägende Kraft blieben.
- Citation du texte
- Yvonne Troll (Auteur), 2006, Die Sowjetische Nationalitätenpolitik der Gründerväter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122931