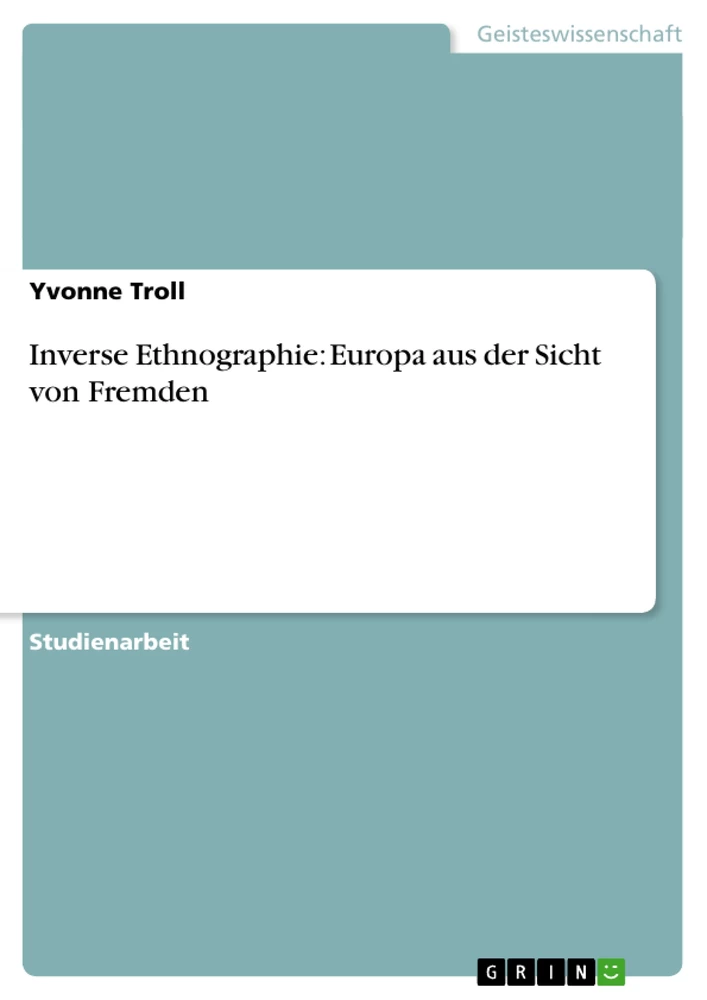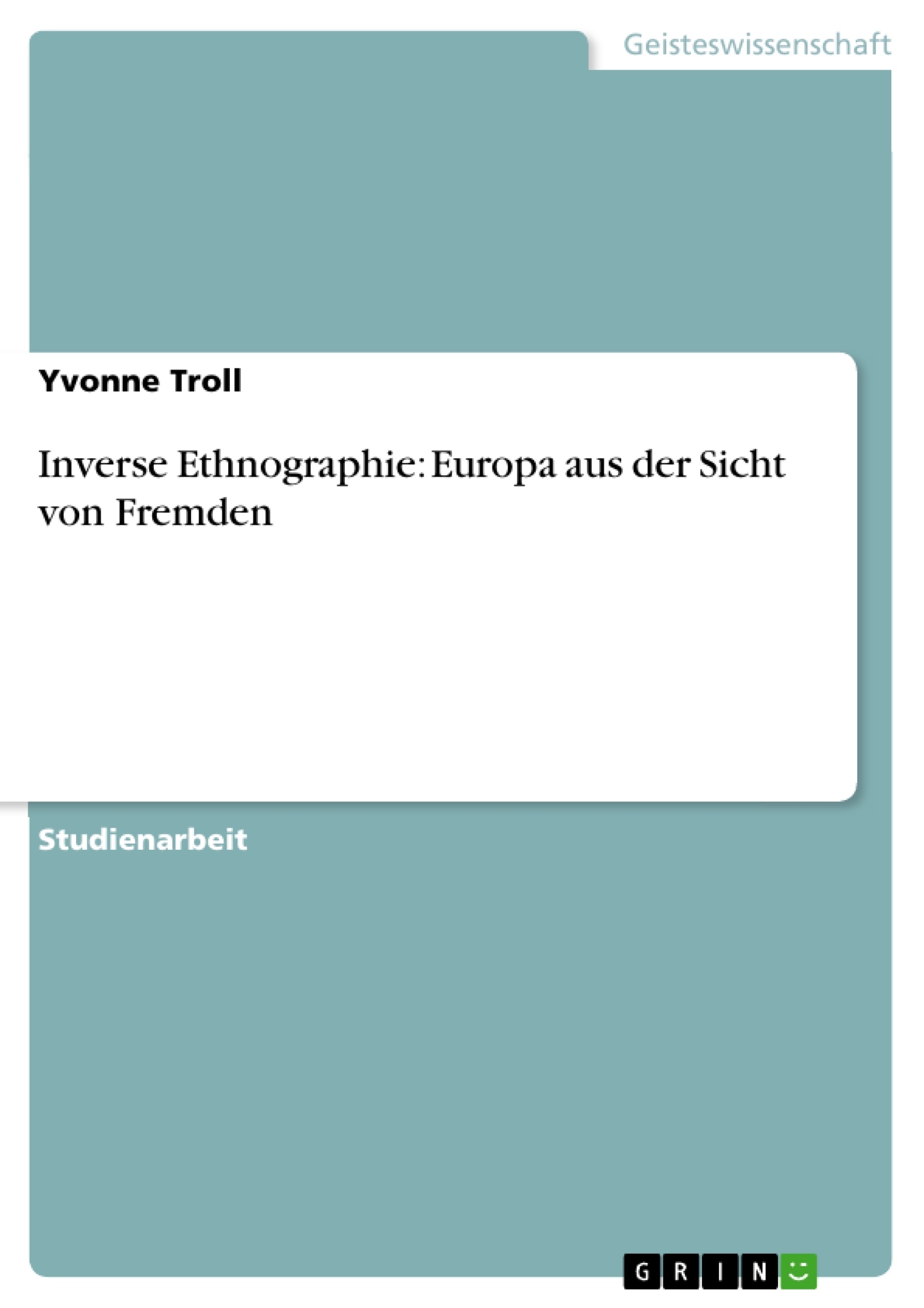[...] Um dem Anspruch der interdisziplinären philosophischen und ethnologischen Betrachtung
der Entwicklung von der klassischen Ethnographie der „Neuen Welt“ aus europäischer Sicht,
hin zu einer inversen Ethnographie über Europa gerecht zu werden, müssen zunächst die
philosophischen Grundlagen dargelegt werden. Da der Beschreibung fremder Kulturen, also
dem Entstehen der Ethnographie, immer die Begegnung von Menschen mit unterschiedlichem
kulturellen Hintergrund vorausgeht, dient als Grundlage für die philosophische Analyse der
Text „Die Spur des Anderen“ des französisch-jüdischen Philosophen Emmanuel Lévinas, in
dem das absolut Andere das Wesentliche in der Begegnung mit dem Fremden ist, aus dem
sich eine bestimmte Handlungsethik ableitet. Bei Bernhard Waldenfels taucht ein ähnlicher
Begriff auf, der des radikal Fremden, auf den ebenfalls eingegangen wird.
Im Vordergrund steht die Frage, inwiefern es ein allgemein menschliches Phänomen ist, das
Fremde in der Begegnung und in der Beschreibung auf eigene Kategorien zurückzuführen, zu
vergleichen und zu bewerten. Anhand der historischen und aktuellen Beispiele soll kritisch
erörtert werden, ob Lévinas’ Ethik im Umgang mit dem Fremden in der Realität umsetzbar
ist, oder ob es nicht vielmehr einer utopischen Forderung entspricht, Fremdes absolut fremd
zu belassen und keine Bezugspunkte, ob positiver oder negativer Art, im eigenen Kontext zu
suchen. Besonders in der heutigen Funktion der Ethnographie als beschreibende und
theoretisch einbettende Darstellung von Kulturen, stellt sich mehr denn je die Frage, ob der Ethnologe als Wissenschaftler frei sein muss, von jeglicher Parallelziehung zum ihm
vertrauten Kontext, ob dies möglich und wünschenswert wäre, und was sich daraus für
Kompetenzen und Aufgaben ableiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Philosophische Grundlagen zur kritischen Auseinandersetzung mit inverser Ethnographie
- Die Ethik Lévinas' in der Begegnung mit dem Fremden
- Das „Radikal Fremde“ bei Waldenfels
- Die Anfänge der Ethnographie
- Kolonialismus - Kritische Betrachtung der Entstehungsweise ethnographischer Imaginäre Ethnographie
- Die „Perserbriefe“ von Montesquieu
- Zur Funktionalisierung des fremden Blicks
- Reiseberichte außereuropäischer Besucher im 19. Jahrhundert
- Das „Schauspiel Europa“
- Beispiel Ham Mukasa aus Uganda
- Beispiele Selim bin Abakabari und Amur bin Nasur aus Sansibar
- Inverse Ethnographie im 20. Jahrhundert
- Afrikanische Europabilder nach der kolonialen Unabhängigkeit
- Die Krise der Ethnologie
- Spezieller Blick auf die Deutschland Ethnographie
- Geschichtliche Hintergründe ethnographischer Berichte über Deutschland
- Tendenzen der internationalen Deutschland Ethnographie der Gegenwart
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der inversen Ethnographie, d.h. die Beschreibung Europas aus der Perspektive außereuropäischer Beobachter. Sie analysiert den historischen Kontext der Ethnographie, beginnend mit der Kolonialzeit bis hin zur zeitgenössischen Forschung. Dabei wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Begegnung mit dem Fremden und dessen Beschreibung von philosophischen und ethischen Fragestellungen geprägt sind.
- Die philosophischen Grundlagen der Begegnung mit dem Fremden nach Lévinas und Waldenfels
- Die Entstehung und Entwicklung der Ethnographie im Kontext des Kolonialismus
- Die Rolle des „fremden Blicks“ in der Beschreibung Europas
- Afrikanische Perspektiven auf Europa im 20. Jahrhundert
- Aktuelle Tendenzen in der Deutschland-Ethnographie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Entwicklung der Ethnographie und ihre europäische Prägung. Die darauffolgenden Kapitel befassen sich mit den philosophischen Grundlagen der Auseinandersetzung mit dem Fremden, basierend auf den Theorien von Lévinas und Waldenfels. Es folgt eine kritische Betrachtung der Anfänge der Ethnographie und ihrer Verbindung zum Kolonialismus, inklusive einer Analyse der „Perserbriefe“ von Montesquieu. Reiseberichte außereuropäischer Besucher im 19. Jahrhundert werden im Anschluss vorgestellt, mit Beispielen aus Afrika. Weitere Kapitel behandeln die inverse Ethnographie des 20. Jahrhunderts, afrikanische Europabilder nach der Unabhängigkeit und die Krise der Ethnologie.
Schlüsselwörter
Inverse Ethnographie, Ethnologie, Fremdenbegegnung, Kolonialismus, Lévinas, Waldenfels, Afrika, Deutschland, Europabilder, interkulturelle Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist 'inverse Ethnographie'?
Inverse Ethnographie bezeichnet die Beschreibung und Analyse Europas oder der westlichen Welt aus der Perspektive außereuropäischer Beobachter.
Welche Rolle spielt Emmanuel Lévinas in dieser Arbeit?
Sein Konzept der „Spur des Anderen“ dient als philosophische Grundlage für die ethische Begegnung mit dem Fremden, ohne diesen auf eigene Kategorien zu reduzieren.
Was sind Montesquieus 'Perserbriefe'?
Es ist ein literarisches Werk, das den „fremden Blick“ fiktiver persischer Reisender nutzt, um die französische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts kritisch zu spiegeln.
Wie veränderte der Kolonialismus die Ethnographie?
Die Arbeit analysiert kritisch, wie ethnographische Bilder oft zur Rechtfertigung kolonialer Machtstrukturen und zur Abgrenzung des „Eigenen“ vom „Fremden“ genutzt wurden.
Gibt es historische Reiseberichte von Afrikanern über Europa?
Ja, die Arbeit nennt Beispiele wie Ham Mukasa aus Uganda oder Reisende aus Sansibar, die im 19. Jahrhundert ihre Eindrücke vom „Schauspiel Europa“ festhielten.
Was versteht man unter der 'Krise der Ethnologie'?
Dies bezieht sich auf die wissenschaftliche Debatte im 20. Jahrhundert über die Objektivität des Beobachters und die Notwendigkeit, eurozentrische Sichtweisen zu überwinden.
- Citation du texte
- Yvonne Troll (Auteur), 2007, Inverse Ethnographie: Europa aus der Sicht von Fremden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122939