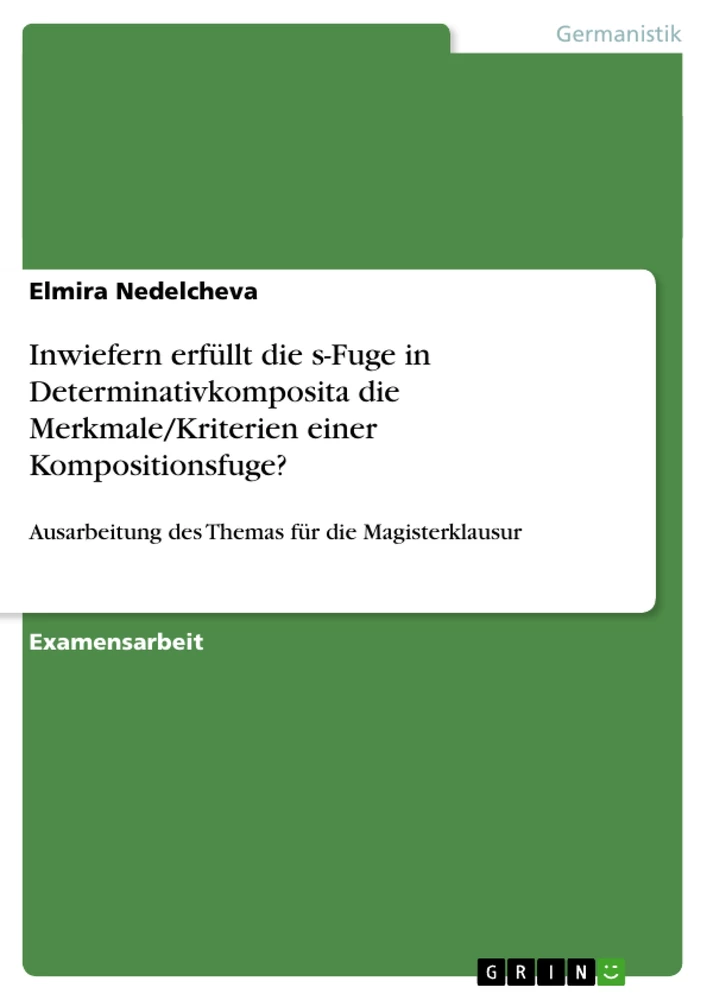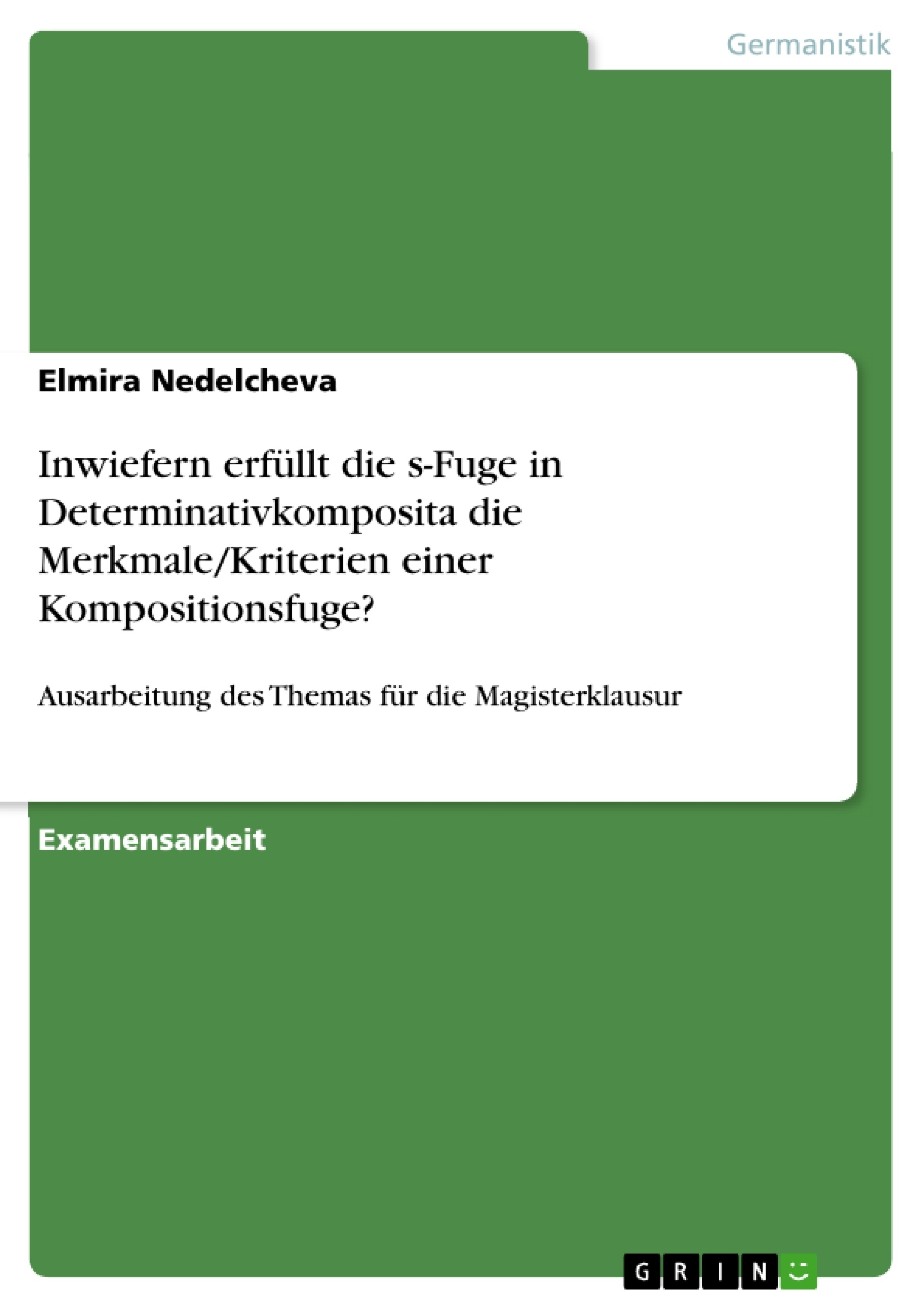Fugenelemente – wie -s- in dt. Volk-s-musik werden häufig mit Genitiv- und Pluralmarkern assoziiert. Die Verbindung mit Flexiven ist nicht verwunderlich, denn Fugenelemente stimmen in den meisten Fällen mit einem typischen Genitiv- oder Pluralflexiv des Deutschen überein. Ist aber die Volk-s-musik wirklich die 'Musik des Volkes'? Warum heißt sie dann nicht Volkes-musik? Die genannten Beispiele weisen auf zentrale Probleme in der Systematik der Fugenelemente hin: Die Assoziation mit Flexiven scheint in den Einzelsprachen häufig im ersten Augenblick sinnvoll zu sein, wird aber bei näherer Betrachtung des Systems schnell wieder zerschlagen. Warum heißt es z. B. im Deutschen König-s-hof, der sich genitivisch mit 'Hof des Königs' umschreiben lässt, aber auch Verbindung-s-glied, das weder genitivische Umschreibung mit 'Glied der Verbindung' zulässt (eher wird eine Präpositionalphrase wie 'Glied zur Verbindung' verlangt) noch einer Genitivform entspricht: *der Verbindungs. Warum heißt es außerdem Hand-O-tuch und nicht Händ-e-tuch, obwohl man es doch immer mit beiden Händen benutzt? Diese Beispiele genügen, um die zentralen Fragen der vorliegenden Arbeit zu illustrieren: Die Fugenelemente erscheinen auf den ersten Blick kaum systematisierbar. Dass Systematisierung zu einem gewissen Grade trotzdem erreicht werden kann, haben jedoch zahlreiche größere Arbeiten zum Deutschen erwiesen.
Die vorliegende Analyse versucht einen Einblick in die Problematik der –s-Fuge, die die Morphemgrenze zwischen zwei substantivischen Konstituenten bezeichnet, zu vermitteln und beschäftigt sich weiterhin mit der Frage, inwiefern dieses Fugenelement die vermuteten allgemeinen Funktionen der Fugenelemente –en, -ens, -n, -e, -er erfüllt und vor allem welche Regularitäten ihr Auftreten bewirken. Insbesondere sollen dabei Regelhaftigkeiten, die bisher gefunden wurden, solche, die möglich sein könnten, aber noch nicht genügend belegt sind, wie aber auch noch unerklärte Sonderfälle oder Ausnahmen, aufgezeigt werden.
Der erste Teil befasst sich zunächst mit der Klärung des theoretischen Hintergrundes. Dabei werden die Begriffe Determinativkomposita und Fuge erläutert. Daher wird nach einer kurzen Beschreibung der allgemeinen Funktionen der Fugenelementen ausführlich auf die Frage eingegangen, durch welche Funktions- und Beschreibungsebenen sich die –s-Fuge charakterisieren lässt. Dazu werden die verschiedenen grundlegenden Merkmale der Verbindungselemente an der –s-Fuge überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1. Definition - Determinativkompositum
- 2.2. Definition - Fugenelement
- 3. Zur Analyse der Frage: Inwiefern die -s-Fuge in Determinativkomposita die Standardannahmen zur Funktion der Fugenelemente erfüllt
- 4. Zusammenfassung der Ergebnisse zur Funktionen der -s-Fuge
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die s-Fuge in deutschen Determinativkomposita und analysiert, inwieweit sie die Kriterien einer Kompositionsfuge erfüllt. Sie beleuchtet die Funktion der s-Fuge im Vergleich zu anderen Fugenelementen und untersucht die Regelmäßigkeiten und Ausnahmen ihres Auftretens.
- Definition und Charakterisierung von Determinativkomposita und Fugenelementen
- Analyse der Funktion der s-Fuge in Bezug auf Standardannahmen
- Untersuchung der Regelmäßigkeiten und Ausnahmen im Auftreten der s-Fuge
- Vergleich der s-Fuge mit anderen Fugenelementen
- Beitrag zur Systematisierung von Fugenelementen im Deutschen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Fugenelemente im Deutschen ein und veranschaulicht an Beispielen wie „Volk-s-musik“ oder „König-s-hof“ die Schwierigkeiten ihrer Systematisierung. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Funktion der s-Fuge in Determinativkomposita und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die scheinbare Willkürlichkeit im Auftreten von Fugenelementen wird hervorgehoben, und die Arbeit wird als Beitrag zur Klärung dieser systematischen Unsicherheiten positioniert.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, indem es die Begriffe „Determinativkompositum“ und „Fugenelement“ präzise definiert. Es beschreibt die allgemeinen Funktionen von Fugenelementen und bereitet den Boden für die detaillierte Analyse der s-Fuge in den folgenden Kapiteln. Es dient als notwendige Grundlage für das Verständnis der späteren Argumentation und stellt die relevanten linguistischen Konzepte vor.
3. Zur Analyse der Frage: Inwiefern die -s-Fuge in Determinativkomposita die Standardannahmen zur Funktion der Fugenelemente erfüllt: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert die s-Fuge im Detail. Es untersucht, inwieweit die s-Fuge die typischen Funktionen von Fugenelementen erfüllt und welche Regelmäßigkeiten oder Ausnahmen ihr Auftreten kennzeichnen. Es wird eine systematische Überprüfung der verschiedenen Merkmale der Verbindungselemente an der s-Fuge vorgenommen, um ihre Übereinstimmung mit Standardannahmen zu evaluieren und etwaige Abweichungen zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Determinativkomposita, Fugenelement, s-Fuge, Kompositionsfuge, Morphemgrenze, Genitiv, Plural, Regelmäßigkeit, Ausnahme, Systematisierung, deutsche Morphologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der s-Fuge in deutschen Determinativkomposita
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die sogenannte „s-Fuge“ in deutschen Determinativkomposita. Sie untersucht, ob und inwieweit diese Fuge die üblichen Funktionen von Fugenelementen erfüllt und welche Regeln und Ausnahmen ihr Auftreten bestimmen. Im Mittelpunkt steht der Vergleich mit anderen Fugenelementen und der Beitrag zur besseren Systematisierung dieser linguistischen Phänomene.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Charakterisierung von Determinativkomposita und Fugenelementen. Sie analysiert die Funktion der s-Fuge im Detail, untersucht Regelmäßigkeiten und Ausnahmen ihres Auftretens und vergleicht sie mit anderen Fugenelementen. Ziel ist es, einen Beitrag zur Systematisierung der Fugenelemente im Deutschen zu leisten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Rahmen, ein zentrales Analysekapitel zur s-Fuge, eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage vor und skizziert den Aufbau. Der theoretische Rahmen definiert die zentralen Begriffe. Das Hauptkapitel analysiert die s-Fuge und ihre Funktion. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit (in Kurzfassung)?
Die Arbeit untersucht systematisch, ob und wie die s-Fuge die typischen Funktionen von Fugenelementen erfüllt. Sie beleuchtet Regelmäßigkeiten und Ausnahmen im Auftreten der s-Fuge und trägt so zu einem besseren Verständnis der deutschen Morphologie bei. Konkrete Ergebnisse zur Übereinstimmung oder Abweichung von Standardannahmen werden im Hauptteil der Arbeit detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Determinativkomposita, Fugenelement, s-Fuge, Kompositionsfuge, Morphemgrenze, Genitiv, Plural, Regelmäßigkeit, Ausnahme, Systematisierung, deutsche Morphologie.
Wofür eignet sich diese Arbeit?
Diese Arbeit eignet sich für akademische Zwecke, insbesondere zur Analyse von Themen in der deutschen Morphologie und Kompositionslehre. Sie bietet eine strukturierte und detaillierte Untersuchung der s-Fuge und ihrer Funktion in Determinativkomposita.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden sich im vollständigen Text der Arbeit, inklusive der detaillierten Analyse der s-Fuge und der Diskussion der Ergebnisse. Das Literaturverzeichnis enthält Quellen für weiterführende Recherchen.
- Arbeit zitieren
- MA Elmira Nedelcheva (Autor:in), 2008, Inwiefern erfüllt die s-Fuge in Determinativkomposita die Merkmale/Kriterien einer Kompositionsfuge?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122976