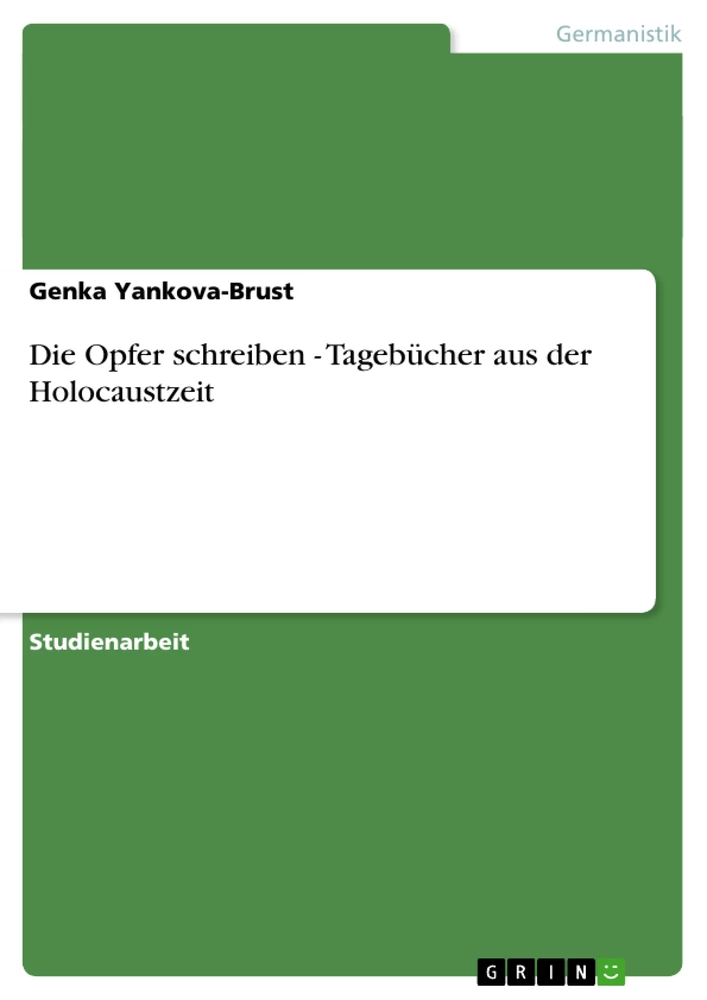Ein Tagebuch kann man ganz allgemein als Medium für die Beschäftigung des Menschen mit sich selbst definieren. Gedanken, Gefühle, Ereignisse und Verhalten werden täglich oder zumindest regelmäßig schriftlich fixiert, so „dass dem Tagebuchschreiber die Zeit als Element bewusst wird.“ Das alltägliche Geschehen bildet den notwendigen Bezugsrahmen für die Auseinandersetzung des Individuums mit sich selbst und seiner Umgebung und steht im Mittelpunkt der meisten Tagebücher. Sie gehören eindeutig zu den autobiographischen Gattungen und sind als „Figurationen von Zeiterfahrung“2 zu verstehen. Ein Tagebuch kann neben der Funktion der Ich-Analyse auch eine Funktion als Chronik seiner Zeit erfüllen. Obwohl Tagebücher so unterschiedlich sind, wie die Menschen, die sie schreiben, erweist sich die Zeit, in der sie verfasst wurden, als eine ausschlaggebende Grundlage.
Gegenstand der Untersuchung dieser Arbeit sind einige Tagebücher aus der Holocaustzeit als schriftliche Dokumente und historische Hinterlassenschaft für die heutige Erinnerungsliteratur. Das sind einerseits zwei „Klassiker“ - die Tagebücher von Anne Frank und Viktor Klemperer und andererseits zwei andere, relativ unbekannte Tagebücher – von Leon Guz und Etty Hillesum.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Tagebuch: Tagebücher als literarische Gattung
- Forschungssituation
- Das Tagebuch von Etty Hillesum
- Kurze biographische Erläuterungen
- Der Weg des Tagebuchs: Entdeckung, Probleme der Edition
- Analyse des Tagebuchs
- Holocaust-Tagebücher
- „Also wir leben noch“: Das Tagebuch von Leon Guz
- Das Tagebuch von Anne Frank
- Die Tagebücher von Viktor Klemperer
- Die vier Tagebücher im Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht ausgewählte Tagebücher aus der Zeit des Holocaust als schriftliche Dokumente und historische Hinterlassenschaften für die heutige Erinnerungsliteratur. Sie analysiert die Einordnung von Tagebüchern in der Literaturwissenschaft, referiert den Forschungsstand und untersucht ausgewählte Primärtexte theoretisch. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Tagebuchs von Etty Hillesum.
- Klassifizierung und Merkmale der Tagebuchgattung in der Literaturwissenschaft
- Analyse der Tagebücher von Anne Frank, Viktor Klemperer, Leon Guz und Etty Hillesum
- Vergleich der vier Tagebücher hinsichtlich ihrer Funktionen (Umgang mit der Zeitdimension, Überlebenshilfe, innerer Widerstand)
- Detaillierte Analyse des Tagebuchs von Etty Hillesum
- Tagebücher als historische Quellen und Zeugnisse des Holocaust
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung definiert das Tagebuch als Medium der Selbstreflexion und beleuchtet seine Einordnung in die Literaturwissenschaft, mit Fokus auf die Unterschiede zwischen literarischen und nicht-literarischen Tagebüchern. Der Forschungsstand wird kurz zusammengefasst.
Das Tagebuch von Etty Hillesum: Dieses Kapitel bietet eine kurze Biografie von Etty Hillesum und beschreibt den Weg ihres Tagebuchs bis zur Veröffentlichung. Die Analyse des Tagebuchs wird angekündigt.
Holocaust-Tagebücher: Dieses Kapitel stellt die Tagebücher von Leon Guz, Anne Frank und Viktor Klemperer vor und kündigt einen Vergleich dieser Texte an.
Schlüsselwörter
Tagebuchliteratur, Holocaust, Erinnerungsliteratur, Etty Hillesum, Anne Frank, Viktor Klemperer, Leon Guz, Zeitwahrnehmung, Selbstreflexion, historische Quelle, Überlebensstrategie, innerer Widerstand.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Tagebücher wichtige Quellen zur Holocaustzeit?
Sie sind unmittelbare Zeugnisse der Zeitwahrnehmung und dienen als historische Hinterlassenschaften der Erinnerungsliteratur.
Welche Tagebücher werden in der Arbeit untersucht?
Analysiert werden die Tagebücher von Anne Frank, Viktor Klemperer sowie die weniger bekannten Werke von Leon Guz und Etty Hillesum.
Wer war Etty Hillesum?
Etty Hillesum war eine junge Jüdin, deren Tagebuch erst spät entdeckt wurde und die einen tiefen Einblick in ihre spirituelle und psychologische Auseinandersetzung mit der Verfolgung gibt.
Welche Funktionen erfüllten diese Tagebücher für die Schreiber?
Sie dienten der Ich-Analyse, als Überlebenshilfe, als Chronik der Ereignisse und als Form des inneren Widerstands.
Was unterscheidet literarische von nicht-literarischen Tagebüchern?
Die Arbeit beleuchtet die Einordnung in die literarische Gattung und wie die Absicht der Veröffentlichung die Schreibweise beeinflussen kann.
- Citar trabajo
- Genka Yankova-Brust (Autor), 2008, Die Opfer schreiben - Tagebücher aus der Holocaustzeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122986