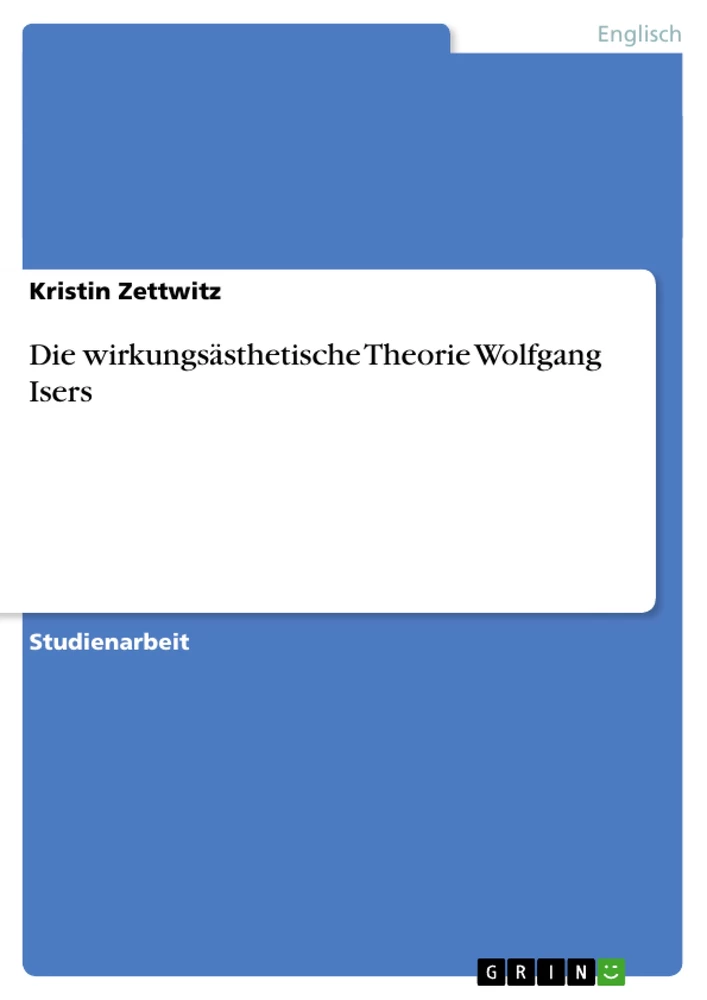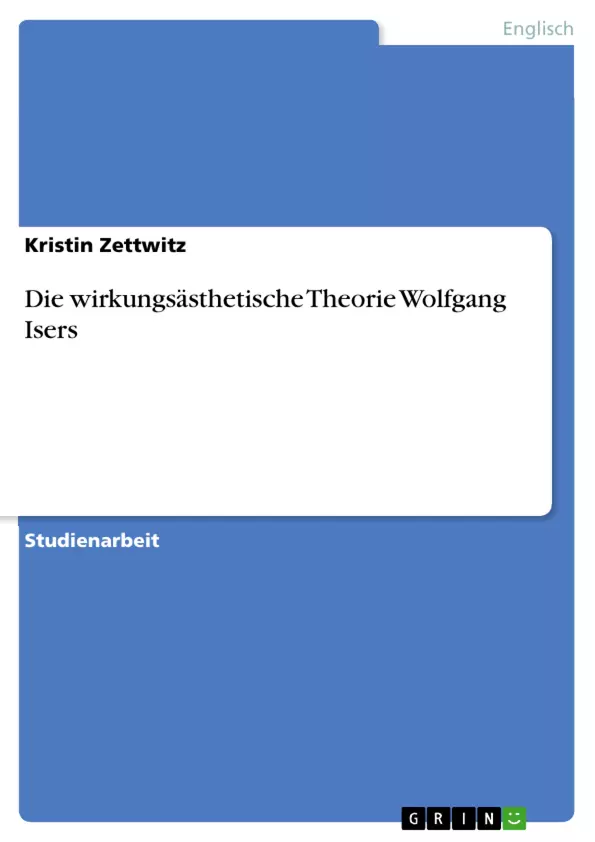Die vorliegende Arbeit möchte die von Wolfgang Iser entwickelte wirkungsästhetische Theorie skizzieren. Dabei beziehe ich mich vor allem auf die in den 1960er und 70er Jahren ausgearbeiteten, zuerst in seiner Konstanzer Antrittsvorlesung Die Appellstruktur der Texte im Jahre 1969 formulierten und in seinem 1976 erschienenen Buch Der Akt des Lesens systematisierten Grundlagen einer Theorie, die Iser bis zu seinem Tod Anfang 2007 – entsprechend der sich verändernden geistes-wissenschaftlichen Diskurslandschaft – fortwährend weiterentwickelt hat. Nach einer Einordnung in den literaturwissenschaftlichen Bezugsrahmen soll die isersche Theorie durch Fokussierung auf grundlegende Konzepte wirkungsästhetischer Theoriebildung wie Leerstelle, impliziter Leser, Textrepertoire und -strategien in ihren Grundzügen dargestellt werden. Die Arbeit wird mit einem kurzen Ausblick auf die Weiterentwicklung der Wirkungsästhetik ab den 1980er Jahren ihren Abschluss finden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- 1.1 Verortung der Wirkungstheorie im literaturwissenschaftlichen Bezugsrahmen
- Theoretische Grundlagen der iserschen Wirkungsästhetik
- 2.1 Die Leerstelle - Unbestimmtheit als Kommunikationsbedingung
- 2.2 Das Textrepertoire – Verweisfunktion des Nicht-Identischen
- 2.3 Die Textstrategien - Erfassen und Auffassen
- 2.4 Der Lesevorgang als Erfahrung des Textes
- Schlussbemerkung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit skizziert Wolfgang Isers wirkungsästhetische Theorie, vor allem basierend auf seinen Arbeiten der 1960er und 70er Jahre. Sie ordnet die Theorie in den literaturwissenschaftlichen Kontext ein und beleuchtet grundlegende Konzepte wie Leerstelle, impliziter Leser, Textrepertoire und -strategien. Abschließend gibt es einen Ausblick auf spätere Entwicklungen.
- Einordnung von Isers Wirkungstheorie in die Konstanzer Schule und den Paradigmenwechsel in der Literaturwissenschaft.
- Analyse zentraler Konzepte der iserschen Wirkungsästhetik (Leerstelle, impliziter Leser, Textrepertoire, Textstrategien).
- Beschreibung des Lesevorgangs als interaktiver Prozess zwischen Text und Leser.
- Untersuchung der Bedeutung von Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit im literarischen Text.
- Ausblick auf die Weiterentwicklung der Wirkungsästhetik.
Zusammenfassung der Kapitel
Abstract: Der Abstract stellt Wolfgang Iser und sein Werk vor, hebt seine Bedeutung für die Rezeptionstheorie hervor und kündigt die Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit an: die Darstellung seiner frühen wirkungsästhetischen Theorie im Kontext des Interplays zwischen Text und Leser, mit besonderem Fokus auf Leerstellen und anderen zentralen Konzepten.
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie Isers wirkungsästhetische Theorie als Ausgangspunkt nimmt und deren Entwicklung von den 1960er und 70er Jahren bis zu seinem Tod beschreibt. Sie kündigt die Struktur der Arbeit an: Einordnung in den literaturwissenschaftlichen Bezugsrahmen und die Darstellung der Theorie anhand zentraler Konzepte.
1.1 Verortung der Wirkungstheorie im literaturwissenschaftlichen Bezugsrahmen: Dieses Kapitel verortet Isers Wirkungstheorie im Kontext der Konstanzer Schule und ihrem kommunikationsorientierten Paradigmenwechsel. Es betont die Abkehr von der traditionellen, auf den Autor fokussierten Interpretation hin zu einer Leserorientierung und die Akzeptanz pluraler Lesarten. Isers Ansatz wird im Vergleich zu dem rezeptionsgeschichtlichen Ansatz von Hans Robert Jauß dargestellt, wobei die Unterschiede in der Forschungsfrage und der methodischen Vorgehensweise hervorgehoben werden. Der Abschnitt kritisiert die klassische Interpretationsnorm mit ihrer Suche nach der „wahren“ Bedeutung des Textes.
Schlüsselwörter
Wirkungsästhetik, Wolfgang Iser, Rezeptionstheorie, Konstanzer Schule, Leerstelle, impliziter Leser, Textrepertoire, Textstrategien, Lesevorgang, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zu: Wolfgang Isers Wirkungsästhetik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit Wolfgang Isers wirkungsästhetischer Theorie, insbesondere seinen Arbeiten aus den 1960er und 70er Jahren. Sie analysiert zentrale Konzepte wie die Leerstelle, den impliziten Leser, das Textrepertoire und die Textstrategien und ordnet Isers Theorie in den literaturwissenschaftlichen Kontext ein.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einordnung von Isers Wirkungstheorie in die Konstanzer Schule und den Paradigmenwechsel der Literaturwissenschaft. Im Mittelpunkt stehen die Analyse zentraler Konzepte der iserschen Wirkungsästhetik, die Beschreibung des Lesevorgangs als interaktiver Prozess und die Untersuchung der Bedeutung von Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit im literarischen Text. Ein Ausblick auf die Weiterentwicklung der Wirkungsästhetik rundet die Arbeit ab.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in einen Abstract, eine Einleitung, ein Kapitel zur Verortung der Wirkungstheorie im literaturwissenschaftlichen Kontext, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen der iserschen Wirkungsästhetik (mit Unterkapiteln zu Leerstelle, Textrepertoire, Textstrategien und Lesevorgang), eine Schlussbemerkung und einen Ausblick sowie ein Literaturverzeichnis. Der Abstract fasst die Arbeit kurz zusammen. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext. Kapitel 1.1 ordnet Isers Theorie in die Konstanzer Schule ein und vergleicht sie mit anderen Ansätzen. Die Kapitel zu den theoretischen Grundlagen erläutern die zentralen Konzepte von Isers Theorie detailliert.
Welche Schlüsselkonzepte der Wirkungsästhetik werden behandelt?
Zentrale Konzepte sind die Leerstelle, der implizite Leser, das Textrepertoire, die Textstrategien und der Lesevorgang als interaktiver Prozess zwischen Text und Leser. Die Arbeit untersucht, wie Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit im literarischen Text eine aktive Rolle im Rezeptionsprozess spielen.
Wie wird Isers Theorie in den Kontext der Literaturwissenschaft eingeordnet?
Die Arbeit verortet Isers Theorie im Kontext der Konstanzer Schule und ihrem kommunikationsorientierten Paradigmenwechsel. Es wird die Abkehr von der autorzentrierten Interpretation hin zu einer leserorientierten Perspektive und die Akzeptanz pluraler Lesarten hervorgehoben. Ein Vergleich mit dem rezeptionsgeschichtlichen Ansatz von Hans Robert Jauß wird durchgeführt, um die Unterschiede in der Forschungsfrage und Methodik herauszustellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Wirkungsästhetik, Wolfgang Iser, Rezeptionstheorie, Konstanzer Schule, Leerstelle, impliziter Leser, Textrepertoire, Textstrategien, Lesevorgang, Literaturwissenschaft.
- Citar trabajo
- Kristin Zettwitz (Autor), 2008, Die wirkungsästhetische Theorie Wolfgang Isers, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123003