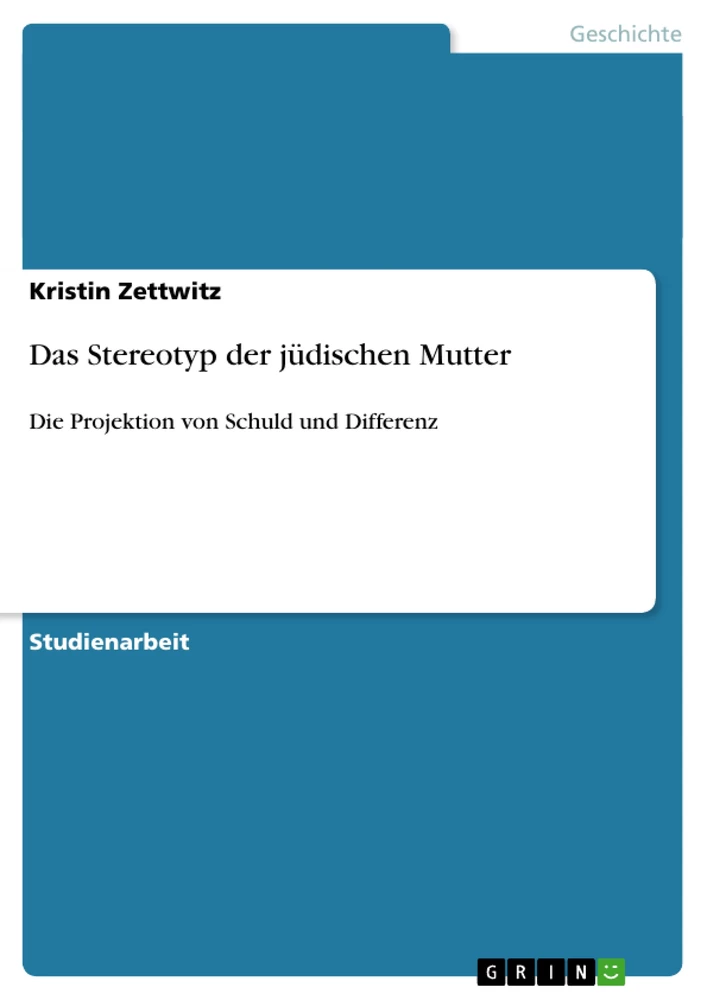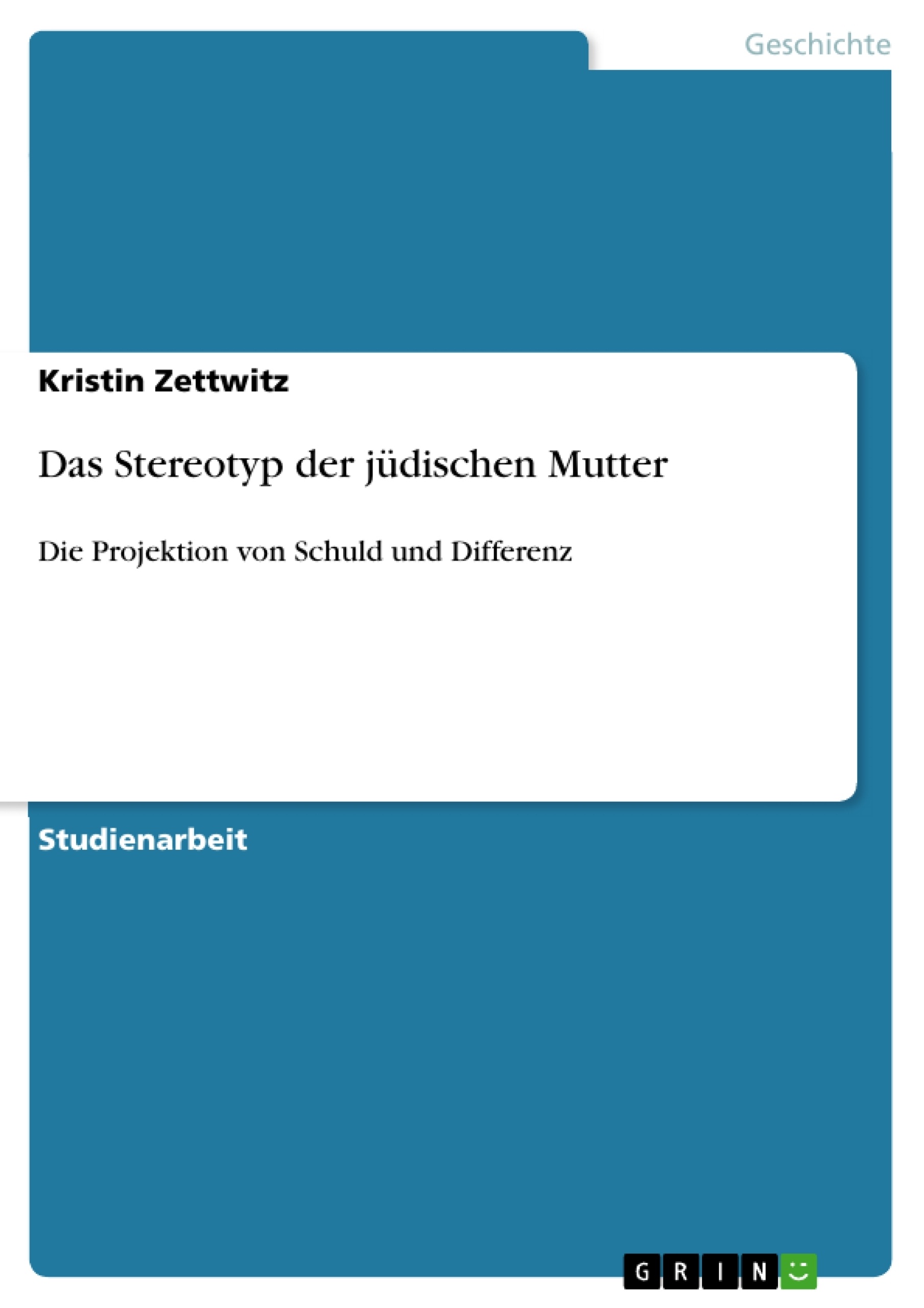„If they were wives they spent too much money. They were insatiably demanding as mothers, wanting more success and attention. They would not let their children, principally theirs sons, go into the world as ‘normal’“. Diese Arbeit soll das Stereotyp der jüdischen Mutter beleuchten, wie es nach Ende des 2. Weltkriegs in der amerikanischen Gesellschaft populär wurde und bis in die 1970er Jahre in zahlreichen Filmen, Romanen und durch Stand-Up Comedians bedient wurde. Danach sollte das Stereotyp von dem der JAP, der unverheirateten „Jewish American Princess“ abgelöst werden. Die diskursiven Entstehensprozesse und -mechanismen, die zur Popularisierung des Stereotyps der jüdischen Mutter führten, sollen im Laufe dieser Arbeit herausgearbeitet werden. Dabei soll das Stereotyp als Projektionsfläche für Ressentiments von Nichtjuden gegenüber Juden aber auch intraethnisch für Ängste der jüdischen Minderheit selbst, bedingt durch das stärkere Vordringen der Juden in die gehobene amerikanische Mittelschicht, plausibel dargestellt werden. Grundvoraussetzung für die Entstehung des Stereotyps war demnach die veränderte sozio-ökonomische Gesamtsituation der sich im Umbruch befindlichen amerikanischen Gesellschaft nach 1945 und der damit verbundene Aufstieg von Juden in gesellschaftliche und wirtschaftliche Sphären, in denen sie bislang nicht oder nur in sehr eingeschränktem Maß anzutreffen waren. Dies meint sowohl die wellenartige Ansiedlung in bis dato mehrheitlich nichtjüdischen Vororten, als auch die Etablierung in typisch mittelständigen Berufsklassen bis hin zur generellen Übernahme der Lebensstandards der Mittelschicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Stereotyp: Was kennzeichnet eine jüdische Mutter?
- Die jüdische Mutter als inter- und intraethnisches Stereotyp: Die diskursive Projektion von Schuld und Differenz
- Schlussbetrachtung und Exkurs: die Jewish American Princess (JAP)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Stereotyp der jüdischen Mutter in der amerikanischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1970er Jahre. Ziel ist es, die Entstehungsmechanismen und die Popularisierung dieses Stereotyps zu beleuchten. Dabei wird das Stereotyp als Projektionsfläche für gesellschaftliche Ressentiments und intraethnische Ängste innerhalb der jüdischen Gemeinschaft betrachtet, insbesondere im Kontext des Aufstiegs der Juden in die amerikanische Mittelschicht.
- Das Stereotyp der jüdischen Mutter als inter- und intraethnische Projektionsfläche
- Die Rolle sozioökonomischer Veränderungen nach 1945
- Die ambivalenten Charakterzüge des Stereotyps (übersteigertes Fürsorgeverhalten vs. manipulative Forderungen)
- Die Darstellung der Mutter-Kind-Beziehung, insbesondere Mutter-Sohn-Beziehung
- Die Verbreitung des Stereotyps durch Medien und Unterhaltungsindustrie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Untersuchung des Stereotyps der jüdischen Mutter in der amerikanischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1970er Jahre. Sie hebt die Bedeutung der sozioökonomischen Veränderungen und den Aufstieg der Juden in die Mittelschicht hervor, als Grundlage für die Entstehung und Verbreitung dieses Stereotyps. Die Einleitung kündigt die Analyse der Entstehungsmechanismen und die Betrachtung des Stereotyps als Projektionsfläche für gesellschaftliche und intraethnische Ängste an.
Das Stereotyp: Was kennzeichnet eine jüdische Mutter?: Dieses Kapitel charakterisiert das Stereotyp der jüdischen Mutter in der amerikanischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hebt die Unterschiede zum Stereotyp der osteuropäischen „Yiddishe Mama“ hervor und beschreibt die ambivalente Natur des Stereotyps: übersteigerte Ansprüche und Erwartungen an Kinder und Ehemann gepaart mit überschüssiger Fürsorge und manipulativen Verhaltensweisen, die Schuldgefühle erzeugen. Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird als besonders problematisch dargestellt, da die Mutter den Sohn daran hindert, zu erwachsen zu werden und sich zu emanzipieren. Das Kapitel verweist auf die Rolle der Medien und der Unterhaltungsindustrie bei der Verbreitung des Stereotyps.
Schlüsselwörter
Jüdische Mutter, Stereotyp, Amerikanische Gesellschaft, Nachkriegszeit, Sozioökonomischer Aufstieg, Schuld, Manipulation, Mutter-Kind-Beziehung, Medien, Unterhaltungsindustrie, Intraethnische Ängste, Ressentiments.
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Das Stereotyp der jüdischen Mutter in der amerikanischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Stereotyp der jüdischen Mutter in der amerikanischen Gesellschaft von nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1970er Jahre. Sie beleuchtet die Entstehungsmechanismen und die Popularisierung dieses Stereotyps und betrachtet es als Projektionsfläche für gesellschaftliche Ressentiments und intraethnische Ängste innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, besonders im Kontext des Aufstiegs der Juden in die Mittelschicht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Punkte: das Stereotyp als inter- und intraethnische Projektionsfläche; die Rolle sozioökonomischer Veränderungen nach 1945; die ambivalenten Charakterzüge des Stereotyps (übersteigertes Fürsorgeverhalten vs. manipulative Forderungen); die Darstellung der Mutter-Kind-Beziehung, insbesondere der Mutter-Sohn-Beziehung; und die Verbreitung des Stereotyps durch Medien und Unterhaltungsindustrie.
Wie wird das Stereotyp der jüdischen Mutter charakterisiert?
Das Stereotyp wird als ambivalent beschrieben: übersteigerte Ansprüche und Erwartungen an Kinder und Ehemann werden mit übersteigerter Fürsorge und manipulativen Verhaltensweisen kombiniert, die Schuldgefühle erzeugen. Die Mutter-Sohn-Beziehung wird als besonders problematisch dargestellt, da die Mutter den Sohn daran hindert, zu erwachsen zu werden und sich zu emanzipieren. Unterschiede zum Stereotyp der osteuropäischen „Yiddishe Mama“ werden hervorgehoben.
Welche Rolle spielen sozioökonomische Veränderungen?
Der sozioökonomische Aufstieg der Juden nach dem Zweiten Weltkrieg wird als wichtiger Kontext für die Entstehung und Verbreitung des Stereotyps betrachtet. Die Veränderungen in der Gesellschaft und die damit verbundenen Ängste und Ressentiments spiegeln sich in diesem Stereotyp wider.
Welche Rolle spielen Medien und Unterhaltungsindustrie?
Medien und Unterhaltungsindustrie werden als wichtige Verbreiter des Stereotyps identifiziert. Sie tragen maßgeblich zur Popularisierung und Verbreitung der Klischees bei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jüdische Mutter, Stereotyp, Amerikanische Gesellschaft, Nachkriegszeit, Sozioökonomischer Aufstieg, Schuld, Manipulation, Mutter-Kind-Beziehung, Medien, Unterhaltungsindustrie, Intraethnische Ängste, Ressentiments.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Charakterisierung des Stereotyps der jüdischen Mutter, und eine Schlussbetrachtung mit einem Exkurs zur "Jewish American Princess (JAP)".
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Entstehungsmechanismen und die Popularisierung des Stereotyps der jüdischen Mutter zu beleuchten und seine Funktion als Projektionsfläche für gesellschaftliche und intraethnische Ängste zu analysieren.
- Citar trabajo
- Kristin Zettwitz (Autor), 2008, Das Stereotyp der jüdischen Mutter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123004