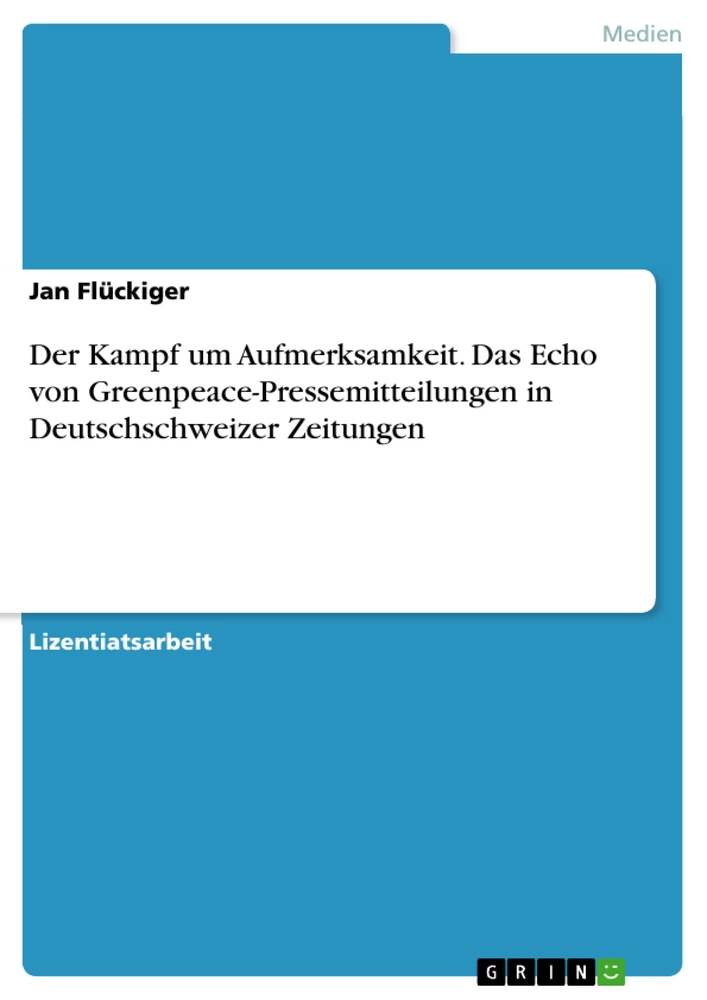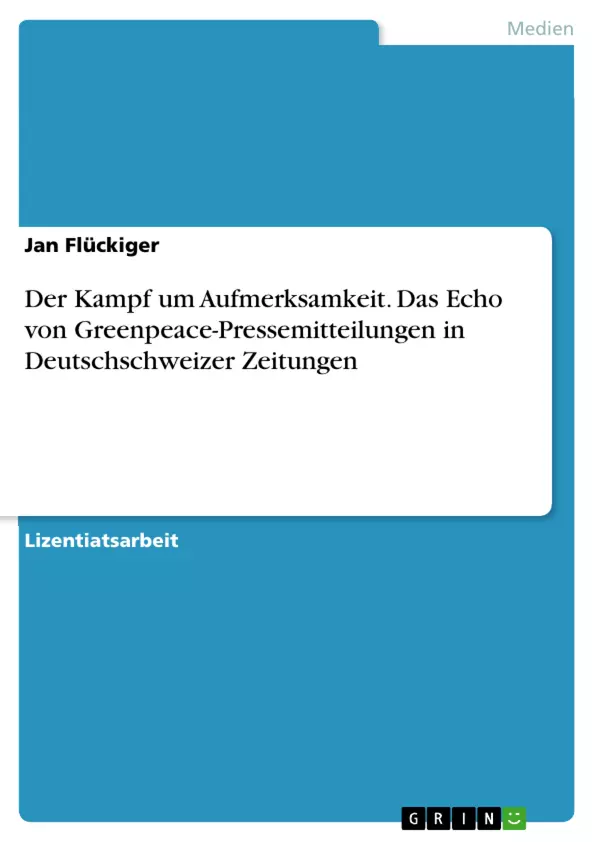Periphere politische Akteure wie Greenpeace, die nicht für die Besetzung von politischen Ämtern durch (Volks-)Wahlen kandidieren und somit nicht zum Zentrum des politischen Systems gehören, sind zur Durchsetzung ihrer Interessen auf die Mobilisierung von Öffentlichkeit angewiesen. In modernen Gesellschaften wird Öffentlichkeit vermehrt von Massenmedien hergestellt und reproduziert. Daher interessiert in dieser Arbeit die Frage, inwiefern ein Akteur wie Greenpeace in der Lage ist, Aufmerksamkeit für sich und seine Anliegen in den Massenmedien zu erzeugen.
Für die Verteilung von öffentlicher Aufmerksamkeit in einer modernen Gesellschaft ist in einem großen Masse das System der Massenmedien zuständig. Greenpeace verfolgt gezielt Strategien wie zum Beispiel das Inszenieren von Ereignissen (mehr oder weniger spektakuläre Aktionen, Pressekonferenzen), um die Aufmerksamkeit der Medien und in der Folge der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Die Aufmerksamkeit für die Organisation Greenpeace alleine garantiert jedoch noch keine Aufmerksamkeit für ihre Anliegen. Damit befindet sich Greenpeace auf einer Gratwanderung zwischen der reinen Erzeugung von Aufmerksamkeit und der Vermittlung von Inhalten.
Für die Publizistikwissenschaft und für diese Arbeit stellen sich die folgenden Fragen: Lässt sich das System der Massenmedien vom Akteur Greenpeace in dem Sinne irritieren, dass es seine Anliegen aufgreift und veröffentlicht? Inwiefern ist das System der Massenmedien offen, inwiefern verhält es sich selektiv? Lassen sich an der Art und Weise der Veröffentlichung Entscheidungsprogramme (konkret die Berücksichtigung von Nachrichtenwerten) feststellen? Gelingt es umgekehrt Greenpeace, Aufmerksamkeit für sich und für seine Anliegen zu erzeugen? Erweist sich eine Anpassung an das System der Massenmedien (im Sinne einer Adaption an erwartete Entscheidungsprämissen) als begünstigend für eine Veröffentlichung? Welche Rolle spielen insbesondere von Greenpeace inszenierte Ereignisse? Gibt es themenspezifische, ereignisabhängige oder sonstige charakteristische Eigenschaften, welche die mediale Aufmerksamkeit beeinflussen? Wie steht es insbesondere mit der Aufmerksamkeit für spektakuläre Aktionen und konkrete Anliegen? Wie werden einzelne Anliegen in den Medien erwähnt und wie verändern sich deren Gewichte in der Berichterstattung?
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. Theoretischer Hintergrund und Forschungsinteresse
- 1.2. Fragestellungen
- 1.3. Methodisches Vorgehen
- 1.4. Ziele
- 2. THEORIE UND STAND DER FORSCHUNG
- 2.1. INTERMEDIÄRES SYSTEM DER POLITIKVERMITTLUNG
- 2.1.1. Die Phasen im politischen Prozess
- 2.2. ÖFFENTLICHKEIT
- 2.2.1. Öffentlichkeit als Legitimationsinstanz und Artikulationsmedium
- 2.2.2. Funktionale Differenzierung
- 2.2.3. Öffentlichkeit als Marktplatz für Aufmerksamkeit
- 2.2.4. Funktionen der Öffentlichkeit für das politische System
- 2.2.5. Strukturen und Merkmale der Öffentlichkeit - Öffentlichkeitsebenen
- 2.3. SYSTEM DER MASSENMEDIEN
- 2.3.1. Funktionen und Leistungen des Systems der Massenmedien
- 2.3.2. Veröffentlichung als autopoietischer Prozess?
- 2.3.3. Publizität als thematisch geformte Aufmerksamkeit
- 2.4. DER AKTEUR GREENPEACE
- 2.4.1. Rechtliche Situation und Selbstdarstellung von Greenpeace
- 2.4.2. Greenpeace als kollektiver Akteur der Interessenartikulation
- 2.4.3. Mobilisierung von Öffentlichkeit als zentrale Ressource
- 2.4.4. Kampagnen und Aktionen als Mittel zur Erzeugung von Aufmerksamkeit
- 2.4.5. Vermittlung von Inhalten als Teilziel der Pressearbeit von Greenpeace
- 2.5. ZONE DER INTERPENETRATION UND DER INPUT-OUTPUT-PROZESS
- 2.5.1. Zone der Interpenetration
- 2.5.2. Der Input-Output Prozess als Prozess der Veröffentlichung
- 2.6. ENTSCHEIDUNGSPROGRAMME UND NACHRICHTENWERTE
- 2.6.1. Entscheidungsprogramme
- 2.6.2. Nachrichtenwertforschung
- 2.6.3. Nachrichtenwerte für diese Studie
- 2.7. VERWENDETE NACHRICHTENDIMENSIONEN UND –WERTFAKTOREN
- 2.7.1. Probleme
- 2.7.2. Schadensdimensionen
- 2.7.3. Vorwürfe und beschuldigte Akteure
- 2.7.4. Forderungen und Adressaten
- 2.7.5. Ereignisse
- 2.7.6. Gegendarstellungen
- 2.8. VERGLEICHBARE INPUT-OUTPUT-STUDIEN
- 2.8.1. Input-Output-Studien zu diversen Themen und Akteuren
- 2.8.2. Input-Output-Studien zu Greenpeace
- 3. METHODE
- 3.1. METHODIK DER STUDIE
- 3.1.1. Die Input-Output-Analyse
- 3.1.2. Vorgehen für diese Studie
- 3.2. FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN
- 3.2.1. Beschreibung der Grundgesamtheit
- 3.2.2. Fragestellungen und Hypothesen zur Grundgesamtheit
- 3.2.3. Fragestellungen und Hypothesen zur Stichprobe
- 3.3. FORSCHUNGSDESIGN UND STICHPROBE
- 3.3.1. Forschungsschritt I: Analyse der Grundgesamtheit
- 3.3.2. Forschungsschritt II: Ziehung der Stichprobe
- 3.4. MESSDIMENSIONEN UND OPERATIONALISIERUNG
- 3.4.1. Messdimensionen und Operationalisierung für die Grundgesamtheit
- 3.4.2. Messdimensionen und Operationalisierung für die Stichprobe
- 4. RESULTATE FÜR DIE GRUNDGESAMTHEIT
- 4.1. ÜBERBLICK ÜBER DIE GRUNDGESAMTHEIT
- 4.1.1. Zeitlicher Überblick
- 4.1.2. Bezüge der Berichterstattung über Greenpeace
- 4.1.3. Themenanteile bei Input und Output
- 4.1.4. Selektionsquotienten und Themenverteilung der Publikationen
- 4.2. RESONANZANALYSE
- 4.2.1. Resonanz der einzelnen Pressemitteilungen
- 4.2.2. Einfluss von Aktionen auf die Resonanz
- 4.2.3. Einfluss von Themen auf die Resonanz
- 4.3. ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE FÜR DIE GRUNDGESAMTHEIT
- 5. RESULTATE FÜR DIE STICHPROBE
- 5.1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES OUTPUTS
- 5.2. EINFLUSS DER NACHRICHTENDIMENSIONEN UND -WERTE AUF DIE RESONANZ
- 5.2.1. Ereignistyp
- 5.2.2. Konfliktdimension
- 5.2.3. Problemdimension
- 5.2.4. Schadensdimension
- 5.2.5 Vorwürfe
- 5.2.6. Beschuldigte Akteure
- 5.2.7. Forderungen
- 5.2.8. Adressierte Akteure
- 5.2.9. Zusammenfassung: Einflüsse auf die Resonanz
- 5.3. AUFHÄNGER UND ANTEIL DER NACHRICHTENDIMENSIONEN
- 5.3.1. Aufhänger
- 5.3.2. Anteil der Nachrichtendimensionen
- 5.4. ERWÄHNUNG DER NACHRICHTENDIMENSIONEN IM OUTPUT
- 5.4.1. Erwähnung des Hauptproblems
- 5.4.2. Erwähnung der Vorwürfe und beschuldigten Akteure
- 5.4.3. Erwähnung der Forderungen und Adressaten
- 5.4.4. Zusammenfassung: Anteile und Erwähnung der Nachrichtendimensionen
- Der Einfluss von Greenpeace als Akteur der öffentlichen Meinungsbildung
- Die Rolle der Massenmedien in der Politikvermittlung
- Analyse des Input-Output-Prozesses von Pressemitteilungen und Medienberichterstattung
- Die Bedeutung von Nachrichtenwerten für die Medienberichterstattung
- Resonanzanalyse der Greenpeace-Pressemitteilungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Lizenziatsarbeit untersucht den Einfluss von Greenpeace-Pressemitteilungen auf die Berichterstattung in deutschschweizerischen Zeitungen zwischen 1999 und 2004. Die Arbeit analysiert, wie die Medien die Botschaften von Greenpeace aufnehmen und weiterverarbeiten.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein, beschreibt den theoretischen Hintergrund und die Forschungsfragen. Kapitel 2 beleuchtet die relevanten Theorien zum intermediären System der Politikvermittlung, der Öffentlichkeit, den Massenmedien und Greenpeace als Akteur. Es werden verschiedene Nachrichtenwerte und Dimensionen definiert. Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Studie, die auf einer Input-Output-Analyse basiert, und erläutert das Vorgehen. Die Kapitel 4 und 5 präsentieren die Ergebnisse der Analyse der Grundgesamtheit und der Stichprobe, wobei der Fokus auf der Resonanz der Pressemitteilungen liegt und der Einfluss verschiedener Faktoren untersucht wird.
Schlüsselwörter
Greenpeace, Medienberichterstattung, Politikvermittlung, Input-Output-Analyse, Nachrichtenwert, Öffentlichkeit, Resonanz, Massenmedien, Interessenartikulation.
Häufig gestellte Fragen
Wie erzeugt Greenpeace Aufmerksamkeit in den Massenmedien?
Greenpeace nutzt gezielte Strategien wie spektakuläre Aktionen, Pressekonferenzen und inszenierte Ereignisse, um die Aufmerksamkeit der Medien und damit der Öffentlichkeit zu gewinnen.
Was ist der Input-Output-Prozess der Medienarbeit?
Der Prozess beschreibt den Weg von der Pressemitteilung eines Akteurs (Input) zur tatsächlichen Berichterstattung in den Zeitungen (Output) und analysiert die Selektionsmechanismen der Redaktionen.
Welche Rolle spielen Nachrichtenwerte für Greenpeace?
Damit Themen veröffentlicht werden, müssen sie Nachrichtenwerte wie Konflikt, Sensation oder Betroffenheit erfüllen. Greenpeace passt seine Aktionen oft an diese Erwartungen des Mediensystems an.
Gelingt Greenpeace die Vermittlung von Inhalten über Aktionen?
Dies ist eine Gratwanderung: Während Aktionen hohe Aufmerksamkeit garantieren, ist die Vermittlung der dahinterstehenden komplexen Umweltanliegen in der Berichterstattung oft schwieriger.
Warum ist Greenpeace auf Öffentlichkeit angewiesen?
Als peripherer politischer Akteur ohne parlamentarische Macht ist Greenpeace zur Durchsetzung seiner Interessen zwingend auf die Mobilisierung der öffentlichen Meinung angewiesen.
- Citar trabajo
- Jan Flückiger (Autor), 2005, Der Kampf um Aufmerksamkeit. Das Echo von Greenpeace-Pressemitteilungen in Deutschschweizer Zeitungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123045