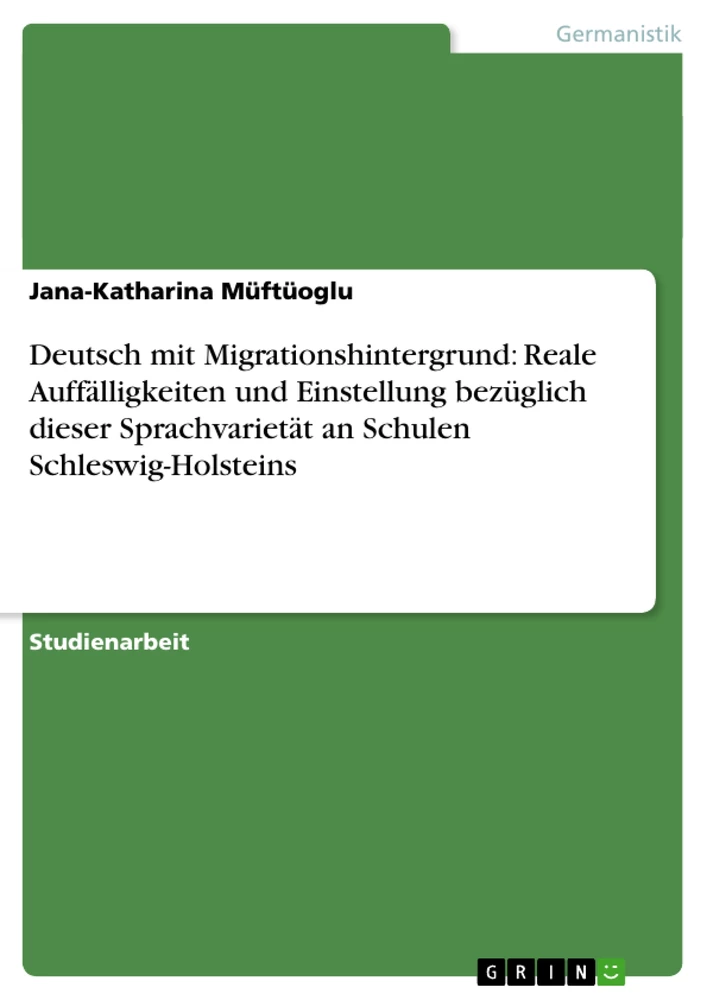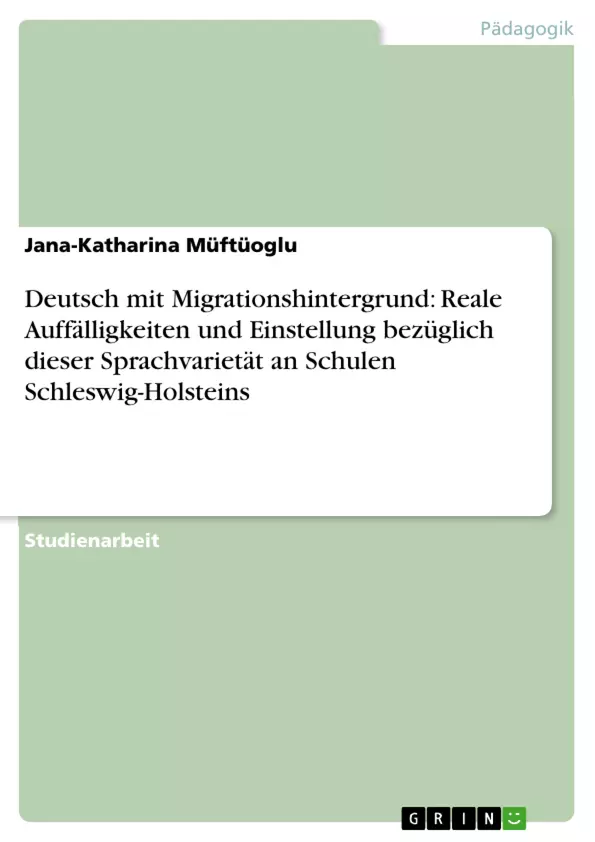Die vorliegende Seminararbeit schließt an ein Hauptseminar im Wintersemester 2006/07 an, das sich mit Sprachvarietäten im Unterricht befasste. Das Seminar „Schüler, Lehrer, Sprachvarietäten“ widmete sich zunächst der Studie „Konfliktfeld Dialekt: das Verhältnis von Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern zu Sprache und ihren regionalen Varietäten“ von Rupert Hochholzer (2004), die sich mit Sprachvarietäten in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrheinwestfalen und Bayern in Bezug auf Sprechereinstellung, Lehrereinstellung und schulische Kommunikation befasst. Hierbei wurden die Kategorienbildung, die Korrelationstabellen und die gesamte Vorgehensweise Hochholzers kritisch untersucht. Anschließend entwarf das Seminar einen Fragebogen, der darauf abzielte die Präsenz und Problematik von drei verschiedenen Sprachvarietäten, nämlich "niederdeutscher Sprachgebrauch", "migrationgeprägter Sprachgebrauch" und "Jugendsprache" in Schulen Schleswig-Holsteins zu untersuchen. Hierbei wurde der Fokus auf mögliche Kommunikationsprobleme und Lernschwierigkeiten im Zusammenhang mit diesen, und die Einstellungen der Lehrer bezüglich dieser Sprachvarietäten gelegt. Die Konzeption des Fragebogens mündete in einer anonymen Umfrage, bei der 85 Lehrer von staatlichen Schulen in Schleswig-Holstein hinsichtlich eventueller Sprachvarietäten im Unterricht befragt wurden. Ich lege in dieser Arbeit den Fokus meiner Analyse auf die migrationbedingten Sprachvarietäten und die möglichen Probleme, die hieraus resultieren können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 2.1 Migration
- 2.2 Einstellung
- 3. Aktueller Forschungsstand/Empirie
- 3.1 PISA
- 3.2 Migration und Schule
- 4. Beschreibung der Untersuchung
- 5. Durchführung
- 6. Ergebnisse
- 6.1 Teil I
- 6.2 Teil II
- 6.3 Teil III
- 6.4 Teil IV
- 7. Fazit
- 8. Anhang
- 9. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die im Wintersemester 2006/07 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchgeführte Studie zu migrationgeprägten Sprachvarietäten im Unterricht Schleswig-Holsteins. Ziel ist die Analyse der Ergebnisse bezüglich möglicher Kommunikationsprobleme und Lernschwierigkeiten, sowie der Einstellungen von Lehrkräften gegenüber diesen Varietäten. Der Fokus liegt dabei auf den migrationbedingten Sprachvarietäten und den daraus resultierenden Herausforderungen.
- Analyse migrationgeprägter Sprachvarietäten im Schulunterricht
- Untersuchung möglicher Kommunikationsprobleme und Lernschwierigkeiten
- Erforschung der Einstellungen von Lehrkräften zu migrationgeprägten Sprachvarietäten
- Bewertung der Methodik der durchgeführten Studie
- Einordnung der Ergebnisse in den aktuellen Forschungsstand
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit basiert auf einem Seminar an der CAU Kiel, welches sich mit Sprachvarietäten im Unterricht auseinandersetzte und kritisch die Studie von Hochholzer (2004) analysierte. Anschließend wurde ein Fragebogen entwickelt und eine Umfrage unter 85 Lehrkräften in Schleswig-Holstein durchgeführt, um die Präsenz und Problematik verschiedener Sprachvarietäten (niederdeutsch, migrationgeprägt, Jugendsprache) zu untersuchen. Diese Arbeit konzentriert sich speziell auf migrationbedingte Sprachvarietäten und die damit verbundenen Herausforderungen.
2. Begriffsklärung: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie „Migration“ und „Einstellungen“. „Migration“ wird als dauerhafter Wohnortwechsel definiert, basierend auf den Definitionen von Parnwell (1993) und Treibel (1990), sowie der Zusammenfassung der PISA-Studie (2003). „Einstellungen“ werden als psychologische Prozesse beschrieben, die zwischen Reiz und Reaktion vermitteln und auf Basis des Mehrkomponentenansatzes (kognitiv, affektiv-evaluativ, konativ) und der vier Funktionen von Einstellungen nach Hochholzer (2004) (instrumentelle Nützlichkeitsfunktion, kognitive Orientierungsfunktion, Wertausdrucksfunktion, Ich-Verteidigungsfunktion) erläutert.
3. Aktueller Forschungsstand/Empirie: Dieser Abschnitt beleuchtet den aktuellen Forschungsstand, insbesondere im Kontext der PISA-Studien (2000 und 2003) und ihrer Ergebnisse bezüglich sozialer Ungleichheit. Es wird die Problematik der direkten Befragung von Lehrkräften zu Einstellungen gegenüber migrationgeprägtem Deutsch oder Jugendsprache aufgrund der Sensibilität des Themas diskutiert. Die Studie verwendet daher indirekte Methoden zur Erfassung von Einstellungen.
4. Beschreibung der Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die durchgeführte Untersuchung, einschließlich der Methodik und der angewandten Forschungsinstrumente. Die genaue Vorgehensweise bei der Datenerhebung und -auswertung wird erläutert.
5. Durchführung: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Durchführung der Studie, einschließlich der Rekrutierung der Teilnehmer, der Durchführung der Umfrage und der anschließenden Datenaufbereitung.
6. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie, aufgeteilt in vier Teile (6.1 - 6.4). Die Ergebnisse werden detailliert analysiert und interpretiert. Es ist wichtig zu betonen, dass die einzelnen Unterkapitel (6.1 bis 6.4) in diesem Überblick nicht einzeln zusammengefasst werden, sondern die Ergebnisse des gesamten Kapitels 6 in einem kohärenten Überblick wiedergegeben sind.
Schlüsselwörter
Migration, Sprachvarietäten, Deutsch als Zweitsprache, Schulunterricht, Einstellungen von Lehrkräften, Kommunikationsprobleme, Lernschwierigkeiten, PISA-Studie, Schleswig-Holstein, empirische Untersuchung, Fragebogen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Migrationgeprägte Sprachvarietäten im Schulunterricht Schleswig-Holsteins
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert eine Studie aus dem Wintersemester 2006/07 der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die sich mit migrationgeprägten Sprachvarietäten im Unterricht Schleswig-Holsteins befasst. Im Mittelpunkt stehen mögliche Kommunikationsprobleme und Lernschwierigkeiten, die daraus resultieren, sowie die Einstellungen von Lehrkräften gegenüber diesen Varietäten.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Begriffsklärungen (Migration und Einstellungen), eine Darstellung des aktuellen Forschungsstands (inkl. PISA-Studien), die Beschreibung der durchgeführten Untersuchung, die Darstellung der Durchführung, die Präsentation und Analyse der Ergebnisse (in vier Teilen), ein Fazit, einen Anhang und ein Literaturverzeichnis. Besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse migrationgeprägter Sprachvarietäten und den daraus resultierenden Herausforderungen im Unterricht.
Welche Methodik wurde in der zugrundeliegenden Studie angewendet?
Die Kieler Studie, auf der die Seminararbeit basiert, verwendete einen Fragebogen, der an 85 Lehrkräfte in Schleswig-Holstein verteilt wurde. Die genaue Methodik der Datenerhebung und -auswertung wird in der Seminararbeit detailliert beschrieben. Da die Befragung von Lehrkräften zu Einstellungen gegenüber migrationgeprägtem Deutsch sensibel ist, wurden indirekte Methoden zur Erfassung der Einstellungen verwendet.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Studie sind in vier Teile gegliedert (6.1 - 6.4) und werden in der Seminararbeit detailliert analysiert und interpretiert. Ein zusammenfassender Überblick über alle vier Teile der Ergebnisse wird in der Seminararbeit gegeben, jedoch werden die einzelnen Unterkapitel nicht separat zusammengefasst.
Wie werden die Begriffe „Migration“ und „Einstellungen“ definiert?
„Migration“ wird als dauerhafter Wohnortwechsel definiert, basierend auf den Definitionen von Parnwell (1993) und Treibel (1990) sowie der Zusammenfassung der PISA-Studie (2003). „Einstellungen“ werden als psychologische Prozesse beschrieben, die zwischen Reiz und Reaktion vermitteln, basierend auf dem Mehrkomponentenansatz (kognitiv, affektiv-evaluativ, konativ) und den vier Funktionen von Einstellungen nach Hochholzer (2004).
Welche Rolle spielen die PISA-Studien in dieser Arbeit?
Die PISA-Studien (2000 und 2003) liefern einen wichtigen Kontext für den aktuellen Forschungsstand, insbesondere hinsichtlich sozialer Ungleichheit im Bildungssystem. Ihre Ergebnisse werden zur Einordnung der Ergebnisse der Kieler Studie herangezogen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Migration, Sprachvarietäten, Deutsch als Zweitsprache, Schulunterricht, Einstellungen von Lehrkräften, Kommunikationsprobleme, Lernschwierigkeiten, PISA-Studie, Schleswig-Holstein, empirische Untersuchung, Fragebogen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die vollständigen Ergebnisse und die detaillierte Methodik der Studie finden sich in der vollständigen Seminararbeit, einschließlich des Anhangs und des Literaturverzeichnisses. Die Arbeit analysiert kritisch auch die Studie von Hochholzer (2004).
- Quote paper
- Jana-Katharina Müftüoglu (Author), 2006, Deutsch mit Migrationshintergrund: Reale Auffälligkeiten und Einstellung bezüglich dieser Sprachvarietät an Schulen Schleswig-Holsteins, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123159