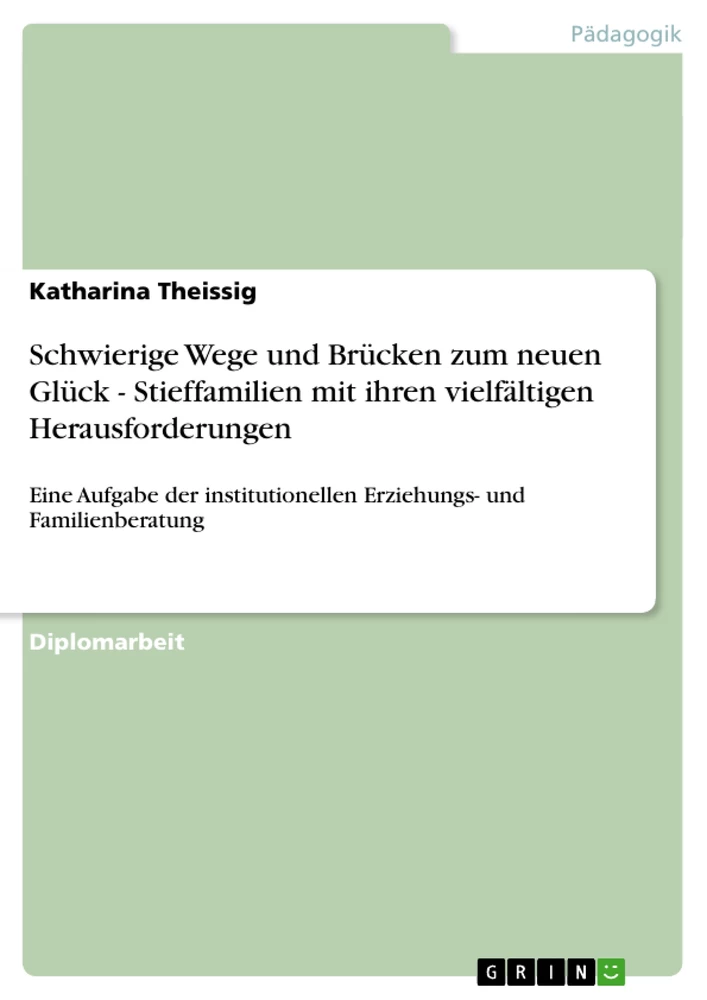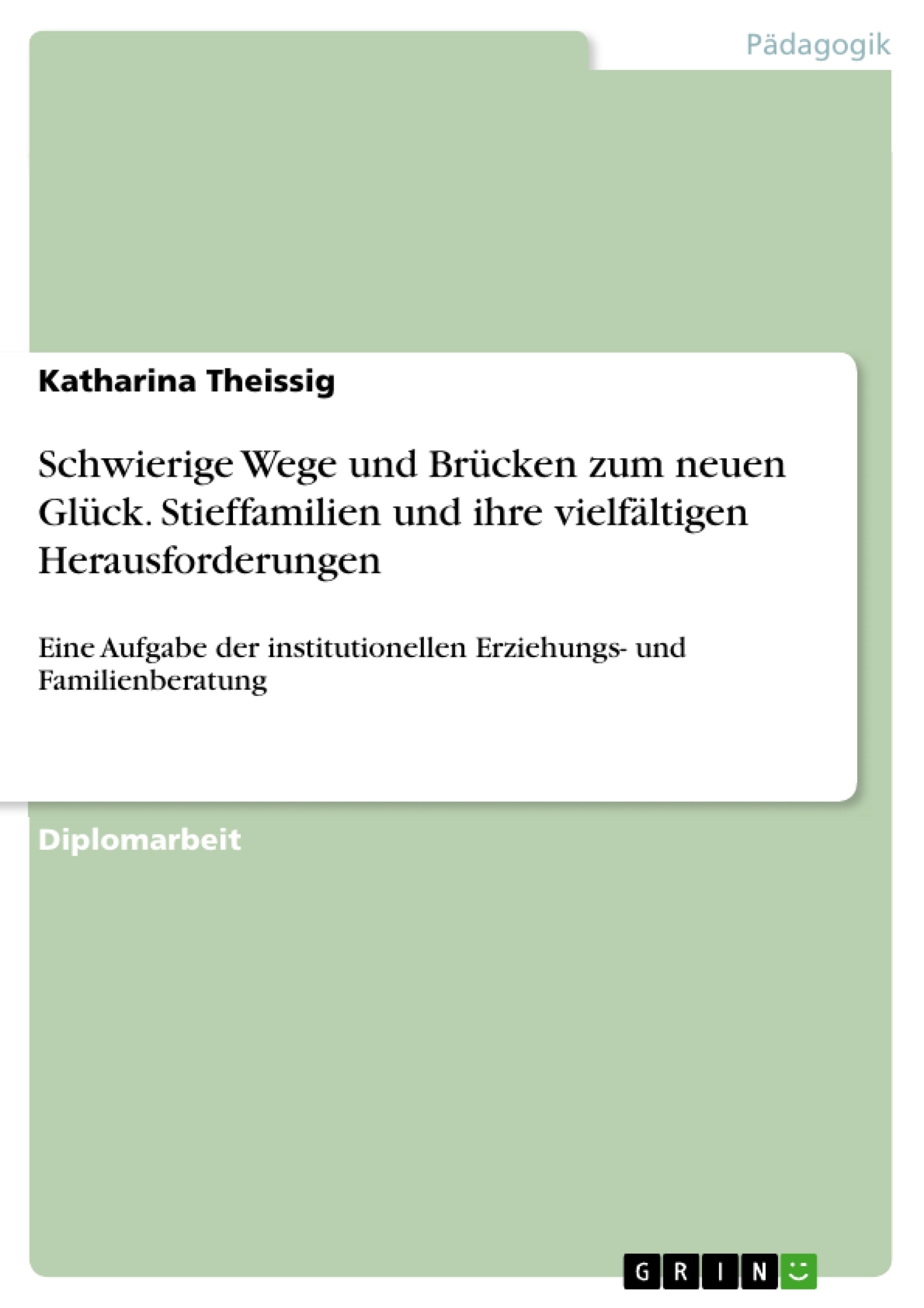In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Ehen, die durch Scheidung beendet werden, stark
angestiegen: Wurde Anfang der 1960er Jahre noch jede zehnte Ehe in Deutschland
geschieden, so endete in den 1970er Jahren schon fast jede vierte Ehe durch Scheidung. Heute
wird annähernd jede zweite Ehe geschieden (Stand 2006: 373.681 Eheschließungen, 190.928
Ehescheidungen). Von der Scheidung ihrer Eltern waren 2006 rund 150.000 Kinder betroffen
(Statistisches Bundesamt, 2008a, 8). Verschiedene Autoren deuten diese Entwicklung als
einen Zerfall der Familie als Institution (z.B. König, 1979; Tyrell, 1988). Tatsächlich aber
geht die Mehrheit der Geschiedenen nach einer gewissen Zeit wieder eine neue Partnerschaft
ein. Somit deuten die steigenden Scheidungsziffern zwar das Ende vom Bild der
Unauflöslichkeit der Ehe an, die hohe Wiederverheiratungsrate belegt jedoch, dass die
Familie als Lebensform nicht an Bedeutung verloren hat. Die Familie des 21. Jahrhunderts
präsentiert sich jedoch in äußerst vielfältigen Formen: Neben der modernen Kernfamilie
bestehen nicht-eheliche Lebensgemeinschaften mit und ohne Kindern, Scheidungsfamilien,
Ein-Eltern-Familien oder eben Stieffamilien.
Das „neue Glück“, also das Zusammenleben mit einem neuen Partner, stellt einen Neuanfang,
einen zweiten Versuch dar, welcher jedoch nicht unbelastet von der Vergangenheit beider
Partner ist. Anders als beim Tod des früheren Partners wird nach einer Trennung oder
Scheidung das frühere Familiensystem nicht aufgelöst, sondern reorganisiert. Dieser
Reorganisationsprozess ist als Herausforderung für alle Familienmitglieder zu begreifen, denn
sie müssen vielfältige Wandlungs-, Veränderungs- und Anpassungsleistungen, so genannte
Entwicklungsaufgaben (Oerter/Montada) bewältigen. Wie Untersuchungen gezeigt haben, ist
der „zweite Anlauf zum Glück“ (Dahm-Weitnauer, 1988, 72) stärker vom Scheitern bedroht
als die erste Ehe. Doch was macht das Zusammenleben als Stieffamilie so schwierig?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Stieffamilie
- 2.1 Definitionen von Stieffamilie
- 2.2 Besonderheiten von Stieffamilien
- 2.2.1 Merkmale von Stieffamilien
- 2.2.2 Typen von Stieffamilien
- 2.2.3 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse zu den Besonderheiten von Stieffamilien
- 2.3 Die Lebensorganisation von Stieffamilien
- 2.3.1 Ausgewählte Problemfelder in Stieffamilien
- 2.3.1.1 Problemfelder im Mikrosystem
- 2.3.1.2 Problemfelder im Mesosystem
- 2.3.1.3 Problemfelder im Exosystem
- 2.3.1.4 Problemfelder im Makrosystem
- 2.3.2 Dysfunktionale Bewältigungsstrategien in Stieffamilien
- 2.3.3 Erste Schlussfolgerungen aus den Problemfeldern und Bewältigungsstrategien
- 3 Erziehungs- und Familienberatung - Allgemeine Darstellung unter spezifischer Berücksichtung von Stieffamilien
- 3.1 Entwicklungslinien und gesellschaftspolitische Bezüge der Erziehungs- und Familienberatung
- 3.2 Aktuelles Erscheinungsbild der Familie und der Stellenwert der Erziehungs- und Familienberatung
- 3.3 Aktuelles Aufgabenprofil, Ziele und Grundprinzipien der Erziehungs- und Familienberatung
- 3.4 Standortbestimmung der Erziehungs- und Familienberatung
- 3.5 Erziehungs- und Familienberatung in der Praxis
- 3.5.1 Einrichtungen und Trägerschaft
- 3.5.2 Finanzielle und personelle Ausstattung
- 3.5.3 Zielgruppen, Themen und Ansatzpunkte der Erziehungs- und Familienberatung
- 3.5.4 Die Beratung in der Erziehungs- und Familienberatung
- 3.5.4.1 Die vier Grundorientierungen der Erziehungs- und Familienberatung
- 3.5.4.2 Lebenswelt- und Alltagsorientierung als Rahmenkonzept der Erziehungs- und Familienberatung
- 3.5.4.3 Beratung von Stieffamilien
- 3.6 Erziehungs- und Familienberatung mit Stieffamilien – ein Fazit
- 4 Die Arbeit mit Stieffamilien – eine empirische Untersuchung von Münchner Einrichtungen der Erziehungs- und Familienberatung
- 4.1 Methodik der Erhebung
- 4.1.1 InterviewpartnerInnen
- 4.1.2 Beschreibung der Durchführung/ Untersuchungsbedingungen
- 4.1.2.1 Forschungsmethode und Erhebungsinstrument
- 4.1.2.2 Interviewleitfaden
- 4.1.2.3 Pretest
- 4.1.2.4 Durchführung der Interviews
- 4.1.2.5 Transkriptionsvorgehen
- 4.1.2.6 Auswertungsverfahren
- 4.2 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- 4.2.1 Kategorie „Unterstützungsangebote für Stieffamilien“
- 4.2.2 Kategorie „Erfahrungen in der Beratung von Stieffamilien“
- 4.2.3 Kategorie „Unterstützungsmöglichkeiten für Stieffamilien“
- 4.2.4 Kategorie „Relevante Aspekte in der Arbeit mit Stieffamilien“
- 4.3 Diskussion der Ergebnisse
- 4.4 Überprüfung der Hypothesen
- 5 Zusammenfassung und Forschungsausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Herausforderungen, denen Stieffamilien gegenüberstehen, und die Rolle der Erziehungs- und Familienberatung in diesem Kontext. Die Arbeit analysiert die Besonderheiten von Stieffamilien, identifiziert relevante Problemfelder und beleuchtet die praktischen Ansätze der Beratung.
- Definition und Charakteristika von Stieffamilien
- Problemfelder in Stieffamilien auf verschiedenen Systemebenen (Mikro-, Meso-, Exo-, Makrosystem)
- Rollen und Aufgaben der Erziehungs- und Familienberatung bei der Unterstützung von Stieffamilien
- Empirische Untersuchung der Beratungspraxis in Bezug auf Stieffamilien
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Beratung von Stieffamilien
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beleuchtet den Anstieg der Scheidungsraten und die daraus resultierende Zunahme von Stieffamilien. Kapitel 2 definiert den Begriff der Stieffamilie, beschreibt deren Besonderheiten und analysiert verschiedene Problemfelder im Leben von Stieffamilien. Kapitel 3 befasst sich mit der Erziehungs- und Familienberatung, ihren Zielen und Methoden, mit besonderem Fokus auf die Arbeit mit Stieffamilien. Kapitel 4 präsentiert eine empirische Untersuchung über die Erfahrungen von Münchner Einrichtungen der Erziehungs- und Familienberatung in der Arbeit mit Stieffamilien.
Schlüsselwörter
Stieffamilie, Erziehungs- und Familienberatung, Familientherapie, Scheidung, Patchworkfamilie, Problemfelder, Unterstützung, Beratungspraxis, empirische Untersuchung, Entwicklungsaufgaben.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert eine Stieffamilie?
Eine Stieffamilie (oder Patchworkfamilie) entsteht, wenn mindestens ein Partner ein Kind aus einer früheren Beziehung in die neue Partnerschaft einbringt.
Was sind die größten Herausforderungen für Patchworkfamilien?
Dazu gehören die Rollenfindung der Stiefeltern, Loyalitätskonflikte der Kinder und die Klärung der Beziehung zum leiblichen Elternteil außerhalb des Haushalts.
Warum scheitern zweite Ehen häufiger als erste?
Die komplexen Anforderungen der Reorganisation des Familiensystems und die Belastungen aus der Vergangenheit beider Partner erhöhen das Konfliktpotenzial.
Wie hilft Erziehungs- und Familienberatung Stieffamilien?
Beratungsstellen unterstützen bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, der Kommunikation und der Etablierung neuer Familienregeln.
Was versteht man unter dem "Mikrosystem" einer Stieffamilie?
Es umfasst die unmittelbaren Beziehungen innerhalb des Haushalts, also zwischen Partnern, Stiefeltern und Kindern.
- Quote paper
- Katharina Theissig (Author), 2008, Schwierige Wege und Brücken zum neuen Glück. Stieffamilien und ihre vielfältigen Herausforderungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123167