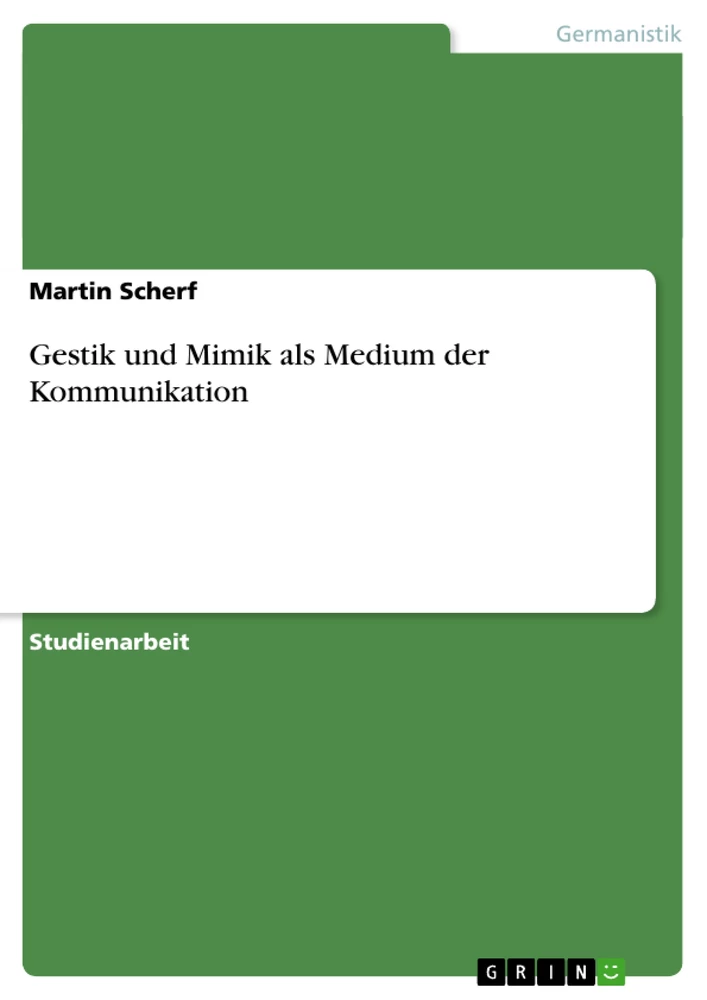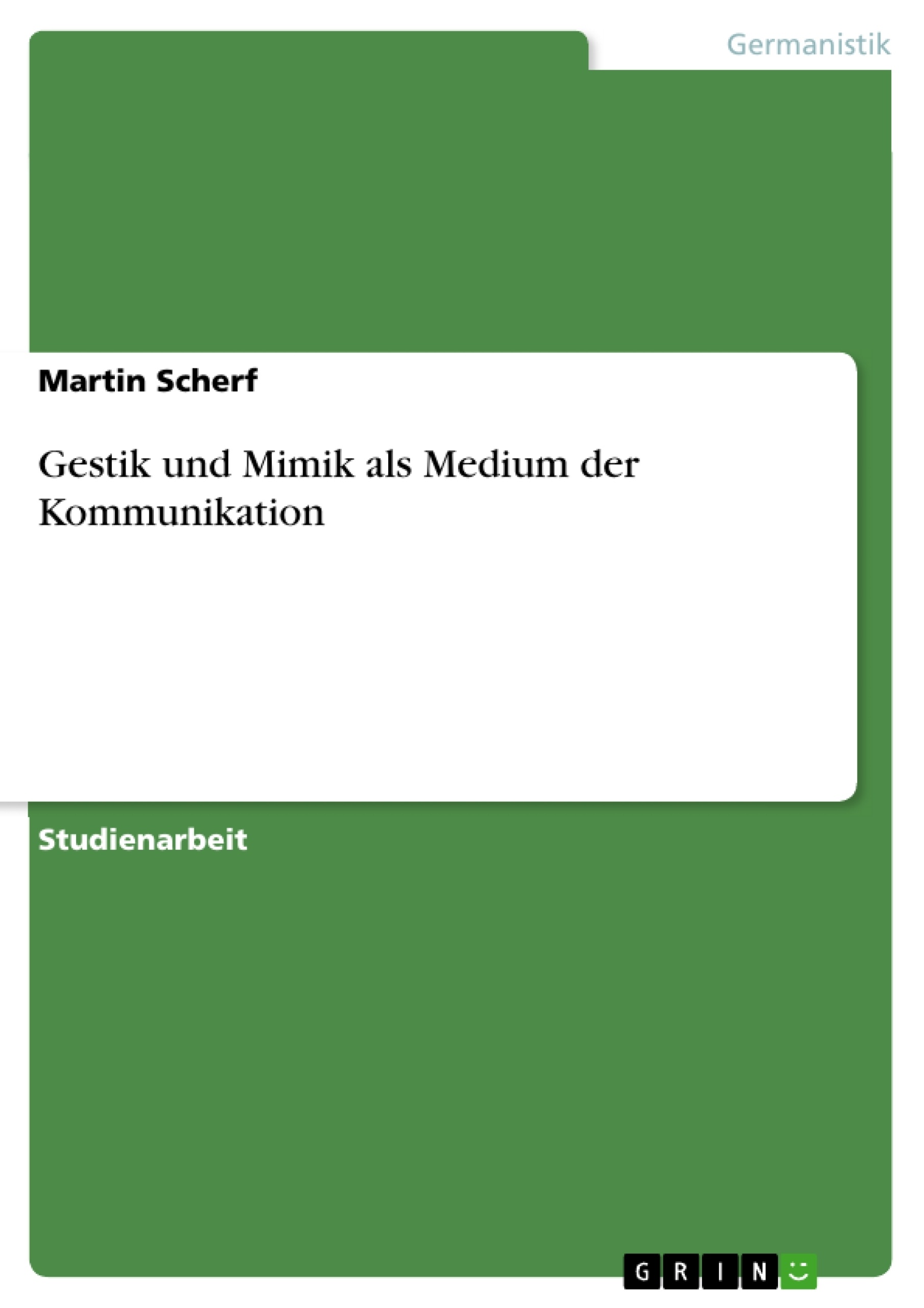Die Kommunikation ist ein Prozeß der Mitteilung, bei dem Informationen der
verschiedensten Art ausgetauscht werden. Die Informationen können durch eine große
Anzahl von Kommunikationsmitteln übertragen werden. Diese Träger der
Informationen müssen nicht zwangsläufig Sprache oder Schrift sein. Diese Medien, also
Mittel der Informationsweitergabe, entwickelten sich zwangsläufig nach den
ursprünglichen Medien der Informationsweitergabe, der Gestik und der Mimik, die
jedoch einzeln als auch sprachbegleitend sein können. Nun stellt sich hier die Frage,
wann Gestik und Mimik als Medium der Kommunikation eingesetzt werden. Zuvor
sollen jedoch die Begriffe geklärt werden. Der Begriff Gestik hat seine Ursprünge im
lateinischen Wort gestus, was so viel wie die redebegleitende Gebärde bedeutet.
Besonders in der Antike wurde die actio der Kommunikation in die vox (
Stimmführung) und in die motus (Bewegung) unterteilt. Diese Bewegung wird von
Quintilian in vultus (Mimik) und gestus unterteilt.1 Die Mimik bezeichnet die
Bewegungen des Kopfes, des Gesichts, der Augenbrauen und der Augen, sowie der
Schultern. Ursprünglich bedeutet das Wort Mimik, das aus dem griechischen Wort
Μιμος entstanden ist, die darstellende, begleitende, erklärende und auch
nachahmende Bewegung. Die Gestik bezeichnet er als die Bewegung der Finger und
der Hände, wobei die Arme bei ihm weniger Bedeutung einnahmen. Das lateinische
Wort gestus wird nach der Wurzel von gero, gerere gebildet. Dies bedeutet tragen oder
machen. Aus dem Substantiv gestus wird das Verb gestire gebildet, das besonders im
Zusammenhang mit Gesten gebraucht wird, die ein Gefühl ausdrücken. Insbesondere in
römischer Zeit wurde das Gefühl der Freude mit dieser Vokabel ausgedrückt. Die
Bewegung (motus) als Oberbegriff von gestus und vultus kann die gleiche Bedeutung
wie gestus einnehmen. Hier wird die Körperbewegung gemeint (motus corporis). Im
Griechischen gibt es für beide Begriffe nur eine Entsprechung, nämlich das Wort
Κινησις (Bewegung).2 Die Wissenschaft, die sich mit der Bedeutung der
Körpersprache beschäftigt, wird auch Kinestik genannt. Hier spielt auch der Begriff der
Gebärde eine Rolle, da sie ähnlich wie die Gestik als Informationsübermittler dient,
sogar in mannigfaltiger Form. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Gründe und Bedeutung der nonverbalen Kommunikation
- III. Gestik und Mimik in der Antike
- IV. Die Bedeutung der Gestik im Mittelalter
- V. Der Körper als Medium
- VI. Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Gestik und Mimik als Kommunikationsmittel, insbesondere in historischen Kontexten. Sie beleuchtet die Entwicklung und Bedeutung nonverbaler Kommunikation im Laufe der Zeit und analysiert deren Funktion sowohl als eigenständiges als auch als sprachbegleitendes Medium.
- Die Definition und Abgrenzung von Gestik und Mimik
- Die Bedeutung nonverbaler Kommunikation in verschiedenen historischen Epochen (Antike, Mittelalter)
- Die Funktion von Gestik und Mimik als eigenständige und sprachbegleitende Kommunikationsmittel
- Der Einfluss des historischen Kontextes auf die Bedeutung von Gestik und Mimik
- Die unterschiedlichen Gründe für den Einsatz von Gestik und Mimik in der Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und klärt die Begriffe Gestik und Mimik, indem sie deren etymologische Ursprünge und historische Definitionen beleuchtet. Die Arbeit stellt die Frage nach dem Einsatz von Gestik und Mimik als Kommunikationsmedium.
II. Gründe und Bedeutung der nonverbalen Kommunikation: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung nonverbaler Kommunikation und deren verschiedenen Funktionen in der Informationsübermittlung und Gesprächsregulation. Es werden verschiedene Gründe für den Einsatz von Gestik und Mimik als Kommunikationsmittel diskutiert, einschließlich des Unterschieds zwischen bewusster und unbewusster nonverbaler Kommunikation.
Schlüsselwörter
Gestik, Mimik, nonverbale Kommunikation, Körpersprache, Antike, Mittelalter, Kommunikationsmittel, Informationsübermittlung, Rhetorik, historischer Kontext.
- Quote paper
- Martin Scherf (Author), 2000, Gestik und Mimik als Medium der Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123289