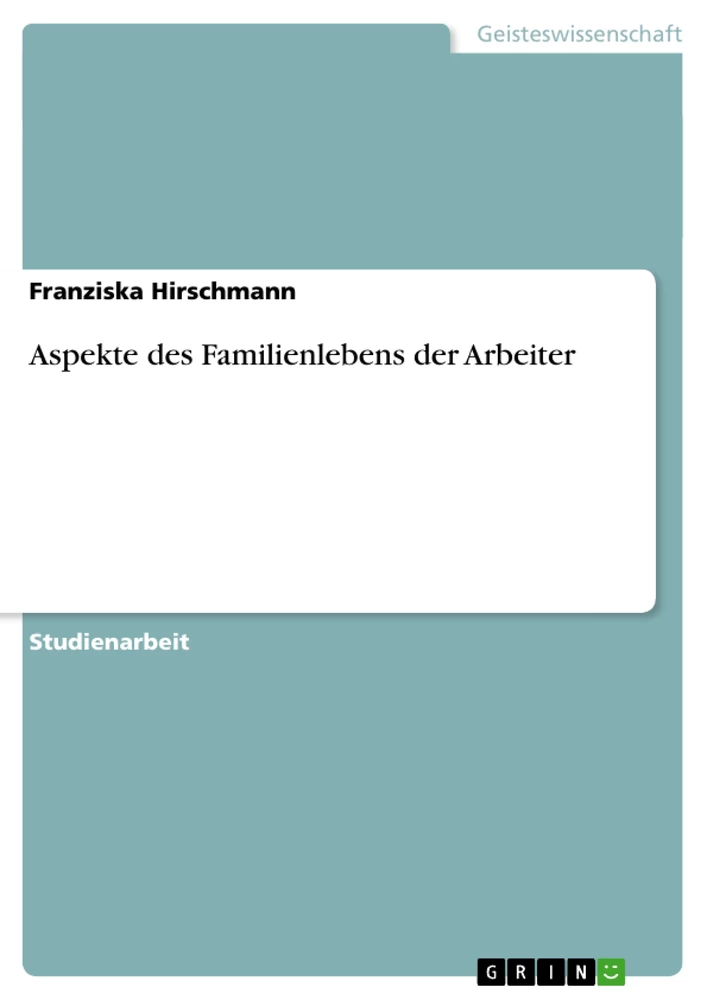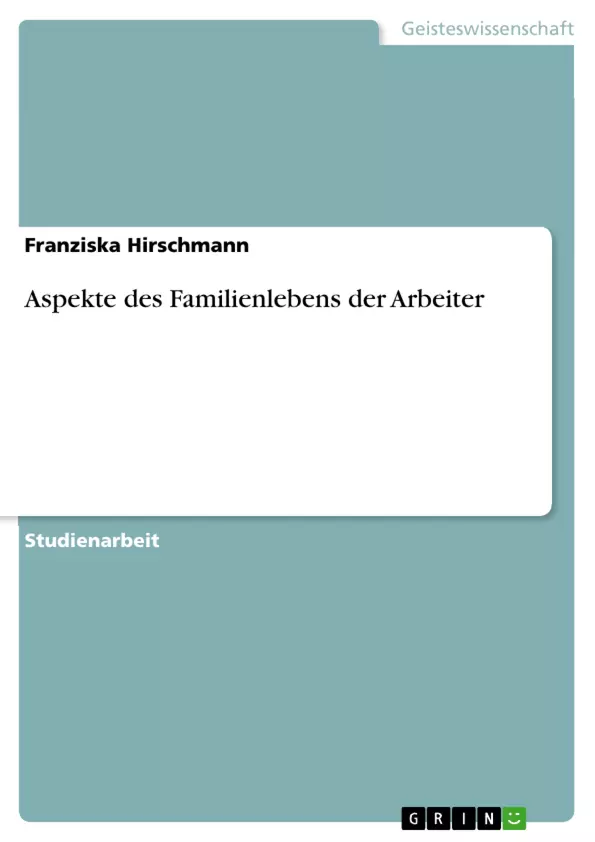Im Folgenden sollen deshalb familiärer Alltag und familiäre Verhältnisse der Arbeiterfamilien sowie das Verhältnis der einzelnen Familienmitglieder zueinander betrachtet werden. Der Typus der Arbeiterfamilie entstand mit dem Beginn der Industrialisierung in Deutschland und endete erst mit den entscheidenden sozialen Verbesserungen im Zuge des Wirtschaftswunders der 1950er. Der Untersuchungszeitraum ist somit die Zeit vom Beginn der Industrialisierung bis zum Beginn der modernen Dienstleistungsgesellschaft, also von ca. 1850-1950, wobei aufgrund der Quellen- und Literaturlage der Schwerpunkt in der Kaiserzeit und der Weimarer Republik liegt, also 1870-1930. Der Fokus wird hierbei auf die Verhältnisse in Deutschland gelegt. Vernachlässigt werden bei der Untersuchung detaillierte Angaben zur Arbeitsverhältnissen, Wohnungssituation und zur Arbeiterbewegung. Da aufgrund der Zeitspanne, die untersucht wird, keine empirische Herangehensweise mehr möglich ist, beschränkt sich diese Untersuchung methodisch auf das Auswerten von Literatur und gedruckter Quellen zur Arbeiterfamilie. Es muss aber bemerkt werden, dass sowohl die Verhältnisse in Deutschland sich von Region zu Region unterschieden und sich im Laufe der Zeit wandelten, als auch die Arbeiterklasse nicht homogen war. Aussagen zum Alltag der Arbeiter sind somit zwangsläufig stark verallgemeinert. Auch die Beschreibungen von familiären Verhältnissen und Beziehungen können nur repräsentativ für die Mehrheit der Arbeiterfamilien sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heirat
- Innerfamiliäre Beziehungen
- Beziehungen zwischen Ehepartnern
- Beziehungen zwischen Eltern und Kindern
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den familiären Alltag und die familiären Verhältnisse von Arbeiterfamilien in Deutschland von ca. 1850 bis 1950, mit Schwerpunkt auf der Kaiserzeit und der Weimarer Republik (1870-1930). Sie basiert auf der Auswertung von Literatur und gedruckten Quellen, da eine empirische Herangehensweise aufgrund des langen Untersuchungszeitraums nicht möglich ist. Die Arbeit berücksichtigt die Heterogenität der Arbeiterklasse und die regionalen Unterschiede in Deutschland.
- Heirat und ihre Bedeutung für Arbeiterfamilien
- Beziehungen zwischen Ehepartnern und die Rolle von Gleichberechtigung
- Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, einschließlich Kinderarbeit
- Der Einfluss von Alltagsbedingungen (räumliche und ökonomische Verhältnisse) auf die Familienbeziehungen
- Das Ideal der bürgerlichen Familie im Kontext der Arbeiterfamilie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach den familiären Verhältnissen der Arbeiterfamilien in den Kontext eines Zitats von Treitschke. Es wird der Untersuchungszeitraum definiert und die methodische Vorgehensweise erläutert, die sich auf die Auswertung von Literatur und Quellen konzentriert. Das Kapitel "Heirat" beleuchtet die Bedeutung der Ehe für Arbeiterfamilien als Inbegriff von Anständigkeit und Respektabilität, aber auch als Erwerbs- und Notgemeinschaft. Es wird auf das Ideal der bürgerlichen Familie und dessen Auswirkungen auf die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau eingegangen, wobei die außerhäusliche Lohnarbeit der Frauen als tabuisiert dargestellt wird.
Schlüsselwörter
Arbeiterfamilie, Kaiserzeit, Weimarer Republik, Familienalltag, Heirat, innerfamiliäre Beziehungen, Rollenverteilung, Gleichberechtigung, Kinderarbeit, bürgerliches Familienideal, Deutschland, soziale Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Welcher Zeitraum wird in dieser Untersuchung betrachtet?
Die Untersuchung umfasst die Zeit von ca. 1850 bis 1950, mit einem Schwerpunkt auf der Kaiserzeit und der Weimarer Republik (1870–1930).
Was war die Bedeutung der Heirat für Arbeiterfamilien?
Heirat galt als Inbegriff von Respektabilität und Anständigkeit, war aber oft auch eine wirtschaftliche Notgemeinschaft.
Gab es Gleichberechtigung in Arbeiterfamilien?
Die Arbeit untersucht die Rollenverteilung und stellt fest, dass das bürgerliche Familienideal oft als Vorbild diente, die Realität aber von ökonomischen Zwängen geprägt war.
Wurde Kinderarbeit in der Untersuchung berücksichtigt?
Ja, die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sowie das Phänomen der Kinderarbeit sind zentrale Themen der Arbeit.
War die Arbeiterklasse eine homogene Gruppe?
Nein, die Arbeit betont, dass die Verhältnisse regional stark variierten und die Arbeiterklasse in sich sehr heterogen war.
- Citar trabajo
- M.A. Franziska Hirschmann (Autor), 2007, Aspekte des Familienlebens der Arbeiter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123296