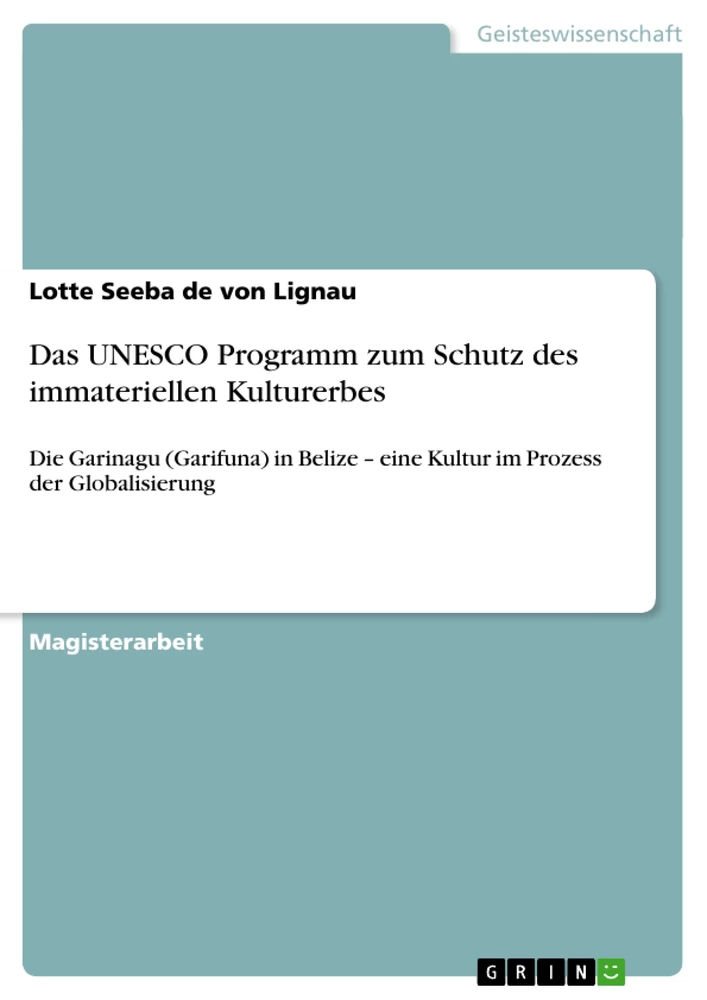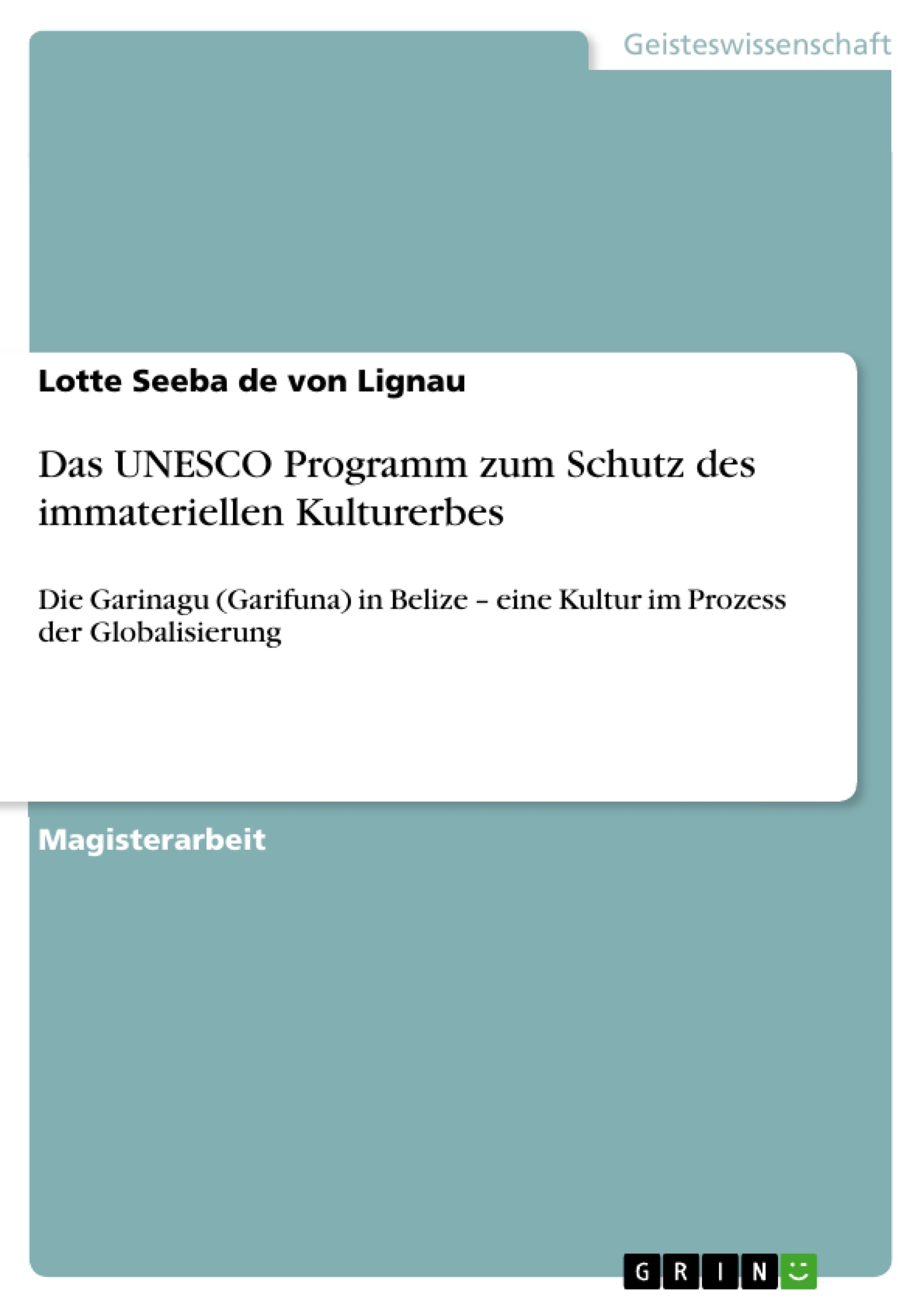Wie entwickeln sich lebendige Kulturelemente unter dem Einfluss von Globalisierungsprozessen? Müssen - und können - sie geschützt werden und was für Folgen hätte solch ein Schutz? Mit diesen Fragen hat sich die UNESCO in den letzten 30 Jahren befasst, bevor sie 2003 eine „Konvention zum Schutz des immateriellen Kulturerbes“ verabschiedete. Die Reaktionen auf die Konvention fallen sehr unterschiedlich aus. Sie haben einen Diskurs entfacht, an dem ich mich mit dieser Arbeit beteiligen möchte. Am Beispiel der Garinagu - einer afro-amerindischen Bevölkerungsgruppe - in Belize werde ich zeigen, wie sich Einflüsse globaler Vernetzungen auf kulturelle Aktivitäten auswirken können. Außerdem werde ich analysieren, welche Prozesse der „Schutz“ bestimmter Elemente ihrer Kultur durch die UNESCO ausgelöst hat. Da es noch kaum Literatur zu diesen Fragen gibt, habe ich 2006/2007 eine viermonatige Feldforschung in Zentralamerika durchgeführt, um mir ein eigenes Bild der Situation zu machen
Da der weltweite Schutz des immateriellen Kulturerbes noch in den Kinderschuhen steckt und die wenigsten Länder bisher Gesetze zu diesem Zweck entwickelt haben, gibt es eine Vielzahl von Fragen, die darauf warten, beantwortet zu werden. Wie bewältigen Menschen soziale Veränderungen und wie wird der Verlust von Tradition und Kontinuität kompensiert? Wer entscheidet, was schützenswert ist, und wie wirkt sich diese Zuschreibung auf die jeweiligen Kulturelemente aus? Ist es überhaupt möglich, kulturelle Traditionen durch Schutzmaßnahmen dem natürlichen Prozess der Veränderung zu entziehen und wenn ja, wie steht es dann um die Vitalität? Was passiert, wenn kulturelle Praktiken durch Schutzprogramme der Regierungen instrumentalisiert werden? Ich hoffe mit meiner Arbeit einen Beitrag zur Beantwortung einiger dieser Fragen leisten zu können, um mich so am Diskurs um Notwendigkeit, Machbarkeit, Gefahren und Nutzen des „Schutzes“ immaterieller Kultur zu beteiligen.
Die Arbeit beginnt mit einem Abriss über „Kultur und Ethnizität im Prozess der Globalisierung“. Darauf folgt ein Abschnitt über die Kulturarbeit der UNESCO und ihre Maßnahmen zum Schutz des immateriellen Kulturerbes, wobei ein besonderer Fokus auf der Konvention von 2003 liegt. Danach befasse ich mich mit dem sozialen Umfeld und dem kulturellen Wandel der Garinagu in Belize und analysiere die Auswirkungen des Schutzes durch die UNESCO bevor ich zum Schluss die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit reflektiere und ein Fazit ziehe.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Hinführung zum Thema
- 1.2. Quellenlage
- 1.3. Feldforschung und Methodik
- 2. Kultur und Ethnizität im Prozess der Globalisierung
- 3. Die Kulturarbeit der UNESCO – Wege zum Schutz des immateriellen Kulturerbes
- 3.1. Gründung, Aufbau und Ziele der UNESCO
- 3.2. Von der Welterbekonvention zum Schutz immateriellen Kulturerbes
- 3.2.1. Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (1972)
- 3.2.2. Unterscheidung zwischen materiellem und immateriellen Kulturerbe
- 3.2.3. Empfehlung zur Wahrung des kulturellen Erbes in Volkskunst und Brauchtum (1989)
- 3.2.4. Weitere Programme, Aktivitäten und Projekte der UNESCO im Bereich des immateriellen Kulturerbes
- 3.3. Konvention zum Schutz des immateriellen Kulturerbes (2003)
- 3.3.1. Begriffsbestimmungen und Grundsätze der Konvention
- 3.3.2. Schutzmaßnahmen
- 3.3.3. Die aktuelle Situation
- 3.3.4. Kritische Betrachtung der Konvention
- 4. Belize und seine kulturelle Vielfalt
- 4.1. Geographie und Wirtschaft
- 4.2. Geschichte und Globalisierung
- 4.3. Ethnischer Pluralismus
- 4.4. Förderung einer nationalen Identität
- 5. Geschichte und Entwicklung der Garinagu
- 5.1. Ethnogenese auf St. Vincent
- 5.2. Deportation nach Roatan und Verbreitung in Zentralamerika
- 5.3. Migration und kulturelle Erosion
- 6. Kultur und Ethnizität der Garinagu in Belize im Prozess der Globalisierung
- 6.1. Bildung einer ethnischen Identität
- 6.2. Elemente der ethnischen Identität
- 6.2.1. Wirtschaftsweise und Esskultur
- 6.2.2. Sprache
- 6.2.3. Sozialorganisation und Religion
- 6.2.4. Musik und Tanz
- 6.3. Strategien zur Stärkung der ethnischen Identität
- 6.3.1. Der „Garifuna Settlement Day“
- 6.3.2. Die Garifuna Flagge
- 6.3.3. Entwicklung des „Punta Rock“
- 6.3.4. Eigenrepräsentation im Gulisi Garifuna Museum in Dangriga
- 6.3.5. Von T.V. Ramos zum National Garifuna Council (NGC)
- 6.3.6. Andere Organisationen zur Unterstützung der Garinagu in Mittelamerika
- 7. Die Ernennung von Sprache, Musik und Tanz der Garinagu zum „Meisterwerk des mündlich überlieferten und immateriellen Erbes der Menschheit“ durch die UNESCO
- 7.1. Entstehung der Bewerbung
- 7.2. Auswirkungen der Proklamation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Auswirkungen von Globalisierungsprozessen auf die Kultur der Garinagu in Belize und analysiert die Rolle der UNESCO im Schutz ihres immateriellen Kulturerbes. Die Arbeit beleuchtet, wie die Garinagu ihre ethnische Identität inmitten des Wandels bewahren und stärken.
- Einfluss der Globalisierung auf die Garifuna Kultur
- Strategien der Garinagu zur Erhaltung ihrer kulturellen Identität
- Die UNESCO-Konvention zum Schutz des immateriellen Kulturerbes
- Die Rolle des National Garifuna Council (NGC)
- Analyse der UNESCO-Proklamation der Garifuna Sprache, Musik und Tanz als "Meisterwerk"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Methodik der Feldforschung. Kapitel 2 diskutiert die Konzepte von Kultur und Ethnizität im Kontext der Globalisierung. Kapitel 3 beleuchtet die Kulturarbeit der UNESCO, ihre Konventionen und Programme zum Schutz immateriellen Kulturerbes. Kapitel 4 beschreibt Belize und seine kulturelle Vielfalt. Kapitel 5 behandelt die Geschichte und Entwicklung der Garinagu. Kapitel 6 analysiert die Garifuna Kultur in Belize und die Strategien zur Stärkung ihrer ethnischen Identität, inklusive der Rolle von Organisationen wie dem NGC.
Schlüsselwörter
Garifuna, Belize, immaterielles Kulturerbe, UNESCO, Globalisierung, kultureller Wandel, ethnische Identität, National Garifuna Council (NGC), Punta Rock, Migration, Sprachverlust, Tradition.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der UNESCO-Konvention von 2003?
Die Konvention dient dem Schutz des immateriellen Kulturerbes, also lebendigen Traditionen wie mündlichen Überlieferungen, Bräuchen, Musik und Tanz, die durch Globalisierungsprozesse gefährdet sein könnten.
Wer sind die Garinagu (Garifuna) und wo leben sie?
Die Garinagu sind eine afro-amerindische Bevölkerungsgruppe, die vor allem in Zentralamerika, insbesondere in Belize, Guatemala und Honduras, beheimatet ist.
Welche Elemente der Garifuna-Kultur wurden von der UNESCO ausgezeichnet?
Die UNESCO ernannte Sprache, Musik und Tanz der Garinagu zum „Meisterwerk des mündlich überlieferten und immateriellen Erbes der Menschheit“.
Welche Auswirkungen hat der UNESCO-Schutz auf die lokale Kultur?
Die Arbeit analysiert kritisch, ob der Schutz die Vitalität der Kultur fördert oder sie instrumentalisiert und dem natürlichen Wandel entzieht, was zu einer Musealisierung führen könnte.
Wie stärken die Garinagu ihre ethnische Identität in Zeiten der Globalisierung?
Dies geschieht durch die Arbeit von Organisationen wie dem National Garifuna Council (NGC), die Förderung der eigenen Sprache, die Einführung nationaler Feiertage (Garifuna Settlement Day) und moderne Musikformen wie den Punta Rock.
Welche methodische Grundlage hat die Arbeit?
Die Arbeit basiert auf einer viermonatigen Feldforschung in Zentralamerika (2006/2007), da es zum Zeitpunkt der Erstellung kaum Literatur zu den spezifischen Auswirkungen des UNESCO-Schutzes gab.
- Citation du texte
- Magister Lotte Seeba de von Lignau (Auteur), 2008, Das UNESCO Programm zum Schutz des immateriellen Kulturerbes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123317