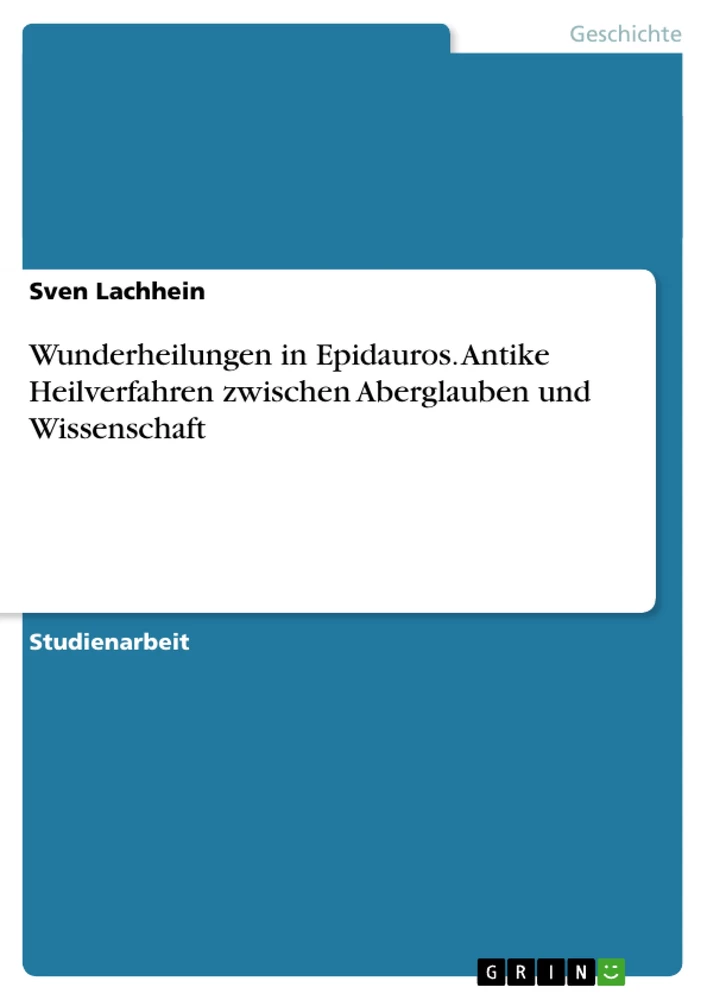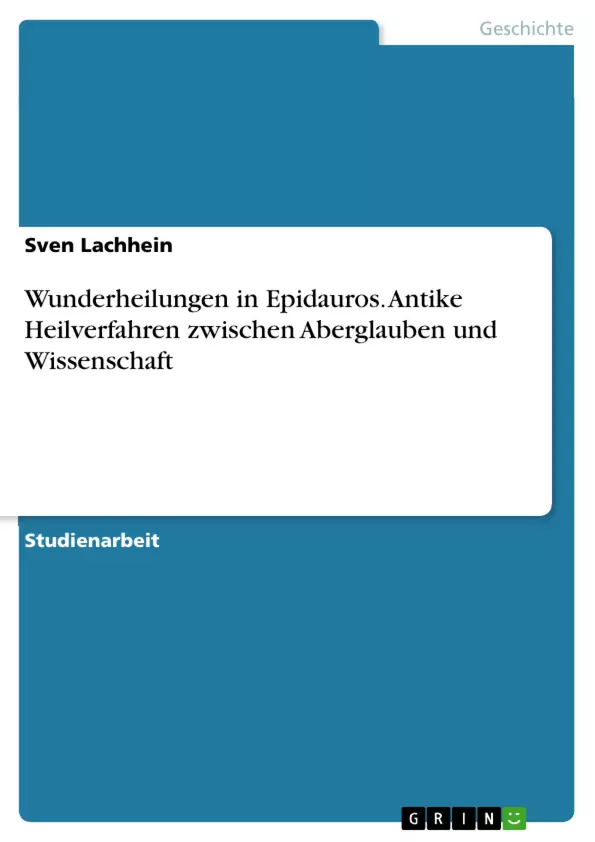Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Inschriften aus Epidauros, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts bei Ausgrabungen entdeckt wurden und die Tempelanlage als eines der erfolgreichsten Zentren antiken Heilpraktikerwesens erscheinen lassen. Dort aufgefundene Steintafeln berichten von zahlreichen Heilwundern, welche vor Ort durch die göttlichen Kräfte des Heilgottes Asklepios gewirkt wurden und Kranke von ihren Gebrechen aller Art nachts im Traum erlösten.
Im folgenden wird nun geprüft, inwieweit zeitgenössische und spätere literarische Quellen Zeugnisse vom medizinischen und religiösen Selbstverständnis der damaligen Zeit liefern und welche Unterschiede, regional und weltanschaulich, das Denken der Menschen in der Antike geprägt haben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffsdefinition und Abgrenzung von antiken und christlichen „Wundern“
- 1) Wunder und Wunderglaube in antiker Zeit
- 2) Unglaublichkeiten des neuen Glaubens
- III. Epidauros
- 1) Geographische Lage und natürliche Ressourcen
- 2) Antike Ortsbeschreibung
- 3) Moderne Grabungen
- IV. Quelleneditionen
- V. Asklepios
- 1) Ursprung des Mythos
- 2) Die Kultentwicklung des Asklepios
- 3) Halbgott in weiß
- VI. Die Wunderheiler und Wunderheilungen in Epidauros
- 1) Kindsnöte und Kindersegen
- 2) Chirurgie bei Eiterungen, Geschwüren u. ä.
- 3) Chirurgie bei Verwundungen
- 4) Augenleiden
- 5) Sprachstörungen
- 6) Lähmungen
- 7) Verschiedene Krankheiten
- 8) Mantik
- 9) Erziehungs- und Strafwunder
- 10) Weihegaben
- VII. Kultexport und Translatio Asclepii
- 1) Filialgründungen
- 2) Aus Asklepios wird Aesculap
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die in Epidauros gefundenen Inschriften, die die Tempelanlage als bedeutendes Zentrum antiker Heilpraktiken belegen. Sie analysiert die dort beschriebenen Wunderheilungen im Kontext des antiken und christlichen Verständnisses von „Wundern“, untersucht den Mythos des Asklepios und beleuchtet die medizinischen und religiösen Aspekte des Heiligtums.
- Das antike und christliche Verständnis von Wundern
- Der Mythos und Kult des Heilgottes Asklepios
- Die Arten der in Epidauros dokumentierten Heilungen
- Die geographische und kulturelle Bedeutung von Epidauros
- Der Einfluss von Epidauros auf die Verbreitung des Asklepios-Kults
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Fokus auf die in Epidauros gefundenen Inschriften, welche die Tempelanlage als Zentrum antiker Heilkunde belegen. Die Arbeit untersucht die beschriebenen Wunderheilungen und ihren Kontext im antiken Glauben.
II. Begriffsdefinition und Abgrenzung von antiken und christlichen „Wundern“: Dieses Kapitel differenziert zwischen dem antiken und dem christlichen Verständnis von Wundern. Während für die Antike ein Wunder eher ein unerwartetes Ereignis war, das nicht zwingend gegen Naturgesetze verstieß, betont der christliche Glaube das Überschreiten der natürlichen Ordnung. Die unterschiedlichen Wunderverständnisse werden anhand von Zitaten und Beispielen aus der Literatur erläutert.
III. Epidauros: Dieses Kapitel beschreibt die geographische Lage und die Ressourcen von Epidauros, mit Fokus auf heiße Quellen und deren Nutzung in der Antike. Die antike und moderne Beschreibung Epidauros wird gegenüberstellt, und die Bedeutung der Ausgrabungen wird hervorgehoben.
V. Asklepios: Dieses Kapitel beleuchtet den Ursprung des Asklepios-Mythos, beginnend mit den Darstellungen bei Homer, Platon, Celsus und Pindar. Die Kultentwicklung, inklusive der lokalen Mythen und der Kultlegende von Epidauros, wird ausführlich behandelt. Der Asklepios-Kult wird von seinem Anfang als Halbgott bis hin zu seiner Apotheose und Verehrung als Gott dargestellt.
VI. Die Wunderheiler und Wunderheilungen in Epidauros: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die verschiedenen Arten von Krankheiten, die in den epidaurischen Inschriften behandelt werden, von Kindsnöten und Chirurgie bis hin zu Augenleiden, Sprachstörungen, Lähmungen und anderen Krankheiten. Auch die Rolle der Mantik (Wahrsagerei) und Erziehungs- bzw. Strafwunder wird beleuchtet.
VII. Kultexport und Translatio Asclepii: Dieses Kapitel befasst sich mit der Ausbreitung des Asklepios-Kults durch die Gründung von Tochterheiligtümern und der Entwicklung des Namens Asklepios zu Aesculap im römischen Reich. Die Verbreitung und Transformation des Kults werden analysiert.
Schlüsselwörter
Epidauros, Asklepios, Wunderheilungen, antiker Glaube, christlicher Glaube, Heilkunde, Medizin, Mythos, Kult, Inschriften, Heilquellen, Argolis, Iαματα, Eлioάvɛια, Kultentwicklung, Translatio Asclepii.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wunderheilungen in Epidauros
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die in Epidauros gefundenen Inschriften, welche die Tempelanlage als bedeutendes Zentrum antiker Heilpraktiken belegen. Der Fokus liegt auf der Analyse der beschriebenen Wunderheilungen im Kontext des antiken und christlichen Verständnisses von „Wundern“, der Untersuchung des Asklepios-Mythos und der Beleuchtung der medizinischen und religiösen Aspekte des Heiligtums in Epidauros.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das antike und christliche Verständnis von Wundern, den Mythos und Kult des Heilgottes Asklepios, die Arten der in Epidauros dokumentierten Heilungen, die geographische und kulturelle Bedeutung von Epidauros und den Einfluss von Epidauros auf die Verbreitung des Asklepios-Kults.
Wie wird das antike und christliche Wunderverständnis unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen dem antiken und christlichen Verständnis von Wundern. In der Antike war ein Wunder eher ein unerwartetes Ereignis, das nicht zwingend gegen Naturgesetze verstieß. Der christliche Glaube betont hingegen das Überschreiten der natürlichen Ordnung. Die unterschiedlichen Wunderverständnisse werden anhand von Beispielen aus der Literatur erläutert.
Welche Rolle spielt Epidauros in der Arbeit?
Epidauros wird als geographischer und kultureller Mittelpunkt der Arbeit behandelt. Die geographische Lage, die natürlichen Ressourcen (wie heiße Quellen), die antike und moderne Beschreibung Epidauros sowie die Bedeutung der Ausgrabungen werden ausführlich beschrieben. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Epidauros als Zentrum antiker Heilkunde und des Asklepios-Kults.
Was wird über Asklepios behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Ursprung des Asklepios-Mythos, seine Kultentwicklung, beginnend mit Darstellungen bei Homer, Platon, Celsus und Pindar, bis hin zu seiner Apotheose und Verehrung als Gott. Die lokalen Mythen und die Kultlegende von Epidauros werden ausführlich behandelt.
Welche Arten von Heilungen werden in Epidauros dokumentiert?
Die Arbeit beschreibt detailliert verschiedene Arten von Krankheiten, die in den epidaurischen Inschriften behandelt werden, von Kindsnöten und chirurgischen Eingriffen (Eiterungen, Geschwüre, Verwundungen) bis hin zu Augenleiden, Sprachstörungen, Lähmungen und anderen Krankheiten. Auch die Rolle der Mantik (Wahrsagerei) und Erziehungs- bzw. Strafwunder wird beleuchtet.
Wie wird die Verbreitung des Asklepios-Kults behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Ausbreitung des Asklepios-Kults durch die Gründung von Tochterheiligtümern und der Entwicklung des Namens Asklepios zu Aesculap im römischen Reich. Die Verbreitung und Transformation des Kults werden analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Epidauros, Asklepios, Wunderheilungen, antiker Glaube, christlicher Glaube, Heilkunde, Medizin, Mythos, Kult, Inschriften, Heilquellen, Argolis, Iαματα, Eлioάvɛια, Kultentwicklung, Translatio Asclepii.
- Citar trabajo
- Sven Lachhein (Autor), 2008, Wunderheilungen in Epidauros. Antike Heilverfahren zwischen Aberglauben und Wissenschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123330