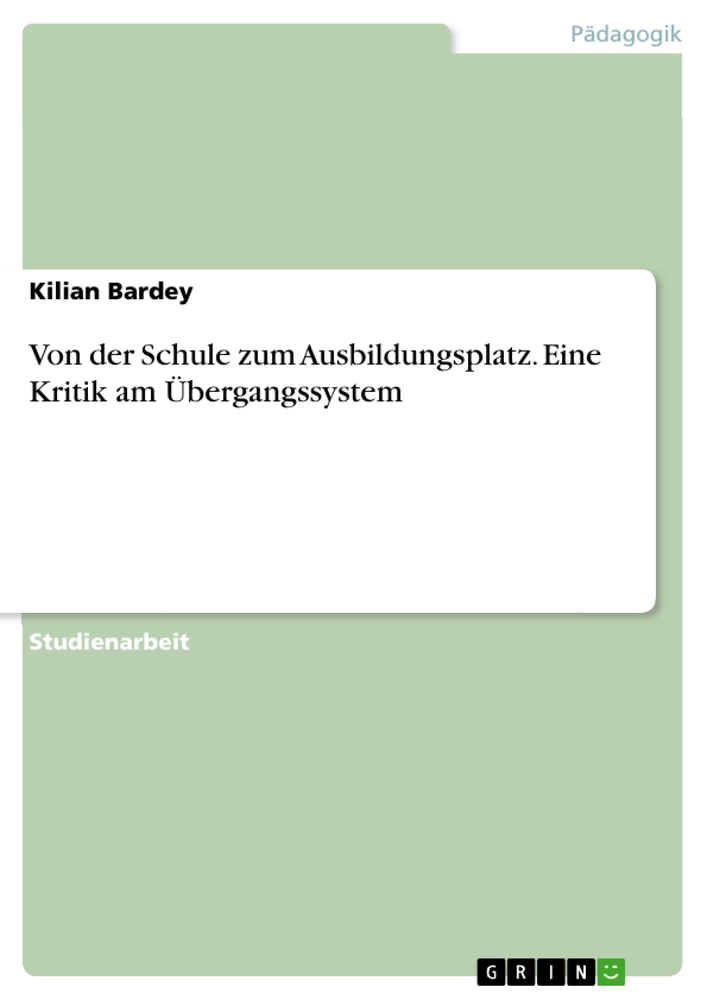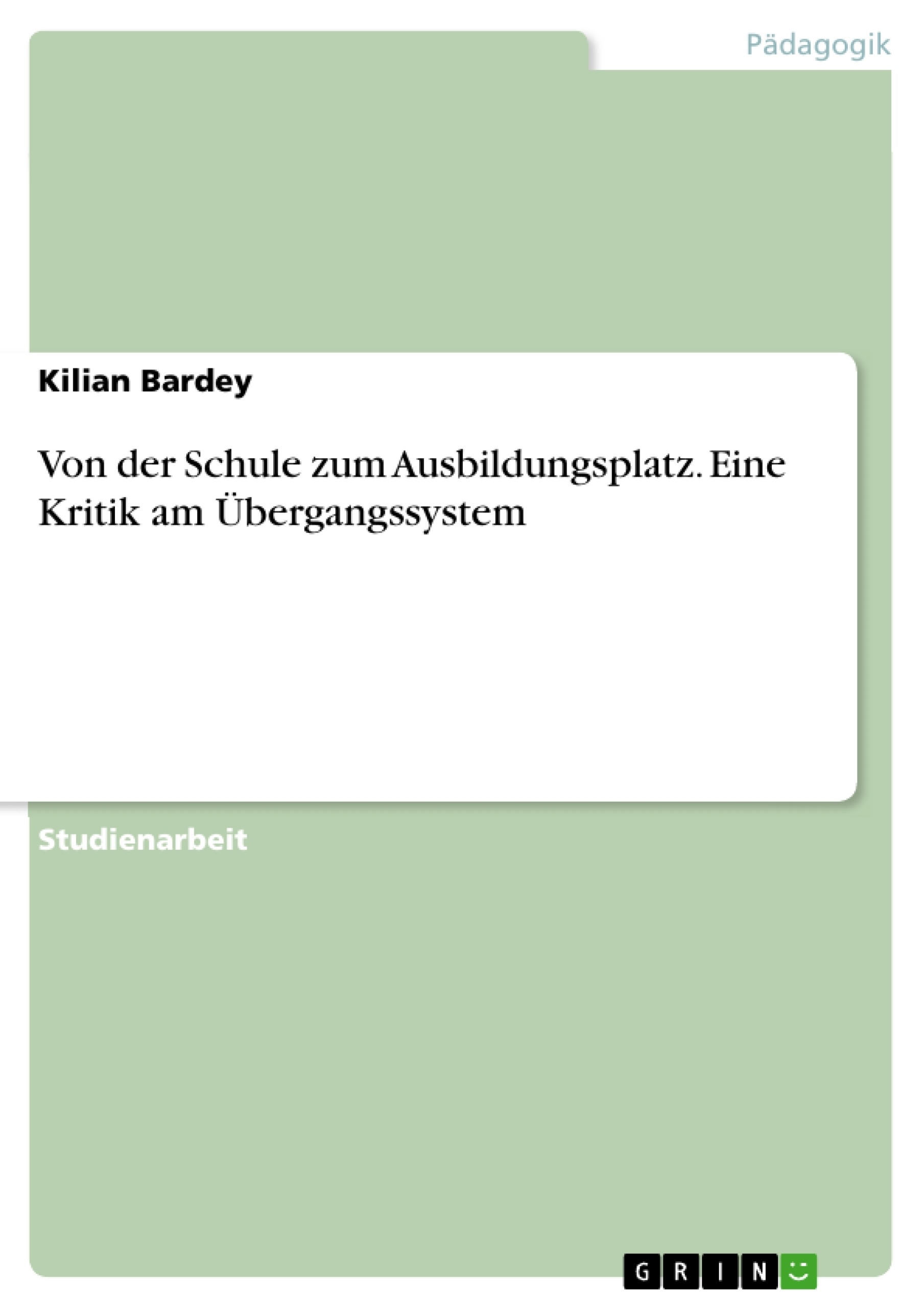Jedes Jahr verlässt eine mehr oder minder große Zahl an Jugendlichen die allgemeinbildenden Schulen und stößt bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz auf ein Problem. Die allgemeine Lehrstellenknappheit lässt das Angebot weit geringer ausfallen, als die Nachfrage besteht. So wurde im Jahr 2006 nur die Hälfte der Bewerber um eine Ausbildungsstelle fündig.
Dabei sind nicht alle Bewerber gleichermaßen ohne jegliche Alternative verblieben, einige der in der Statistik aufgeführten Jugendlichen nahmen einen Bildungsgang an einer BFS auf, oder entschieden sich für eine weitergehende Schule.
Zeitgleich blieben aber auch 15.500 Lehrstellen unbesetzt.
Diese Differenz ist angesichts des Lehrstellenmangels eine beachtliche Zahl. Die Gründe für die Nichtbesetzung sehen die Unternehmen oft in der mangelnden Ausbildungsreife der Jugendlichen. Um dieser Ausbildungsunreife zu begegnen, wurde ein System geschaffen, das die Schwellen beim Übergang in eine Ausbildung möglichst niedrig halten soll. Dieses Übergangssystem beinhaltet viele verschiedene Maßnahmen, deren Effizienz häufig in Frage gestellt werden.
Das Ziel dieser Arbeit ist, der Frage nachzugehen, welche Personengruppen am stärksten von den veränderten Anforderungen auf dem Ausbildungsmarkt betroffen sind. Darüber hinaus soll dargestellt werden, wo die grundlegenden Probleme beim Übergang in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt liegen. Nach einer kurzen Vorstellung der Maßnahmen zur Berufsvorbereitung, die auch als Übergangssystem bezeichnet werden, wird die Problematik, die diese mit sich bringen, genauer erörtert.
Abschließend wird dargestellt, ob die Maßnahmen überhaupt eine Hilfestellung bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt darstellen, oder nur als vieldiskutierte Wartschleife, oder besser, als arbeitsmarktpolitisches Instrument dienen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Übergänge in Zeiten der Arbeitsmarktkrise
- 3. Das Dilemma der Benachteiligtenförderung, oder, wohin mit den Jugendlichen?
- 4. Deutschland einig Einwanderungsland – Das Problem mit dem Migrationshintergrund
- 5. Berufsvorbereitung als Teil des Berufsbildungssystems
- 5.1 BVJ/BGJ
- 5.2 Berufsfachschulen
- 5.3 BQF - Strukturreform der Benachteiligtenförderung
- 5.4 EIBE - Eingliederung in die Arbeitswelt
- 6. Aktive Arbeitsmarktpolitik oder das Ende der Jugendarbeitslosigkeit? – Maßnahmen der BA
- 6.1 EQJ Einstiegsqualifizierung Jugendlicher
- 6.2 Zum Modellprojekt QuAS - Moderne Fördermaßnahmen der BA
- 7. Fazit – Förderung statt Bildung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen beim Übergang von der Schule in den ersten Arbeitsmarkt, insbesondere für Jugendliche mit niedrigen Bildungsabschlüssen. Sie analysiert die Effektivität der bestehenden Übergangssysteme und Maßnahmen der Arbeitsagentur. Die Arbeit beleuchtet die Ursachen der Schwierigkeiten und hinterfragt deren Rolle als reine Arbeitsmarktpolitik.
- Schwierigkeiten beim Übergang Schule-Beruf, besonders für benachteiligte Jugendliche
- Analyse der Effektivität von Berufsvorbereitungsmaßnahmen
- Die Rolle der Arbeitsmarktpolitik im Übergangssystem
- Der Einfluss des Bildungsabschlusses auf den Berufseinstieg
- Herausforderungen durch den Lehrstellenmangel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problematik des Übergangs von der Schule in den Beruf, ausgehend von der hohen Zahl an unbesetzten Lehrstellen und Bewerbern ohne Ausbildungsplatz. Sie führt die Thematik des Übergangssystems ein und formuliert die Forschungsfrage nach den am stärksten betroffenen Personengruppen und den grundlegenden Problemen im Übergang in den Arbeitsmarkt. Der Fokus liegt auf der Analyse der Effizienz der bestehenden Maßnahmen.
2. Übergänge in Zeiten der Arbeitsmarktkrise: Dieses Kapitel untersucht den Übergang in den Arbeitsmarkt im Kontext der Arbeitsmarktkrise. Obwohl die Arbeitslosenquote sinkt, verbleiben viele Jugendliche mit niedrigen Bildungsabschlüssen in Berufsvorbereitungsmaßnahmen. Der Text betont den Zusammenhang zwischen Bildungsabschluss und der Erfolgswahrscheinlichkeit beim Finden eines Ausbildungsplatzes. Die zunehmende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und die damit verbundenen Herausforderungen für Jugendliche mit schwachem sozialen Umfeld und niedrigen Bildungsabschlüssen werden analysiert.
5. Berufsvorbereitung als Teil des Berufsbildungssystems: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Berufsvorbereitungsmaßnahmen wie BVJ/BGJ, Berufsfachschulen, BQF und EIBE. Es beleuchtet die Strukturreform der Benachteiligtenförderung und die Integration in die Arbeitswelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der verschiedenen Ansätze und ihrer Rolle im Übergangssystem, ohne eine detaillierte Bewertung ihrer Effektivität.
Schlüsselwörter
Übergang Schule-Beruf, Berufsvorbereitung, Arbeitsmarktpolitik, Benachteiligung, Bildungsabschluss, Jugendarbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel, Berufsbildungssystem, Arbeitsmarktintegration, Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Übergänge in den Arbeitsmarkt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen beim Übergang von der Schule in den ersten Arbeitsmarkt, insbesondere für Jugendliche mit niedrigen Bildungsabschlüssen. Sie analysiert die Effektivität bestehender Übergangssysteme und Maßnahmen der Arbeitsagentur, beleuchtet die Ursachen von Schwierigkeiten und hinterfragt deren Rolle als reine Arbeitsmarktpolitik.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Schwierigkeiten beim Übergang Schule-Beruf (besonders für benachteiligte Jugendliche), die Analyse der Effektivität von Berufsvorbereitungsmaßnahmen, die Rolle der Arbeitsmarktpolitik im Übergangssystem, den Einfluss des Bildungsabschlusses auf den Berufseinstieg und die Herausforderungen durch den Lehrstellenmangel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zu einer Einleitung, Übergängen in Zeiten der Arbeitsmarktkrise, dem Dilemma der Benachteiligtenförderung, dem Thema Einwanderung und Migrationshintergrund, Berufsvorbereitung als Teil des Berufsbildungssystems (inkl. BVJ/BGJ, Berufsfachschulen, BQF und EIBE), aktiver Arbeitsmarktpolitik und Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (inkl. EQJ und QuAS), und abschließend ein Fazit.
Was wird im Kapitel "Berufsvorbereitung" beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Berufsvorbereitungsmaßnahmen wie BVJ/BGJ, Berufsfachschulen, BQF und EIBE. Es beleuchtet die Strukturreform der Benachteiligtenförderung und die Integration in die Arbeitswelt. Der Fokus liegt auf der Darstellung der verschiedenen Ansätze und ihrer Rolle im Übergangssystem, ohne detaillierte Bewertung der Effektivität.
Welche Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ) und das Modellprojekt QuAS als moderne Fördermaßnahmen der BA im Kontext der aktiven Arbeitsmarktpolitik und deren Auswirkungen auf die Jugendarbeitslosigkeit.
Welche Personengruppen stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Der Schwerpunkt liegt auf Jugendlichen mit niedrigen Bildungsabschlüssen, die besondere Schwierigkeiten beim Übergang Schule-Beruf erfahren. Die Arbeit betrachtet auch den Einfluss von Faktoren wie Migrationshintergrund und sozialem Umfeld.
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die Arbeit untersucht, welche Personengruppen am stärksten von Problemen beim Übergang in den Arbeitsmarkt betroffen sind und welche grundlegenden Probleme in diesem Übergangssystem existieren. Ein zentraler Aspekt ist die Analyse der Effizienz der bestehenden Maßnahmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Übergang Schule-Beruf, Berufsvorbereitung, Arbeitsmarktpolitik, Benachteiligung, Bildungsabschluss, Jugendarbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel, Berufsbildungssystem, Arbeitsmarktintegration und Migrationshintergrund.
Wie wird der Übergang Schule-Beruf im Kontext der Arbeitsmarktkrise betrachtet?
Das Kapitel "Übergänge in Zeiten der Arbeitsmarktkrise" analysiert den Zusammenhang zwischen sinkender Arbeitslosenquote, der verbleibenden hohen Zahl von Jugendlichen in Berufsvorbereitungsmaßnahmen und niedrigen Bildungsabschlüssen. Es betont die zunehmende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und die damit verbundenen Herausforderungen.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kurzform)?
Das Fazit hinterfragt kritisch, ob die bestehenden Maßnahmen eher auf Förderung oder Bildung ausgerichtet sind und zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse der Übergangsprozesse und der Effektivität der Maßnahmen. (Der genaue Inhalt des Fazits ist im vorliegenden Auszug nicht detailliert beschrieben.)
- Arbeit zitieren
- Kilian Bardey (Autor:in), 2008, Von der Schule zum Ausbildungsplatz. Eine Kritik am Übergangssystem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123390