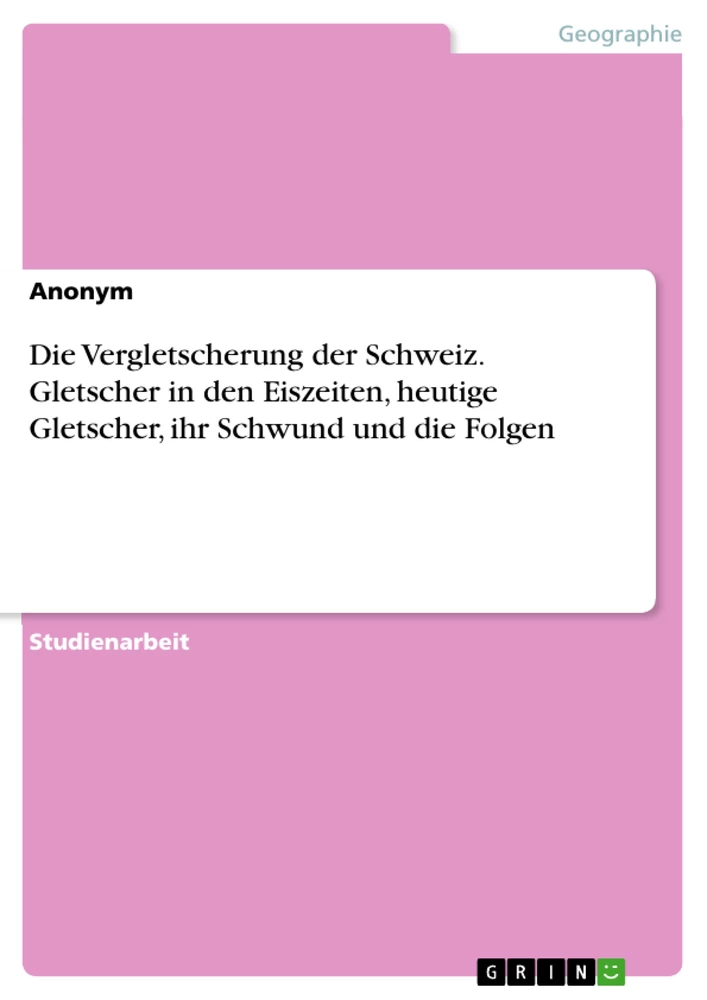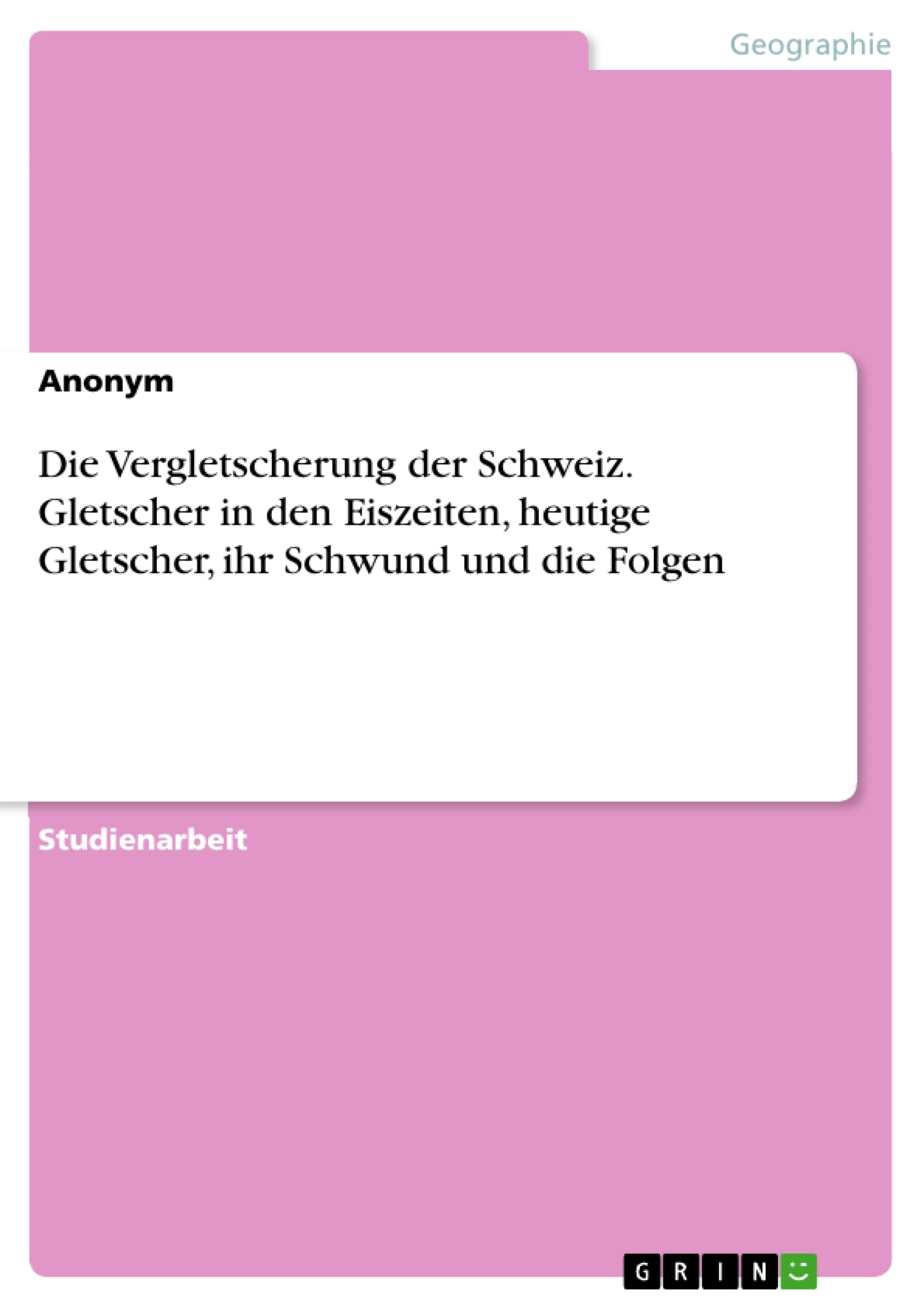In der folgenden Ausarbeitung werden nun zunächst Grundlagen zum Thema Vergletscherung in den Eiszeiten dargestellt, dann wird die Entwicklung der Gletscher bis hin zu ihrem heutigen Stand beschrieben und kritisch auf die Folgen sowie künftige Veränderungen, bedingt durch den Wandel der Gletscher, eingegangen.
Die Dynamik der alpinen Landschaft ist beachtenswert, sie stand und steht in einem stetigen Wandel. Verdeutlicht wird dies seit jeher durch das Vorherrschen von teilweise gigantischen Gletschersystemen und deren Rückzug. Noch heute sind rund 10% der Erdoberfläche von Gletschern bedeckt und 75% des Süßwassers der Erde ist in Form von Gletschern gespeichert. In der Schweiz sind rund 2,5% des Süßwassers vergletschert (Stand 2000). Diese 2,5% finden sich in der Schweiz in rund 2000 Gletschern wieder. Das gesamte Schweizer Gletschervolumen würde gleichmäßig verteilt die Schweiz mit einer 1,5m hohen Eisschicht bedecken. Dies entspricht ungefähr einem mittleren jährlichen Gebietsniederschlag.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Schweiz, „Heimat“ der Gletscher
- Definition von Gletscher
- Aufbau eines Gletschers
- Eiszeitliche Vergletscherung
- Eiszeittheorie
- Vergletscherung der Schweiz
- Heutige Gletscher
- Abschmelzen & Folgen des Abschmelzens der Gletscher
- Auswirkungen auf den Schweizer Wasserhaushalt
- Anthropogene Gletschernutzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Vergletscherung der Schweiz in den Eiszeiten, den heutigen Gletschern, ihrem Schwund und den Folgen. Sie möchte die Bedeutung von Gletschern als Wasserspeicher und die Auswirkungen des Gletscherschwunds auf den Wasserhaushalt und die Landschaft beleuchten.
- Die Geschichte der Vergletscherung in der Schweiz
- Die Entstehung und Eigenschaften von Gletschern
- Der Einfluss der Eiszeiten auf die Schweizer Landschaft
- Der Rückgang der Gletscher und seine Ursachen
- Die Folgen des Gletscherschwunds für die Schweiz
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Dieses Kapitel stellt die Dynamik der alpinen Landschaft und die Bedeutung von Gletschern als Wasserspeicher und wichtige Elemente des Ökosystems dar.
- Die Schweiz, „Heimat“ der Gletscher: Dieses Kapitel beschreibt die drei großen Landschaftstypen der Schweiz: Jura, Mittelland und Alpen, und beleuchtet die Entstehung der Alpen und ihre Bedeutung für die Gletscherbildung.
- Definition von Gletscher: Dieses Kapitel liefert eine Definition von Gletschern und erläutert ihre Entstehung durch Akkumulation und Ablation von Schnee. Es beschreibt auch die verschiedenen Bestandteile eines Gletschers, wie Nährgebiet, Zehrgebiet und Gleichgewichtslinie.
- Aufbau eines Gletschers: Dieses Kapitel behandelt die Bewegung von Gletschern und deren Auswirkungen auf die Landschaft, wie Erosion und Akkumulation. Es erklärt auch die Entstehung von verschiedenen glazialen Formen wie Kare, Trogtälern und Moränen.
- Eiszeitliche Vergletscherung: Dieses Kapitel diskutiert die Eiszeittheorie und die Vergletscherung der Schweiz während der Eiszeiten. Es beschreibt die Auswirkungen der Eiszeiten auf die Schweizer Landschaft und die Entstehung von wichtigen Landschaftsmerkmalen.
- Heutige Gletscher: Dieses Kapitel behandelt den Zustand der heutigen Gletscher in der Schweiz und beleuchtet die Entwicklung und den Rückgang der Gletscher in den letzten Jahren.
- Abschmelzen & Folgen des Abschmelzens der Gletscher: Dieses Kapitel beleuchtet die Folgen des Gletscherschwunds für den Schweizer Wasserhaushalt und die Umwelt, sowie die Auswirkungen auf die touristische Nutzung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Vergletscherung, Eiszeiten, Gletscher, Gletscherschwund, Wasserhaushalt, Schweizer Alpen, Klimawandel und Landschaftsentwicklung. Sie untersucht die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gletscher und die Folgen des Gletscherschwunds für die Schweiz.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Süßwasser ist in Schweizer Gletschern gespeichert?
In der Schweiz sind rund 2,5 % des Süßwassers in etwa 2000 Gletschern gespeichert (Stand 2000).
Was passiert beim Gletscherschwund mit dem Wasserhaushalt?
Das Abschmelzen der Gletscher verändert die Abflussregime der Flüsse, was langfristig zu Wasserknappheit und Auswirkungen auf die Stromerzeugung führen kann.
Wie entstehen die typischen Formen einer Gletscherlandschaft?
Durch Erosion und Akkumulation des Eises entstehen charakteristische Formen wie Kare, Trogtäler und Moränen.
Welche Rolle spielten die Eiszeiten für die Schweiz?
Während der Eiszeiten war fast die gesamte Schweiz von gigantischen Eissystemen bedeckt, die das heutige Mittelland und die Alpentäler geformt haben.
Sind die Folgen des Gletscherrückgangs auch für den Tourismus relevant?
Ja, der Gletscherschwund beeinträchtigt den Sommerskitourismus und verändert das Landschaftsbild, was Auswirkungen auf die Attraktivität der Alpenregionen hat.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Die Vergletscherung der Schweiz. Gletscher in den Eiszeiten, heutige Gletscher, ihr Schwund und die Folgen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1234733