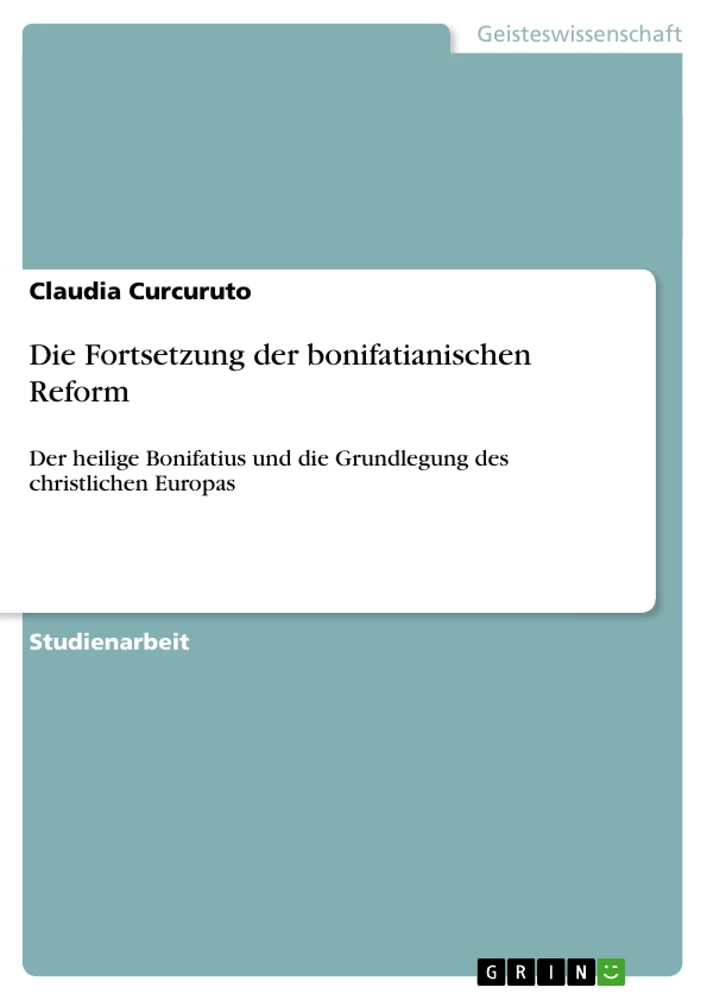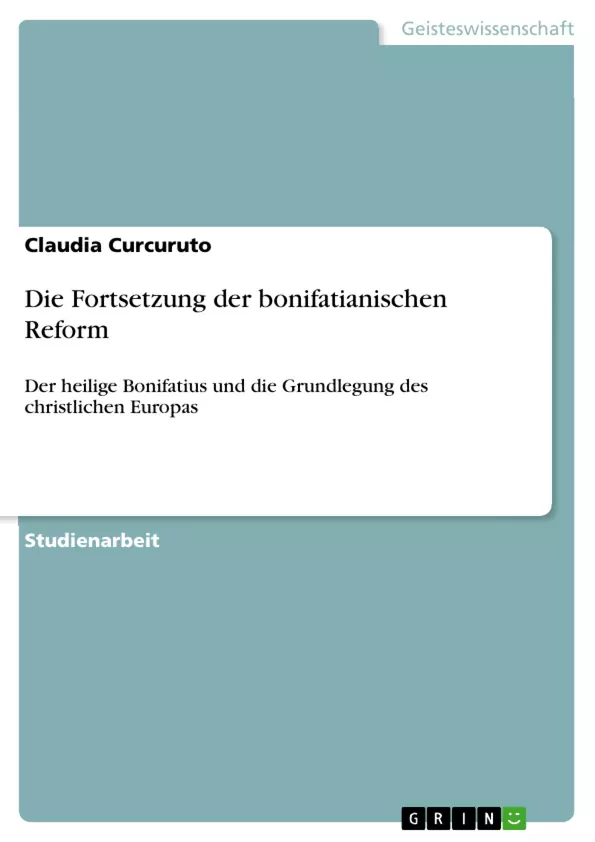Ende des 7. Jahrhunderts erlangte die Tatsache, dass die „römisch“ geprägte angelsächsische Kirche auf das Frankenreich einzuwirken begann, zunächst missionarisch in den nördlichen und östlichen Grenzlanden und dann kirchenreformerisch im Reichsinnern, eine epochale kirchengeschichtliche Bedeutung. Besonders bedeutsam unter all den angelsächsischen Missionaren, welche nach Deutschland hinübergekommen sind, wurde Winfrid, der seit 719 den Ehrentitel Bonifatius trug.
Das Ergebnis seiner Reformtätigkeit waren blühende Kirchenprovinzen in straffer Abhängigkeit von Rom, Klosterneugründungen als Mittelpunkte christlichen Lebens und Stützpunkte der Mission, ein nach Möglichkeit gereinigter Klerus und die Gesinnung des Christenvolkes voll neuen christlichen Geistes.
[...]
Das Interesse dieser Seminararbeit richtet sich in einem kurzen Abriss auf die geschichtliche Darstellung des Lebensganges des Bonifatius, sowie seiner Wirksamkeit und seine Reformtätigkeit. Anschließend hat die Studie die Aufgabe, die Fortsetzung der bonifatianischen Reform mit besonderem Blick auf die Synoden darzustellen und am Schluss die Ergebnisse zusammenzufassen und die Bedeutung der Reformtätigkeit des Bonifatius, wie die Fortsetzung seiner Reformthemen, herauszustellen.
Die Arbeit ist in die folgenden vier Hauptkapitel gegliedert:
I.EINLEITUNG
II.WINFRID – BONIFATIUS. SEIN LEBEN UND WIRKEN
[...]
III. FORTSETZUNG DER BONIFATIANISCHEN REFORM
[...]
IV. SCHLUSSBEMERKUNG
V. ANHANG
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Winfrid – Bonifatius. Sein Leben und Wirken
- 2.1 Das Leben des Winfrid – Bonifatius
- 2.2 Reformtätigkeit des Bonifatius
- 2.3 Verdrängung und Märtyrertod des Bonifatius
- III. Fortsetzung der bonifatianischen Reform
- 3.1 Nachwirken des Bonifatius
- 3.2 Die Synoden unter König Pippin
- 3.2.1 Die Synode von Ver 755 – Mönche und Kanoniker
- 3.2.2 Die Synoden von Verberie 756 und Compiègne 757 – Regelung der Ehefragen
- 3.2.2.1 Verberie 756
- 3.2.2.2 Compiègne 757
- 3.2.3 Die Synode von Attigny 762 – Der Gebetsbund
- 3.3 Ergebnis der bonifatianischen Reform
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit verfolgt das Ziel, die Fortsetzung der bonifatianischen Reform nach dem Tod Bonifatius darzustellen. Sie beleuchtet zunächst Bonifatius' Leben und Wirken, um anschließend die weiterführenden Synoden unter König Pippin und deren Beitrag zur Konsolidierung der Reform zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Kontinuität und Weiterentwicklung bonifatianischer Reformthemen.
- Das Leben und Wirken des heiligen Bonifatius
- Die Reformtätigkeit Bonifatius und ihre Ziele
- Die Synoden unter König Pippin als Fortsetzung der Reform
- Die Entwicklung des kanonischen Rechts im Frankenreich
- Die Bedeutung des Gebetsbundes von Attigny
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die epochale Bedeutung der angelsächsischen Einwirkung auf die fränkische Kirche und die Rolle Bonifatius' bei der Reform.
II. Winfrid – Bonifatius. Sein Leben und Wirken: Dieses Kapitel skizziert Bonifatius' Leben, von seinen Anfängen in England bis zu seiner Tätigkeit als Missionar und Reformer im Frankenreich, inklusive seiner Bischofsweihe und seiner Beziehungen zu den fränkischen Herrschern.
III. Fortsetzung der bonifatianischen Reform: Der Abschnitt behandelt das Nachwirken von Bonifatius' Reform nach seinem Tod. Er beschreibt die Synoden unter König Pippin (Ver, Verberie, Compiègne, Attigny) und deren Fokus auf die Weiterführung und Präzisierung der Reformthemen, insbesondere im kanonischen Eherecht. Der Abschnitt erwähnt die Rolle Chrodegangs bei der Fortführung der Reform.
Schlüsselwörter
Bonifatius, Bonifatianische Reform, Frankenreich, König Pippin, Chrodegang, Synoden, Kirchenreform, Kanonisches Recht, Eherecht, Gebetsbund, Mission, Angelsachsen, Rom.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Bonifatius und was war sein Ziel?
Winfrid, bekannt als Bonifatius, war ein angelsächsischer Missionar, der im 8. Jahrhundert die fränkische Kirche reformierte und straff an Rom band.
Wie wurde die bonifatianische Reform nach seinem Tod fortgesetzt?
Die Reform wurde insbesondere durch eine Reihe von Synoden unter König Pippin fortgeführt, die Themen wie das kanonische Recht und die Klerusdisziplin weiter festigten.
Welche Rolle spielten die Synoden von Verberie und Compiègne?
Diese Synoden (756 und 757) dienten primär der rechtlichen Regelung von Ehefragen im Sinne des kanonischen Rechts und setzten damit die moralische Erneuerung des Klerus fort.
Was war der Gebetsbund von Attigny?
Die Synode von Attigny 762 begründete einen Gebetsbund, der die geistliche Gemeinschaft und die Einheit der reformierten Kirche im Frankenreich stärken sollte.
Welchen Einfluss hatte Chrodegang auf die Fortsetzung der Reform?
Chrodegang von Metz gilt als eine der zentralen Figuren, die nach Bonifatius' Tod die Reformthemen aufgriffen und in die kirchliche Praxis sowie Gesetzgebung integrierten.
- Citar trabajo
- Claudia Curcuruto (Autor), 2006, Die Fortsetzung der bonifatianischen Reform, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123482