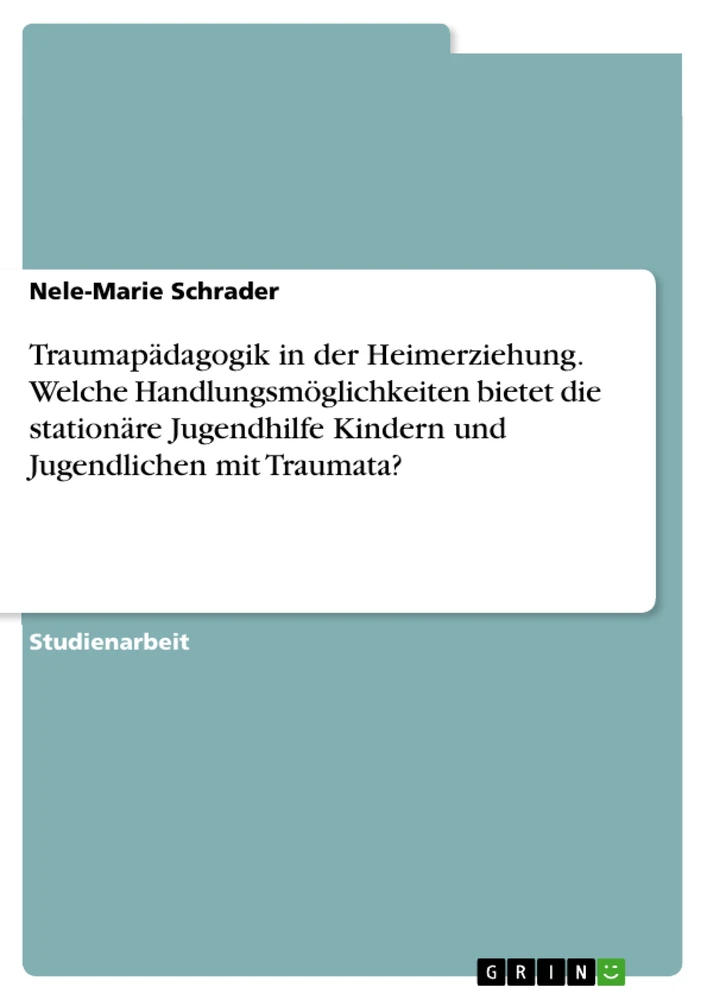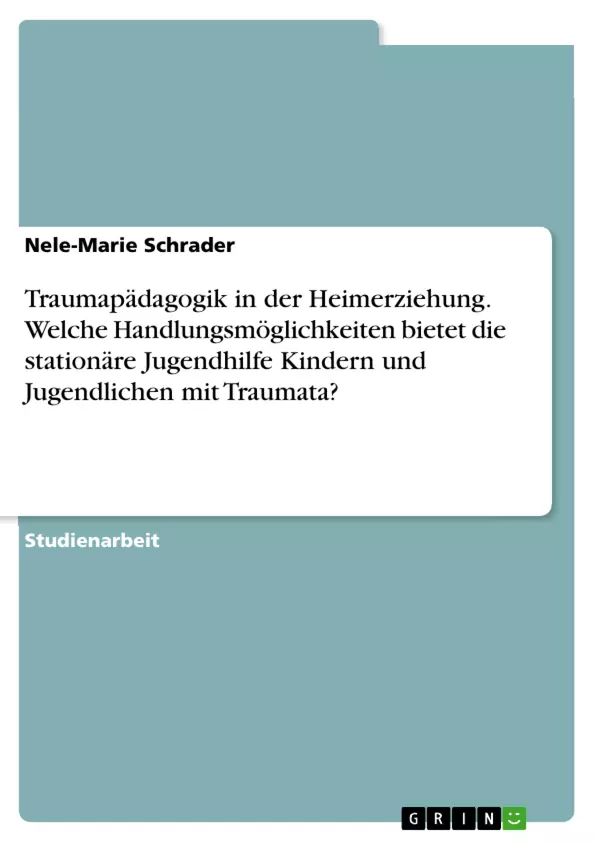In der vorliegenden Arbeit beleuchte ich Traumata bei Kindern und Jugendlichen im stationären Kontext. Vorab ist zu klären, wobei es sich bei einem Trauma und der Traumapädagogik handelt und wie traumapädagogische Ansätze in der sozialpädagogischen Praxis aussehen. Auf den folgenden Seiten soll es im ersten Teil um die Theorie des Traumas, der Ursachen und der Folgen gehen. In diesem möchte ich zudem die Posttraumatische Belastungsstörung und ihre Auswirkung auf Kinder und Jugendliche beleuchten. Im zweiten Teil hingegen, werden vor allem die stationäre Jugendhilfe und Traumapädagogik definiert und traumapädagogisches Handeln dargestellt. Im dritten Teil möchte ich auf den professionellen Umgang mit Traumata in der sozialpädagogischen Praxis eingehen. Diesbezüglich gehe ich auf die Rolle der Professionalität von pädagogischen Fachkräften und möglichen Belastungen ein. Zum Abschluss möchte in einem Fazit die Frage nach Handlungsmöglichkeiten der stationären Jugendhilfe bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen beantworten.
Während meiner Ausbildung zur Staatlich anerkannten Erzieherin habe ich in einer heilpädagogischen Intensivgruppe für Mädchen im Alter zwischen acht bis vierzehn Jahren gearbeitet. Jedes Mädchen wies psychische Belastungen durch traumatische Erfahrungen in der Kindheit auf. Dreiviertel der Adressat*innen wurde eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Störung im Bindungsverhalten diagnostiziert. Die Heimerziehung bietet neben der klinischen Sozialarbeit einen sicheren Ort, an dem traumatisierte Kinder betreut werden. Die pädagogische Arbeit in einer stationären Wohngruppe findet ganzjährig statt und ist somit ein prägender Teil von Kindern und Jugendlichen die dort wohnen. Es ist für die Traumapädagogik in stationären Einrichtungen somit unabdingbar, das pädagogische Fachkräfte für die spezifischen Bedarfe dieser Kinder und Jugendlichen geschult werden, um sie bei der Traumaverarbeitung fachgerecht unterstützen zu können. Die stationäre Unterbringung von traumatisierten Kindern und Jugendlichen wird vermehrt als letzte Möglichkeit aus- gewählt, wenn ambulante Formen nicht den gewünschten Erfolg erbracht haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Trauma
- Definition
- Ursachen und Entstehung von Traumata
- Arten von Kindesmisshandlung
- Vernachlässigung
- Körperliche Misshandlung
- Seelische Misshandlung
- Sexueller Missbrauch
- Traumafolgen
- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
- Folgen einer Posttraumatischen Belastungsstörung im Kindes- und Jugendalter
- Traumapädagogik in der stationären Jugendhilfe
- Definitionen
- Heimerziehung
- Traumapädagogik
- Traumapädagogisches Handeln
- Grundhaltung
- Selbstwirksamkeit und Selbstbemächtigung
- Bindungsaufbau und -sicherung
- Definitionen
- Professioneller Umgang mit Traumata
- Grundkompetenzen von sozialpädagogischen Fachkräften
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Traumata bei Kindern und Jugendlichen im stationären Kontext. Sie untersucht die Definition und Entstehung von Traumata, ihre Folgen sowie die Rolle der Traumapädagogik in der stationären Jugendhilfe. Die Arbeit beleuchtet den professionellen Umgang mit Traumata in der sozialpädagogischen Praxis und untersucht die Frage nach Handlungsmöglichkeiten der stationären Jugendhilfe bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen.
- Definition und Entstehung von Traumata
- Traumafolgen, insbesondere die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
- Traumapädagogik in der stationären Jugendhilfe
- Professioneller Umgang mit Traumata in der sozialpädagogischen Praxis
- Handlungsmöglichkeiten der stationären Jugendhilfe bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Traumata bei Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe ein und erläutert die Relevanz des Themas. Das zweite Kapitel definiert den Begriff "Trauma" und beleuchtet verschiedene Trauma-Typen sowie ihre Ursachen und Folgen. Die Folgen einer Posttraumatischen Belastungsstörung im Kindes- und Jugendalter werden im Detail betrachtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Traumapädagogik in der stationären Jugendhilfe. Es definiert die Begriffe "Heimerziehung" und "Traumapädagogik" und stellt verschiedene traumapädagogische Handlungsansätze vor. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem professionellen Umgang mit Traumata in der sozialpädagogischen Praxis und beleuchtet die Rolle der Professionalität von pädagogischen Fachkräften.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Traumata, Kindesmisshandlung, Traumapädagogik, Heimerziehung, stationäre Jugendhilfe, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), professioneller Umgang mit Traumata, pädagogische Fachkräfte und Handlungsmöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Traumapädagogik?
Traumapädagogik ist ein spezialisierter pädagogischer Ansatz zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, um deren Selbstwirksamkeit und Stabilisierung zu fördern.
Welche Symptome zeigt eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) bei Kindern?
Häufige Symptome sind Bindungsstörungen, Flashbacks, Schlafstörungen, Aggressionen oder emotionaler Rückzug als Folge von Vernachlässigung oder Misshandlung.
Welche Rolle spielt die stationäre Jugendhilfe bei Traumata?
Die Heimerziehung bietet einen „sicheren Ort“, an dem durch geregelte Strukturen und fachliche Betreuung eine Traumaverarbeitung im Alltag ermöglicht wird.
Was sind zentrale traumapädagogische Handlungsansätze?
Dazu gehören der Aufbau sicherer Bindungen, die Förderung der Selbstbemächtigung und eine wertschätzende Grundhaltung der pädagogischen Fachkräfte.
Warum brauchen Erzieher in Intensivgruppen spezielle Schulungen?
Da traumatisierte Kinder oft herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, müssen Fachkräfte professionelle Distanz wahren und spezifische Methoden zur Deeskalation und Stabilisierung beherrschen.
- Citar trabajo
- Nele-Marie Schrader (Autor), 2021, Traumapädagogik in der Heimerziehung. Welche Handlungsmöglichkeiten bietet die stationäre Jugendhilfe Kindern und Jugendlichen mit Traumata?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1235911