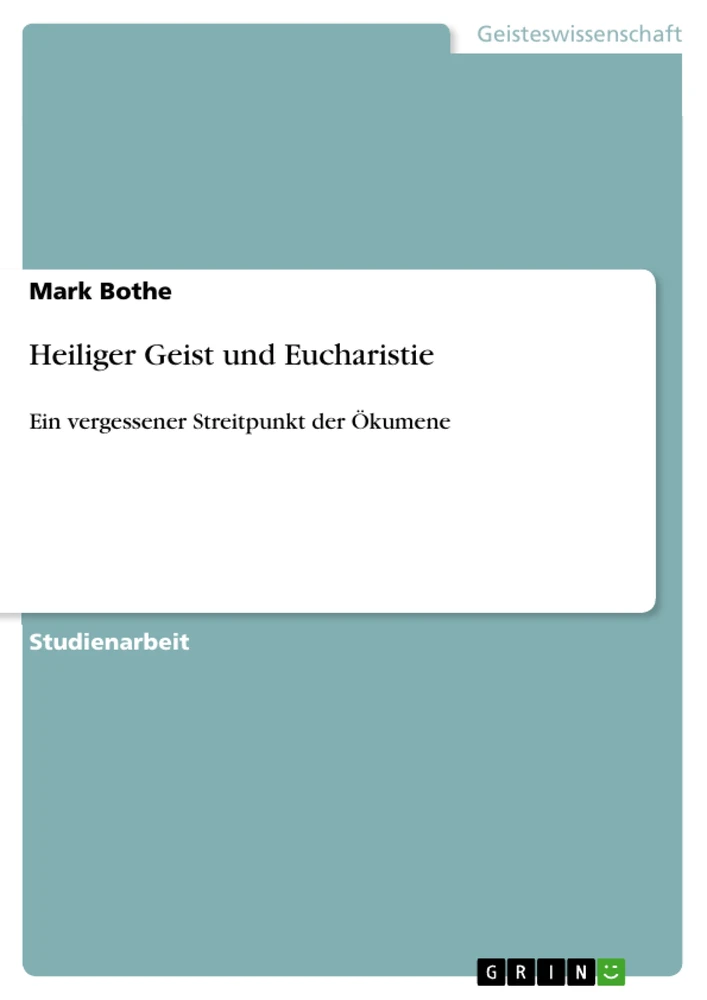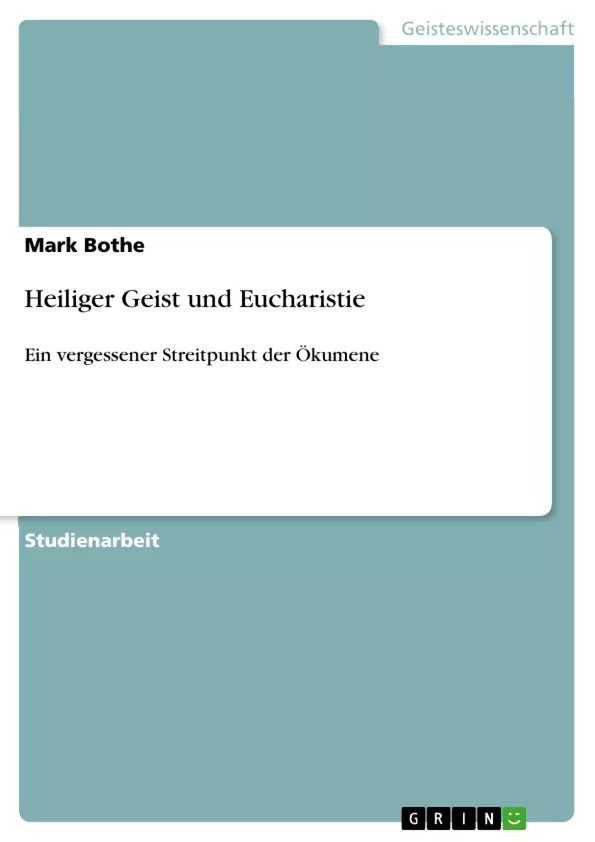Die Spaltung der einen christlichen Kirche in viele Kirchen ist schon immer eines der größten Probleme der Christenheit gewesen. Es steht zweifellos fest, dass es das Ziel der ökumenischen Bewegung sein muss, mit diesen Einzelkirchen wieder eine Einheit zu bilden. Dieser Prozess der Einigung findet vor allem an einem Thema statt: Dem Verständnis der Eucharistie bzw. Abendmahls. Die stellt den Kern des christlichen Lebens dar. In ihr kommt alles zusammen: Das gesamte Leben Jesu Christi mündet in den Moment in dem er mit seinen Jüngern am Abendmahlstisch sitzt.
Gerade diese Tatsache macht es vielen so schwer, von ihrem Standpunkt in der Frage ihres Verständnisses der Eucharistie abzurücken oder auch nur andere Sichtweisen zuzulassen. Daher ist sie einer der größten Streitpunkt in der ökumenischen Diskussion.
Innerhalb der Eucharistiefrage gibt es wiederum verschiedene Punkte, über die gestritten wird: Realpräsenz, Opfer, Wandlung etc. um nur einige zu nennen.
Einer jener Punkte soll in dieser Arbeit näher betrachtet werden: Die Herabrufung des Heiligen Geistes auf die Gaben, oder Epiklese.
In einem katholischen Gottesdienst hat der Moment, in dem der Priester seine Hände über die Gaben hält und um die Geistsendung bittet, etwas durchaus Magisches an sich. Und schnell drängt sich einem der Eindruck auf, dass durch diese Handlung die Gaben in den Leib und das Blut Christi verwandelt würden.
Beschäftigt man sich jedoch eingehender mit der Thematik so fällt als erstes auf, dass das Thema Epiklese oft nur unzureichend, wenn überhaupt, behandelt wird. Dem Kirchenrecht scheint sie sogar recht unwichtig zu sein. Und ein Blick in das Neue Testament offenbart, dass Jesus im letzten Abendmahl den Geist nicht einmal erwähnt. Warum findet also überhaupt eine Epiklese statt? Was bewirkt sie? Und wie lässt sich diese Praxis der katholischen Kirche mit der anderer Kirchen vereinbaren? Diesen Fragen soll in dieser Arbeit nachgegangen werden. Dazu wird zunächst die Position der katholischen Kirche herausgearbeitet werden, um diese dann einer evangelischen Kritik gegenüber zu stellen.
Im Anschluss folgen dann zwei Versuche diese Positionen zu vereinen, gefolgt von einem persönlichen Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Epiklese?
- Wortbedeutung
- Der Ursprung der Epiklese
- Geschichtsverlauf
- Der Heilige Geist
- Die Anrufung in der Praxis
- Epikletische Theologien
- Römisch Katholische Epiklese – Eine Bestandsaufnahme
- Der Heilige Geist bei Theodor Schneider
- Epiklese bei Franz-Josef Nocke
- Kirchenrecht - Die Epiklese als Zusatz
- Kritik an der Epiklese
- Die Epiklese-Kritik von Karl-Hermann Kandler
- Zwischenbilanz
- Ökumene
- Das Lima-Dokument
- Lothar Lies – Ein Versuch der Einigung
- Perichorese
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Liturgische Quellen
- Sonstige Quellen und Quellensammlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Epiklese im Abendmahl, insbesondere ihre Bedeutung im katholischen Ritus und ihren Stellenwert in der ökumenischen Diskussion. Ziel ist es, die Praxis der katholischen Kirche zu beleuchten und sie mit evangelischen Perspektiven zu vergleichen, um mögliche Wege zur Annäherung aufzuzeigen.
- Die Bedeutung der Epiklese in der katholischen Eucharistiefeier
- Der historische Entwicklungsverlauf der Epiklese
- Theologische Perspektiven auf die Epiklese (katholisch und evangelisch)
- Die Rolle der Epiklese in der ökumenischen Theologie
- Möglichkeiten der ökumenischen Verständigung bezüglich der Epiklese
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit der Epiklese im Abendmahl als einen zentralen Streitpunkt in der ökumenischen Diskussion. Sie untersucht die Bedeutung der Epiklese im katholischen Gottesdienst, ihre historische Entwicklung und ihre theologische Fundierung, um Möglichkeiten der ökumenischen Annäherung zu erforschen. Die Arbeit geht der Frage nach, warum eine Epiklese stattfindet, was sie bewirkt und wie sich diese Praxis mit anderen Kirchen vereinbaren lässt. Sie analysiert die katholische Position und stellt sie einer evangelischen Kritik gegenüber, bevor sie Versuche der Versöhnung dieser Positionen beleuchtet.
Was ist Epiklese?: Dieses Kapitel definiert den Begriff Epiklese als die Herabrufung des Heiligen Geistes im Rahmen der Eucharistie. Es erörtert den Ursprung der Epiklese im Judentum und verfolgt ihren geschichtlichen Verlauf von alttestamentlichen Beispielen bis zur endgültigen Formulierung bei Cyrill von Jerusalem. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle des Heiligen Geistes und seiner Wirken im Kontext des Abendmahls gewidmet. Der Abschnitt beleuchtet die unterschiedlichen Auffassungen innerhalb der Kirchengeschichte über die konsekratorische Bedeutung der Epiklese und deren Verhältnis zu den Einsetzungsworten Christi.
Epikletische Theologien: Dieses Kapitel analysiert verschiedene theologische Positionen zur Epiklese. Es untersucht die römisch-katholische Sichtweise, darunter die Auffassungen von Theodor Schneider und Franz-Josef Nocke, und setzt diese in Bezug zum Kirchenrecht und der Kritik, insbesondere der von Karl-Hermann Kandler. Die Kapitelzusammenfassung integriert die verschiedenen Ansätze und diskutiert deren Bedeutung für das Verständnis der Epiklese und deren Rolle im Abendmahl. Es zeigt die Spannungsfelder und die Herausforderungen auf, die sich aus den unterschiedlichen Positionen ergeben.
Ökumene: Dieses Kapitel behandelt die ökumenische Dimension der Epiklese. Es bezieht sich auf das Lima-Dokument und den Versuch von Lothar Lies, die unterschiedlichen Positionen zu versöhnen, wobei die Perichorese als wichtiges Konzept diskutiert wird. Die Zusammenfassung fasst die Bemühungen um eine ökumenische Einigung in Bezug auf das Verständnis und die Praxis der Epiklese zusammen, beleuchtet die Herausforderungen und die Bedeutung der unterschiedlichen theologischen Perspektiven im ökumenischen Dialog.
Schlüsselwörter
Epiklese, Eucharistie, Abendmahl, Heiliger Geist, Ökumene, katholische Theologie, evangelische Theologie, Lima-Dokument, Theodor Schneider, Franz-Josef Nocke, Karl-Hermann Kandler, Lothar Lies, Perichorese, Kirchenrecht, Konsekration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Epiklese im Abendmahl
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Epiklese im Abendmahl, insbesondere ihre Bedeutung im katholischen Ritus und ihren Stellenwert in der ökumenischen Diskussion. Ziel ist der Vergleich der katholischen Praxis mit evangelischen Perspektiven und die Aufzeigen möglicher Annäherungswege.
Was ist eine Epiklese?
Eine Epiklese ist die Herabrufung des Heiligen Geistes im Rahmen der Eucharistie. Die Arbeit verfolgt ihren geschichtlichen Verlauf vom Judentum bis zur endgültigen Formulierung bei Cyrill von Jerusalem und beleuchtet die Rolle des Heiligen Geistes im Kontext des Abendmahls sowie unterschiedliche Auffassungen zu ihrer konsekratorischen Bedeutung und dem Verhältnis zu den Einsetzungsworten Christi.
Welche theologischen Positionen zur Epiklese werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene theologische Positionen, insbesondere die römisch-katholische Sichtweise (darunter die Auffassungen von Theodor Schneider und Franz-Josef Nocke), setzt diese in Bezug zum Kirchenrecht und der Kritik (z.B. von Karl-Hermann Kandler). Es werden die Spannungsfelder und Herausforderungen aus den unterschiedlichen Positionen diskutiert.
Welche Rolle spielt die Ökumene in der Arbeit?
Die ökumenische Dimension der Epiklese wird anhand des Lima-Dokuments und des Versuchs von Lothar Lies zur Versöhnung unterschiedlicher Positionen (unter Einbezug des Konzepts der Perichorese) behandelt. Die Arbeit fasst die Bemühungen um ökumenische Einigung zusammen und beleuchtet Herausforderungen und die Bedeutung unterschiedlicher theologischer Perspektiven im ökumenischen Dialog.
Welche Kapitel enthält die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, einer Definition von Epiklese (inkl. Wortbedeutung, Ursprung, Geschichtsverlauf und Praxis), epikletischen Theologien (inkl. katholischer Positionen, Kirchenrecht und Kritik), Ökumene (inkl. Lima-Dokument und Versuchen der Einigung) und Ausblick sowie einem Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Epiklese, Eucharistie, Abendmahl, Heiliger Geist, Ökumene, katholische Theologie, evangelische Theologie, Lima-Dokument, Theodor Schneider, Franz-Josef Nocke, Karl-Hermann Kandler, Lothar Lies, Perichorese, Kirchenrecht und Konsekration.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Praxis der katholischen Kirche bezüglich der Epiklese und vergleicht sie mit evangelischen Perspektiven, um mögliche Wege zur Annäherung aufzuzeigen. Die Bedeutung der Epiklese in der katholischen Eucharistiefeier, ihre historische Entwicklung, theologische Perspektiven (katholisch und evangelisch), ihre Rolle in der ökumenischen Theologie und Möglichkeiten ökumenischer Verständigung sind zentrale Themen.
- Citation du texte
- Mark Bothe (Auteur), 2004, Heiliger Geist und Eucharistie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123679