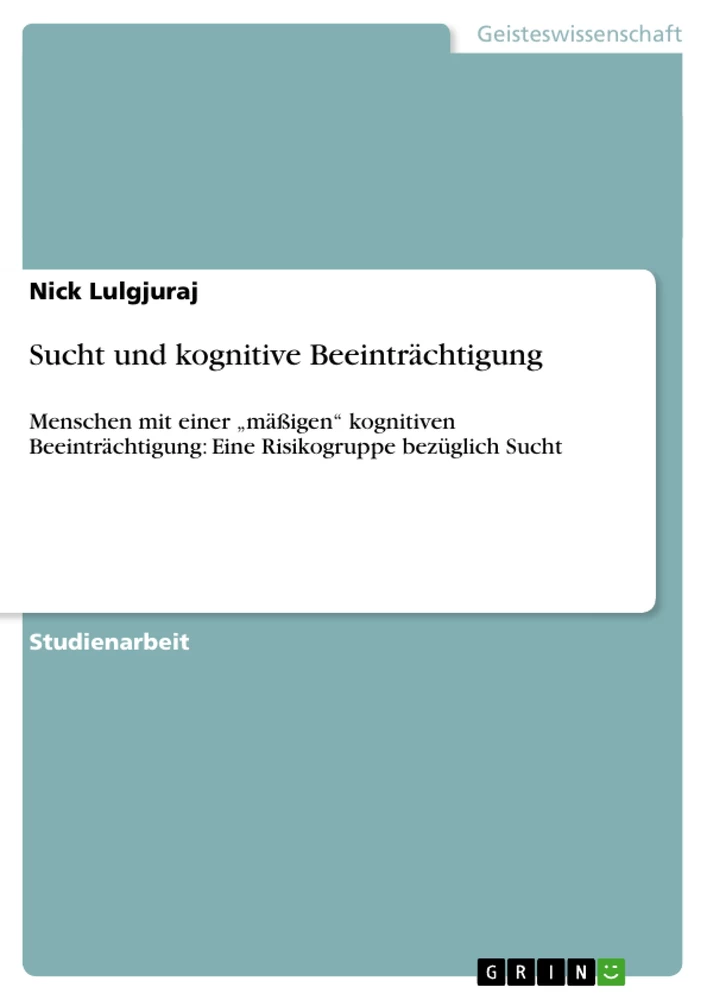Das Thema dieser Theoriearbeit, Sucht und kognitive Beeinträchtigung, ist ein in der Behindertenhilfe neu zu betrachtendes Phänomen. Substanziell geht es hier um das Zusammenwirken zwischen diesen beiden Beeinträchtigungen. Präziser formuliert um die Wirkung und Relevanz der Sucht bei Menschen mit einer mäßigen kognitiven Beeinträchtigung. Ich gehe davon aus, dass diese Gruppe mit großen Risiken zu kämpfen hat. An dieses Erkenntnisinteresse ist meine Fragestellung geknüpft:
Anhand welcher Kriterien, resp. Faktoren, sind Menschen mit einer mäßigen kognitiven Beeinträchtigung, die ein eher selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen können (z.B. unterstützes Wohnen, kleine Wohngemeinschaften, gemietete Wohnungen etc.), gemäß der Theorie nach Beer eine Risikogruppe bezüglich Sucht (Missbrauch von legalen Drogen)?
Menschen flüchten sich in Drogen wie Alkohol, Tabak usw. und leiden unter den Folgen dieses Konsums, wenn dieser kein Genuss mehr ist, sondern eine Sucht, die durch das soziale Milieu im breiteren Sinne bestimmt wird. Darüber hinaus wird dieser Konsum unter Erwachsenen normalerweise als selbstverständlich angesehen und ist trotz seiner schädlichen Wirkung gesellschaftlich akzeptiert. Dagegen wird in Bezug auf Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung davon ausgegangen, dass diese das Thema Sucht nicht betrifft. Der Drogengebrauch, resp. -missbrauch, sowie Sucht als Krankheit ist eine Reaktion auf den Zusammenbruch des sozialen Gefüges und trägt zugleich entscheidend dazu bei, die dadurch bewirkten gesundheitlichen Ungleichheiten weiter zu verstärken. Er eröffnet einen scheinbaren Fluchtweg aus schwierigen Lebenslagen und Stresssituationen, verschlimmert die Probleme jedoch. Dieses Phänomen gilt genauso für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Diese sind darüber hinaus noch gefährdeter, da sie aufgrund ihrer kognitiven Beeinträchtigung im Zusammenspiel mit Sucht als psychische Störung eine begrenzte Palette von Problemlösungsstrategien besitzen, um solche Probleme ohne Unterstützung zu bewältigen. Dies trifft vor allem auf Menschen zu, bei denen eine mäßige kognitive Beeinträchtigung diagnostiziert wurde.
(...)
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1 Einleitung
- 1.1 Vorverständnis
- 1.2 These und Fragestellung
- 1.3 Theorie
- 2 Begriffsklärung
- 2.1 Droge und Missbrauch
- 2.2 Sucht versus Abhängigkeit
- 2.3 Kognitive Beeinträchtigung
- 3 Entwicklung der Behindertenhilfe
- 3.1 Normalisierung
- 3.2 Dezentralisierung
- 3.3 Selbstbestimmung
- 3.4 Inklusion
- 4 Sucht und Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung
- 4.1 Rahmenbedingungen
- 4.2 Intra- und interpersonelle Faktoren
- 4.3 Anfälligkeit für psychische Störungen
- 4.4 Vulnerabilität für Sucht
- 4.5 Verifizierung der These
- 5 Kritische Würdigung
- 5.1 Erkenntnisse für die Behindertenhilfe
- 5.2 Theorieeinwand
- 5.3 Selbstreflexion
- 5.4 Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Theoriearbeit untersucht das relativ neue Phänomen von Sucht bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Kontext der Behindertenhilfe. Das Hauptziel ist es, die Risiken von Sucht bei Personen mit mäßiger kognitiver Beeinträchtigung zu beleuchten und anhand theoretischer Ansätze zu erklären. Die Arbeit fokussiert auf die Wechselwirkung zwischen kognitiver Beeinträchtigung und Suchtentwicklung.
- Die veränderten Lebenswelten von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen durch Reformen in der Behindertenhilfe (Dezentralisierung, Normalisierung, Selbstbestimmung).
- Intra- und interpersonelle Faktoren, die die Vulnerabilität für Sucht erhöhen (z.B. mangelnde Problemlösungsstrategien, geringes Selbstwertgefühl, Stigmatisierung).
- Die Anfälligkeit für psychische Störungen als Risikofaktor für Suchtentwicklung bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.
- Die Anwendung von Beers Theorie zur Erklärung der erhöhten Suchtanfälligkeit dieser Gruppe.
- Die Implikationen der Ergebnisse für die Praxis der Behindertenhilfe.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sucht und kognitive Beeinträchtigung ein und stellt die zentrale These auf, dass Menschen mit mäßiger kognitiver Beeinträchtigung ein erhöhtes Sucht-Risiko aufweisen. Die Fragestellung der Arbeit wird formuliert: Anhand welcher Kriterien sind diese Personen gemäß Beers Theorie eine Risikogruppe? Die Einleitung legt das methodische Vorgehen der Theoriearbeit dar und skizziert die zentralen Forschungsfragen. Die Arbeit beleuchtet den bestehenden Wissensmangel zu diesem Thema in der Behindertenhilfe.
2 Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der Arbeit, darunter „Droge“, „Missbrauch“, „Sucht“, „Abhängigkeit“ und „kognitive Beeinträchtigung“. Es werden verschiedene Definitionen und Abgrenzungen diskutiert und die jeweiligen Zusammenhänge erläutert, um eine einheitliche terminologische Basis für die weiteren Kapitel zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Präzisierung der verwendeten Begriffe im Kontext der Suchtproblematik und kognitiver Einschränkungen.
3 Entwicklung der Behindertenhilfe: Dieses Kapitel beschreibt die historischen Entwicklungen in der Behindertenhilfe, beginnend mit dem Normalisierungsgedanken und weiterführend zu Dezentralisierung, Selbstbestimmung und Inklusion. Es zeigt auf, wie diese Entwicklungen die Lebensbedingungen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen verändert haben und welche Auswirkungen diese Veränderungen auf die Suchtproblematik haben könnten. Die Bedeutung von gesellschaftlicher Teilhabe und die Herausforderungen bei der Umsetzung der Inklusion werden diskutiert.
4 Sucht und Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung: Dieses Kapitel analysiert die Faktoren, die zur erhöhten Vulnerabilität von Menschen mit mäßiger kognitiver Beeinträchtigung für Sucht beitragen. Es werden sowohl Rahmenbedingungen (z.B. soziale Isolation, mangelnde Unterstützung) als auch intra- und interpersonelle Faktoren (z.B. geringe Selbstkontrolle, niedriges Selbstwertgefühl) untersucht. Die Anfälligkeit dieser Gruppe für psychische Störungen wird als zusätzlicher Risikofaktor beleuchtet. Das Kapitel untersucht die These anhand von Beers Theorie und präsentiert erste Ergebnisse.
5 Kritische Würdigung: Dieses Kapitel bietet eine kritische Reflexion der Ergebnisse und des gesamten Forschungsprozesses. Es werden die gewonnenen Erkenntnisse für die Praxis der Behindertenhilfe diskutiert. Mögliche Einwände gegen die verwendete Theorie werden thematisiert und in den Kontext der Gesamtargumentation eingeordnet. Die Arbeit schließt mit einer Selbstreflexion des Forschungsprozesses und einer Schlussbetrachtung.
Schlüsselwörter
Kognitive Beeinträchtigung, Sucht, Abhängigkeit, Behindertenhilfe, Risikofaktoren, Normalisierung, Dezentralisierung, Selbstbestimmung, Inklusion, Intra- und interpersonelle Faktoren, Beers Theorie, Problemlösungsstrategien, Vulnerabilität, psychische Störungen, legale Drogen, Alkohol, Nikotin.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Theoriearbeit: Sucht und Kognitive Beeinträchtigung
Was ist der Hauptfokus dieser Theoriearbeit?
Die Arbeit untersucht das erhöhte Sucht-Risiko bei Menschen mit mäßiger kognitiver Beeinträchtigung im Kontext der Behindertenhilfe. Sie beleuchtet die Wechselwirkung zwischen kognitiver Beeinträchtigung und Suchtentwicklung und erklärt diese anhand theoretischer Ansätze, insbesondere Beers Theorie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die veränderten Lebenswelten von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen durch Reformen in der Behindertenhilfe (Dezentralisierung, Normalisierung, Selbstbestimmung), intra- und interpersonelle Faktoren, die die Vulnerabilität für Sucht erhöhen (z.B. mangelnde Problemlösungsstrategien, geringes Selbstwertgefühl, Stigmatisierung), die Anfälligkeit für psychische Störungen als Risikofaktor für Suchtentwicklung, die Anwendung von Beers Theorie zur Erklärung der erhöhten Suchtanfälligkeit und die Implikationen der Ergebnisse für die Praxis der Behindertenhilfe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein, formuliert die These und Fragestellung. Kapitel 2 (Begriffsklärung) definiert zentrale Begriffe. Kapitel 3 (Entwicklung der Behindertenhilfe) beschreibt historische Entwicklungen in der Behindertenhilfe. Kapitel 4 (Sucht und Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung) analysiert die Faktoren, die zur erhöhten Vulnerabilität beitragen. Kapitel 5 (Kritische Würdigung) reflektiert die Ergebnisse und den Forschungsprozess kritisch.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Kognitive Beeinträchtigung, Sucht, Abhängigkeit, Behindertenhilfe, Risikofaktoren, Normalisierung, Dezentralisierung, Selbstbestimmung, Inklusion, Intra- und interpersonelle Faktoren, Beers Theorie, Problemlösungsstrategien, Vulnerabilität, psychische Störungen, legale Drogen, Alkohol, Nikotin.
Welche These wird in der Arbeit aufgestellt?
Die zentrale These ist, dass Menschen mit mäßiger kognitiver Beeinträchtigung ein erhöhtes Sucht-Risiko aufweisen.
Welche Fragestellung wird in der Arbeit bearbeitet?
Die Arbeit untersucht, anhand welcher Kriterien diese Personen gemäß Beers Theorie eine Risikogruppe darstellen.
Welche methodische Vorgehensweise wird in der Arbeit beschrieben?
Die Einleitung beschreibt das methodische Vorgehen der Theoriearbeit und skizziert die zentralen Forschungsfragen. Die Arbeit beleuchtet den bestehenden Wissensmangel zu diesem Thema in der Behindertenhilfe.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Das Kapitel "Kritische Würdigung" bietet eine kritische Reflexion der Ergebnisse und des gesamten Forschungsprozesses. Es werden die gewonnenen Erkenntnisse für die Praxis der Behindertenhilfe diskutiert, mögliche Einwände gegen die verwendete Theorie thematisiert und eine Selbstreflexion des Forschungsprozesses sowie eine Schlussbetrachtung präsentiert.
- Citar trabajo
- Nick Lulgjuraj (Autor), 2008, Sucht und kognitive Beeinträchtigung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123740