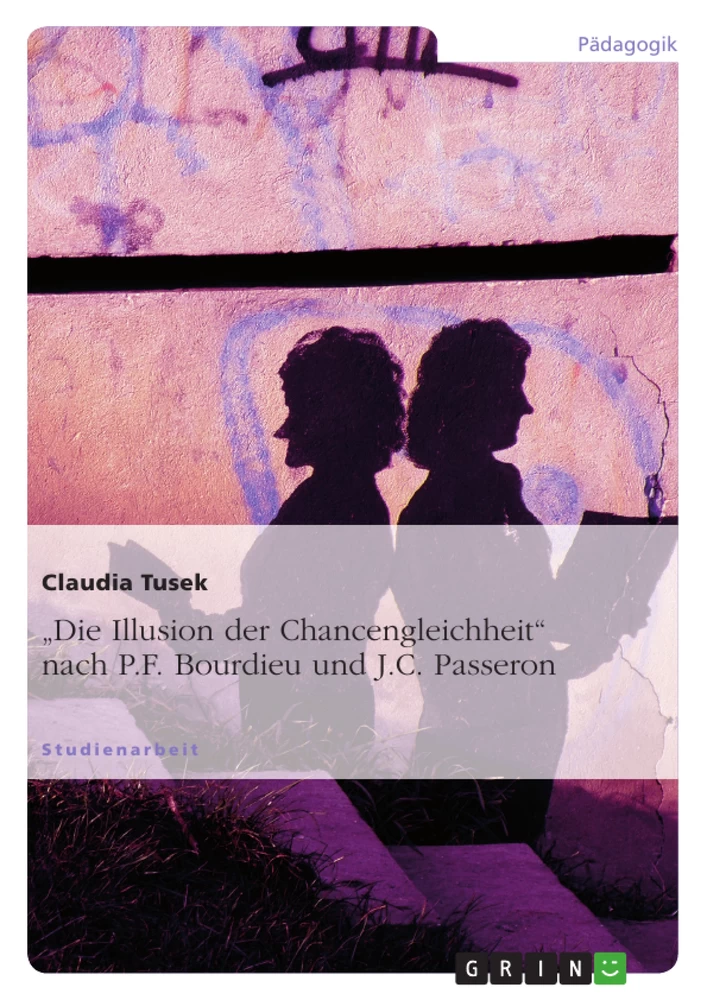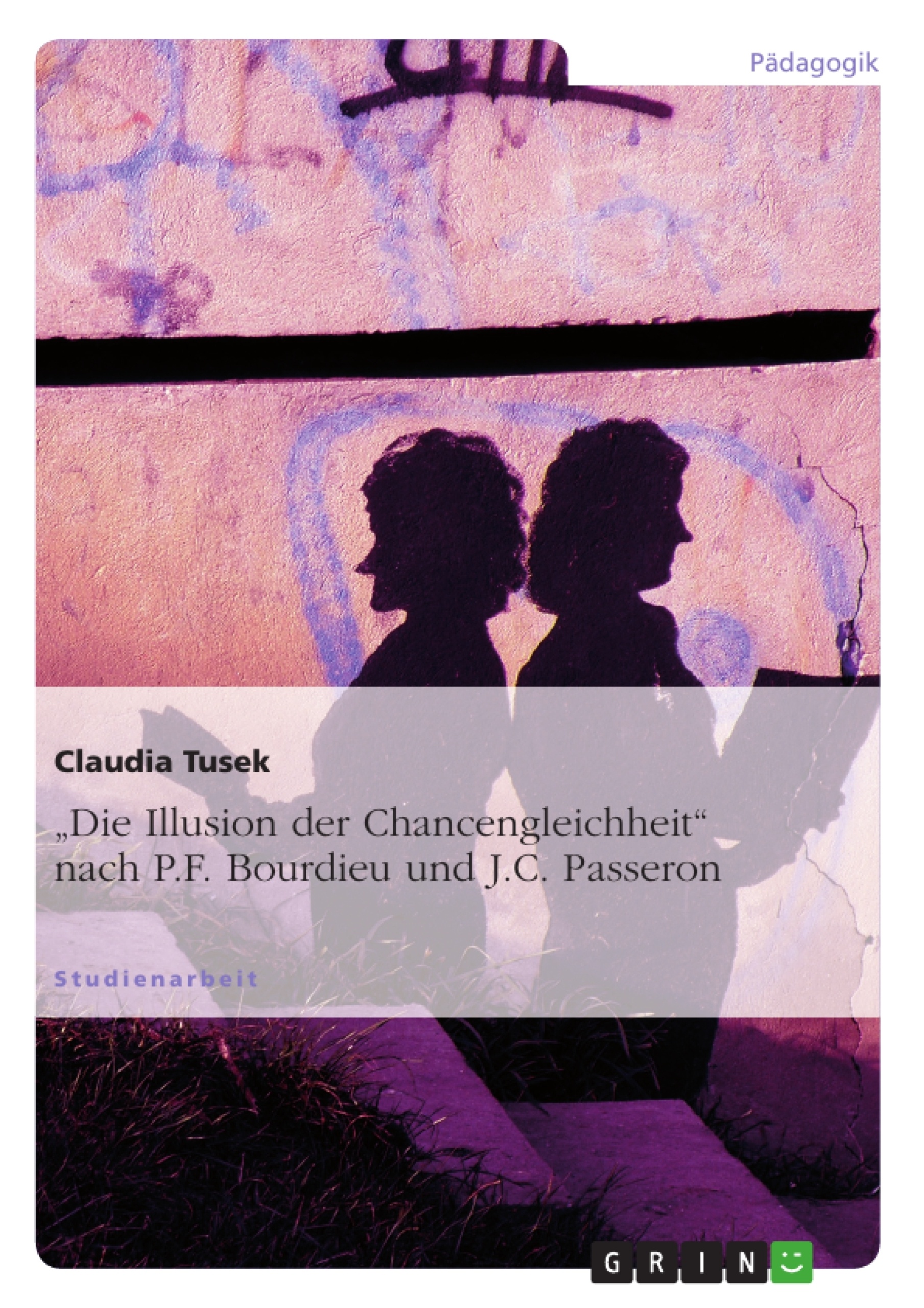Obwohl formale Gleichheiten im französischen Bildungssystem seit Jahrzehnten angestrebt und verwirklicht wurden, existieren - nach Meinung von Bourdieu und Passeron - nach wie vor Chancenungleichheiten aufgrund sozialer Herkunft. Die Autoren haben mit ihrer Studie einerseits aufgezeigt, dass es diese Unterschiede tatsächlich gibt, andererseits auch versucht dazulegen, dass gerade das Bildungssystem selbst die Chancengleichheiten verhindert - und dies sogar systematisch versucht zu legitimieren. „In der Schule geht es demnach also nicht nur um Erziehung und (Aus-)Bildung, sondern auch um Selektion.“
Das meritokratische Selektionssystem in Frankreich gibt vor, „alle“ nach ihren Fähigkeiten auszuwählen, ist aber in der Realität ein starres System der Privilegiertenauswahl. Die Selektion passiert schon weit vor dem Hochschulzugang und so bleibt vom Ruf nach „Bildung für alle!“ nur „Die Illusion der Chancengleichheit“. „Die soziale Herkunft ist zweifellos unter allen Differenzierungsfaktoren derjenige, der sich im Studentenmilieu am stärksten auswirkt, stärker jedenfalls als Geschlecht und Alter, vor allem aber stärker als ein so manifester Faktor wie die Religion.“
Eine Kurzbiographie des „großen“ französischen Soziologen Bourdieu steht am Beginn dieser Arbeit. Anschließend werden die wichtigsten Aspekte seiner „Kulturtheorie“ und seines – von ihm geprägtem – „Kapitalbegriffes“ dargestellt und erläutert. Hierbei soll auch verdeutlicht werden, dass Bourdieu sich immer um relationales Denken bemüht hat. Er versuchte die Struktur in einem Forschungsfeld aufzudecken und als Abbild der Gesellschaft darzustellen.
Dies erscheint notwendig, um die zentralen Aussagen der empirischen Studie „Die Illusion der Chancengleichheit“ (besser) verstehen zu können. Darin werden einerseits die unterschiedliche soziale Herkunft und der Studienerfolg der Studenten behandelt, andererseits die Theorien der Autoren vorgestellt, dass die Universitäten ihre Strukturen der Chancenungleichheiten – trotz formaler Reformen – bewusst beibehalten. Abschließend wird noch auf den Aspekt der „Kommunikation in der Pädagogik“, also der Sprache und ihrer Bedeutung im Bildungswesen näher eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kurzbiographie Pierre Bourdieu
- 3. ,,Die feinen Unterschiede“
- 3.1. Habitus
- 3.2. Soziale Felder
- 3.3. Kapital
- 3.3.1 Ökonomisches Kapital
- 3.3.2 Soziales Kapital
- 3.3.3 Kulturelles Kapital
- 3.3.4 Symbolisches Kapital
- 3.4. Sozialer Raum
- 4. Die Illusion der Chancengleichheit
- 4.1. Inhaltliche Zusammenfassung
- 4.2. Zentrale Aussagen der Studie
- 4.2.1. Soziale Klassen und soziale Herkunft
- 4.2.2. Wirtschaftliche Ungleichheiten
- 4.2.3. Kulturelles Privileg
- 4.2.4. Studentenmilieu
- 4.2.5. Starrheit des Hochschulsystems
- 4.3. Kommunikation in der Pädagogik
- 4.3.1. Missverständnis zwischen Professor und Student
- 4.3.2. Bürgerliche Sprache und Vulgärsprache
- 4.3.3. Sprachcodes nach Basil Bernstein
- 4.3.4. Bedeutung der Kommunikation in der Pädagogik
- 5. Zusammenfassung
- 6. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Pierre Bourdieus und Jean-Claude Passerons empirische Bildungsstudie „Die Illusion der Chancengleichheit“ (1971). Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Biografie Bourdieus und erläutert zentrale Konzepte seiner soziologischen Theorie, insbesondere den Habitus, soziale Felder und die verschiedenen Kapitalformen. Anschließend wird die Studie selbst analysiert, wobei der Fokus auf die zentrale These der anhaltenden Ungleichheit im Bildungssystem trotz formaler Reformen liegt.
- Bourdieus soziologische Theorie und deren Schlüsselbegriffe (Habitus, Kapital, soziale Felder)
- Die empirischen Ergebnisse der Studie „Die Illusion der Chancengleichheit“
- Die Rolle sozialer Herkunft und kulturellen Kapitals im Bildungserfolg
- Die Bedeutung von Kommunikation und Sprache im Bildungskontext
- Die Kritik am Hochschulsystem und dessen Beitrag zur Reproduktion sozialer Ungleichheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung Bourdieus für die Soziologie und Bildungsforschung dar und umreißt den Aufbau der Arbeit. Die Kurzbiographie Pierre Bourdieus skizziert seinen Lebenslauf und seine akademische Karriere. Das Kapitel zu „Die feinen Unterschiede“ erklärt zentrale Konzepte wie Habitus, soziale Felder und verschiedene Kapitalformen. Die Illusion der Chancengleichheit wird in Bezug auf soziale Herkunft, wirtschaftliche Ungleichheiten und kulturelle Privilegien untersucht, wobei der Fokus auf der Reproduktion sozialer Ungleichheiten im Hochschulsystem liegt. Der Abschnitt zur Kommunikation in der Pädagogik beleuchtet die Bedeutung von Sprache und Sprachcodes im Bildungsprozess und die damit verbundenen Missverständnisse.
Schlüsselwörter
Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, „Die Illusion der Chancengleichheit“, Habitus, Kapital (ökonomisch, sozial, kulturell, symbolisch), soziale Felder, soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Hochschulsystem, Kommunikation, Sprache, Sprachcodes, soziale Herkunft, kulturelles Kapital.
- Quote paper
- Claudia Tusek (Author), 2007, "Die Illusion der Chancengleichheit" nach P.F. Bourdieu und J.C. Passeron, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123817