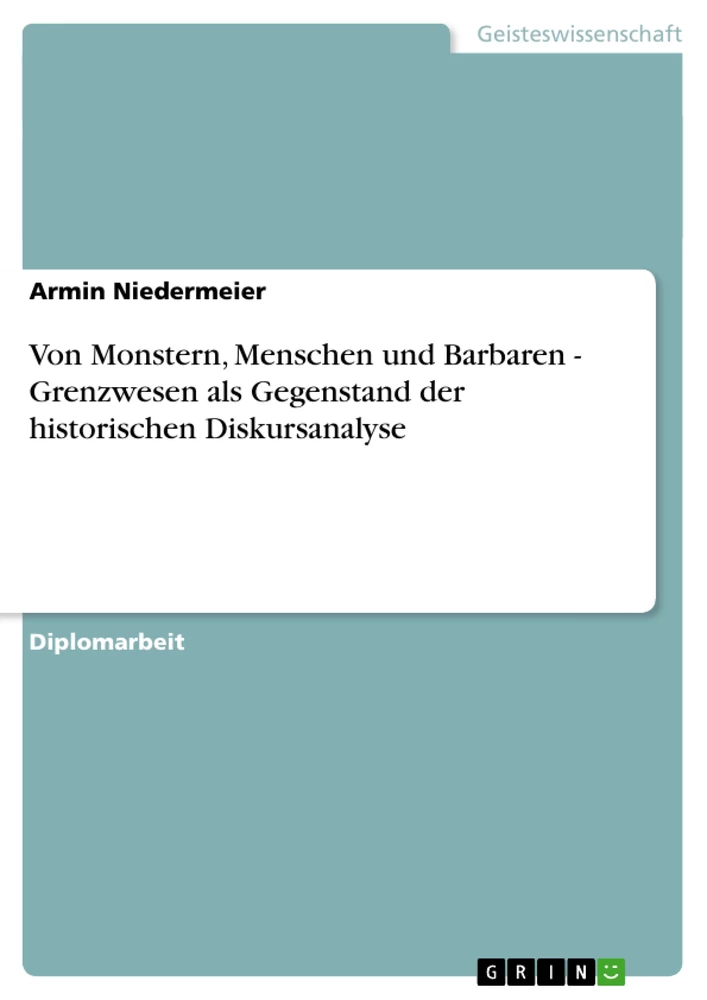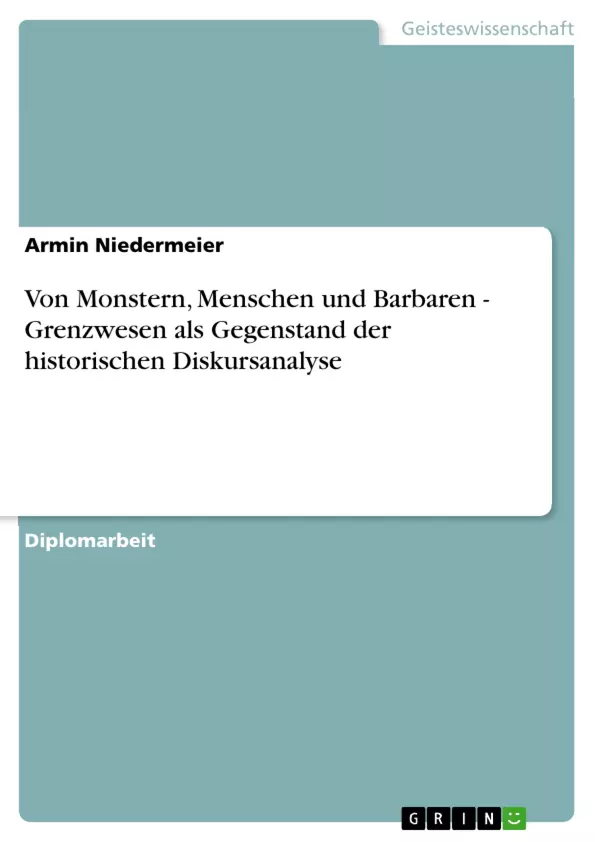Thema der vorliegenden Diplomarbeit sind „Monster, Menschen und Barbaren als Gegenstand der historischen Diskursanalyse“. Monster und Barbaren sondern sich durch ihren Mangel oder Überfluss bestimmter Eigenschaften von der menschlichen Gesellschaft ab. Damit stehen sie am Rand, aber nicht außerhalb derselben. Als Grenzwesen erfüllen sie eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Indem sie uns zeigen, wie wir nicht sein sollen, geben sie uns eine mögliche Antwort darauf, wie wir sein sollen. Damit sind sie im wahrsten Sinn des Wortes negative Identifikationsfiguren. Das Monster ist nur deshalb monströs, weil wir es dazu machen. Etwas von Natur aus Monströses, geistig wie physisch Abscheuliches, gibt es nicht, weil die Natur nicht zwischen „gut“ und „böse“ unterscheidet. In der Natur überleben jene, die an ihre Umgebung am besten angepasst sind. Der Natur ist es dabei gleichgültig, ob die „Gejagten“ gut und die „Jäger“ böse sind, da sie nicht nach solchen Kriterien urteilt. Die Natur arbeitet mit dem binären Code „fressen“ und
„gefressen werden“. Ob der Menschenfressende Tiger böse ist oder nicht, interessiert sie nicht. Der Tiger ist auch nicht deswegen böse, weil er Menschen frisst, sondern weil er für die um ihn lebenden Menschen eine Gefahr darstellt. Da er für den Menschen eine Gefahr darstellt, ihm nicht geheuer ist, wird er zum Un-geheuer. Monster spielen nicht nur im sogenannten. finsteren Mittelalter eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Dass wir auch in unserer scheinbar so „aufgeklärten Zeit“ andere häufig als kulturell oder zivilisatorisch minderwertig betrachten, wenn sie nicht den gängigen kulturellen Standards entsprechen, beweisen zahlreiche Beispiele der jüngeren Geschichte. Die Erfahrung mit unserer eigenen Vergangenheit hat gezeigt, wie leicht menschenverachtende Verbrechen bsw. mit Rückgriff auf Darwins Evolutionstheorie gerechtfertigt werden können. Die Nationalsozialisten übersetzten das englische Wort „struggle“ das wohl eher mit Wettbewerb als mit Kampf übersetzt werden kann, mit dem Recht des Stärkeren, sich auf Kosten des Schwächeren durchzusetzen. Natürliche Auslese und Selektion war in der Ideologie des NS-Regimes mit dem Ausmerzen scheinbar „unwerten Lebens“ verbunden. Dabei geht die Arbeit der Frage nach, wie weit die verschiedenen Theorien über den Urspung des Lebens sich mit dem Deckmäntelchen des Rationalen umgaben, um zur Diskriminierung "Andersartiger" herangezogen zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorwort
- II. Theoretische Vorbemerkungen
- III. Einleitung
- IV. Begriffsbildung und Abgrenzung
- V. Die Zeichenhaftigkeit des Monsters
- VI. Das Monster im Weltbild des Mittelalters
- VI.1. Die Funktion der Monster am Romanischen Kirchenbau
- VI.2. Vom Physiologus zu den Bestiarien
- VI.3. Das Monster auf den deutschen Flugschriften des 15. und 16. Jahrhunderts
- VII. Die Heimat des Monsters am Rande der christlichen Ökumene
- VII.1. Das Monster in der mittelalterlichen Kartographie
- VII.2. Die Überlieferung antiker Reiseberichte
- VII.3. Die Erweiterung des Horizonts - Reiseberichte im Mittelalter
- VII.4. Weltchronik mit enzyklopädischem Anspruch
- VIII. Vom Mythos zum Logos
- VIII.1. Von der Verbannung des Satyrs
- VIII.2. Über die Entstehung teratologischer Arten
- VIII.3. Vom biblischen Schöpfungsbericht zu Darwins Evolutionstheorie
- VIII.3.1. Biblische Erklärungen über den Ursprung der Arten
- VIII.3.2. Von Heraklet zu Arsistoteles: Antike Ansätze evolutionären Denkens
- VIII.3.3. Von den Monaden zu Darwins Evolutionstheorie
- VIII.4. Der lange Schatten Darwins: Die Genese des Sozialdarwinismus
- IX. Die Rückkehr des Monsters
- IX.1. Der zivilisatorische Rang des „Wilden“
- IX.2. Rätselhafte Affenmenschen - Vom Big Foot zum Orang Pendek
- IX.3. Das Monster als Archetyp der Popkultur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Darstellung von Grenzwesen, insbesondere Monstern, in historischen Diskursen. Ziel ist es, die Funktion und Bedeutung dieser Darstellungen im Kontext verschiedener Epochen und Weltbilder zu analysieren.
- Die Entwicklung des Monster-Bildes vom Mittelalter bis zur Moderne
- Die Rolle von Monstern in religiösen und wissenschaftlichen Diskursen
- Der Einfluss antiker und mittelalterlicher Reiseberichte auf die Vorstellung von „Andersartigen“
- Die Verbindung zwischen dem Mythos des Monsters und der Entstehung des Sozialdarwinismus
- Die Rezeption des Monster-Archetyps in der Popkultur
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort gibt einen Einblick in die Entstehung der Arbeit. Die theoretischen Vorbemerkungen legen die Grundlage für die begriffliche Abgrenzung. Die Einleitung führt in die Thematik ein. Kapitel IV beschäftigt sich mit der Begriffsbildung. Kapitel V analysiert die Zeichenhaftigkeit des Monsters. Kapitel VI untersucht das Monster im mittelalterlichen Weltbild, unterteilt in die Funktion der Monster am Kirchenbau, die Bestiarien und die deutschen Flugschriften. Kapitel VII betrachtet die Darstellung von Monstern am Rande der christlichen Ökumene, einschließlich mittelalterlicher Kartographie und Reiseberichte. Kapitel VIII beleuchtet den Wandel vom Mythos zum Logos, mit Fokus auf antike und moderne evolutionäre Denkweisen und den Sozialdarwinismus. Kapitel IX befasst sich mit der Rückkehr des Monsters in der Moderne, einschließlich des „Wilden“, kryptozoologischen Wesen und der Popkultur.
Schlüsselwörter
Monster, Grenzwesen, historische Diskursanalyse, Mittelalter, Reiseberichte, Evolutionstheorie, Sozialdarwinismus, Popkultur, Anthropologie, Mythos, Logos.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die gesellschaftliche Funktion von „Monstern“ in der Geschichte?
Monster fungieren als negative Identifikationsfiguren. Indem sie zeigen, was „unmenschlich“ oder „abnorm“ ist, definieren sie indirekt die Normen und Werte der menschlichen Gesellschaft.
Welche Rolle spielten Monster im Mittelalter?
Im Mittelalter dienten sie oft als religiöse Zeichen an Kirchenbauten oder wurden in Bestiarien und Reiseberichten als Bewohner der Ränder der bekannten Welt (Ökumene) dargestellt.
Wie veränderte sich das Monster-Bild durch den Sozialdarwinismus?
Mit dem Übergang vom Mythos zum Logos wurden vermeintlich „minderwertige“ Eigenschaften wissenschaftlich rationalisiert, was zur Diskriminierung und Entmenschlichung „Andersartiger“ führte.
Was versteht man unter der „Zeichenhaftigkeit des Monsters“?
Monster werden als Symbole gelesen, die moralische oder göttliche Botschaften vermitteln sollen – ihre körperliche Deformation steht oft stellvertretend für eine geistige Verfehlung.
Gibt es Monster auch in der modernen Popkultur?
Ja, das Monster bleibt ein Archetyp in der Popkultur (z. B. King Kong, Big Foot), wobei es heute oft zwischen Bedrohung und tragischer Außenseiterfigur schwankt.
- Arbeit zitieren
- Armin Niedermeier (Autor:in), 2009, Von Monstern, Menschen und Barbaren - Grenzwesen als Gegenstand der historischen Diskursanalyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123844