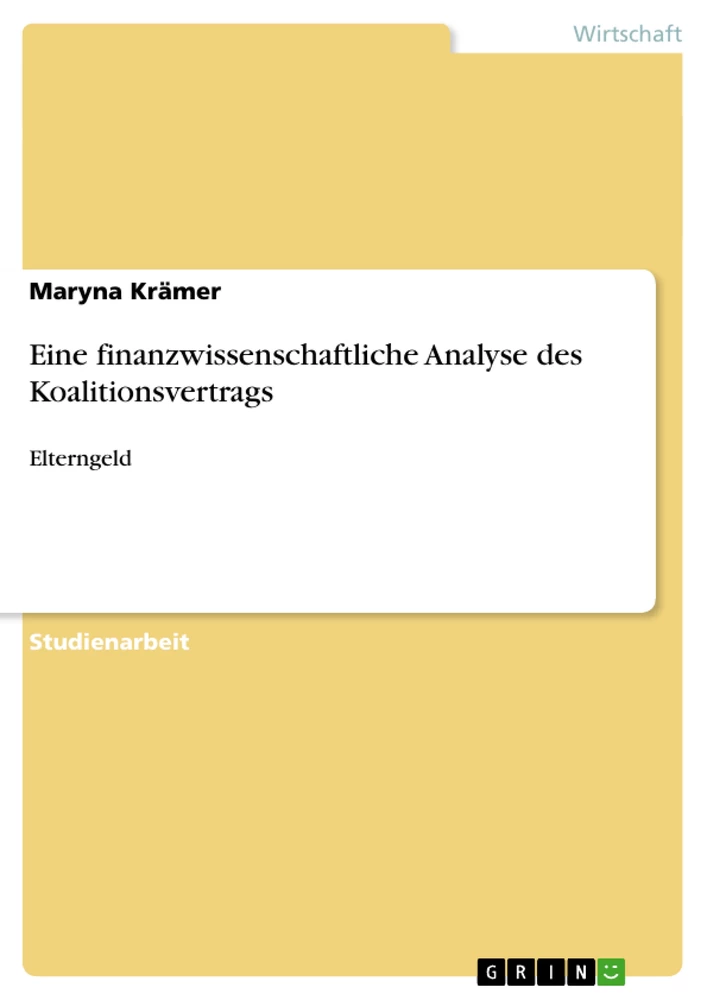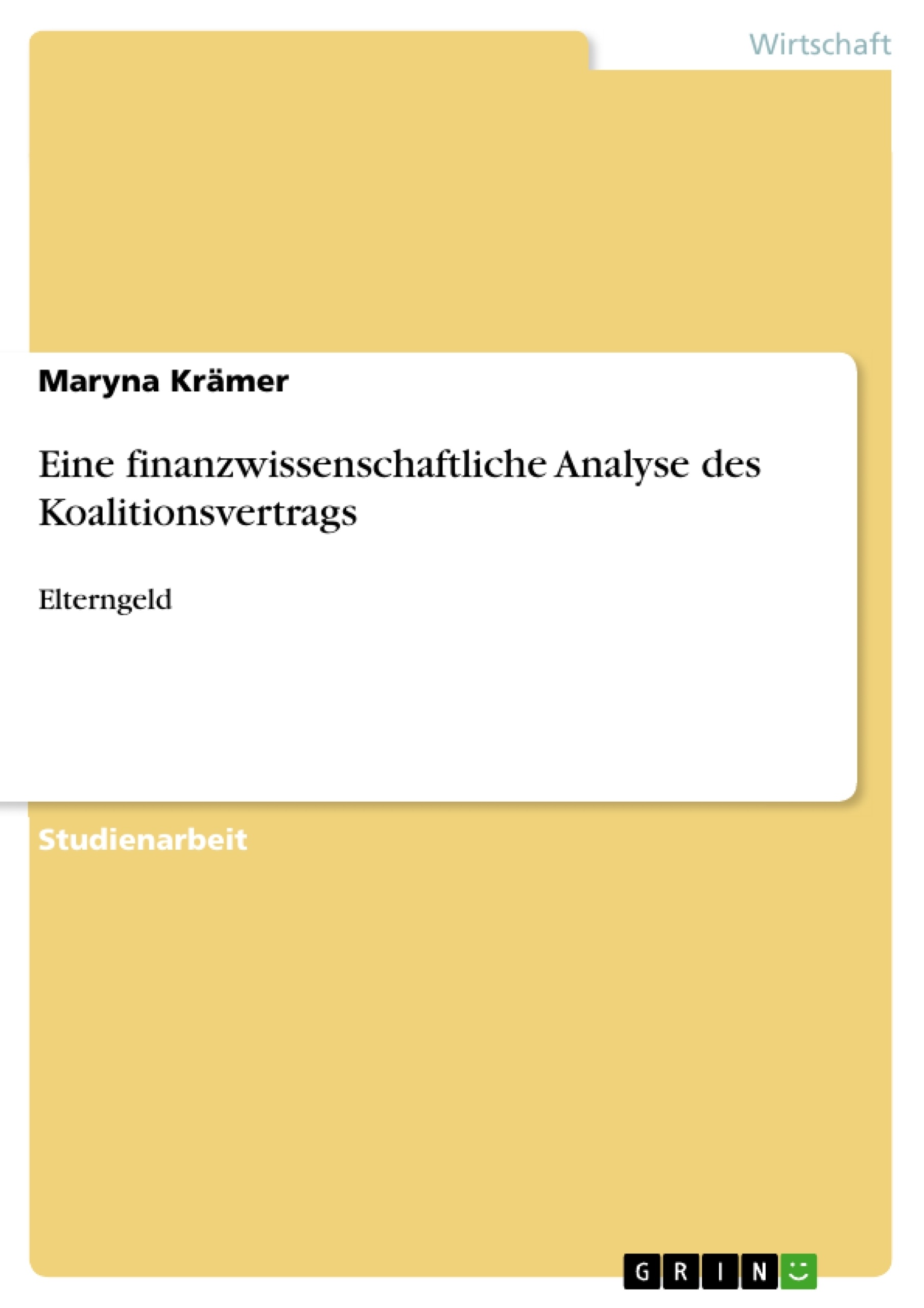Im Folgenden wird auf die Ziele der Familienpolitik eingegangen und eine der größten vorgesehenen Maßnamen „das Elterngeld“ analysiert. Dazu erfolgt zunächst eine Abgrenzung der Ziele der neuen Familienpolitik, die sich im Koalitionsvertrag widerspiegeln. Anschließend sollen die wesentlichen Eckpunkte des Elterngeldes und eine Parallele zur den Fördermaßnahmen aus Schweden dargestellt werden. Mit diesen Grundlagen wird dann auf die Kritikpunkte der Öffentlichkeit eingegangen und untersucht, inwiefern diese Kritik begründet ist. Im letzten Teil der Arbeit erfolgt eine kritische Würdigung des dargestellten Sachverhalts.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Familienpolitische Ziele
- Allgemeine Ziele der Politik
- Ziele nach dem Koalitionsvertrag
- Eckpunkte zur Einführung den neuen Elterngeldes
- Von Erziehungsgeld zum Elterngeld
- Was soll das neue Elterngeld bewirken
- Chancengleichheit von Mann und Frau
- Vergleich von monetären Förderungen von Familien und Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen
- Erfahrung aus dem Ausland in parallel Vergleich zu Deutschland
- Können die Ziele des Koalitionsvertrags erfüllt werden und das Elterngeld Erfolg haben?
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Ziele der Familienpolitik im Kontext des demografischen Wandels in Deutschland und bewertet die Einführung des Elterngeldes als zentrale Maßnahme. Die Arbeit untersucht die Ziele des Koalitionsvertrages und vergleicht diese mit allgemeinen Zielen der Familienpolitik. Weiterhin wird ein Vergleich mit ausländischen Modellen durchgeführt.
- Demografischer Wandel und seine Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft
- Ziele der Familienpolitik: quantitative und qualitative Nachhaltigkeit, Leistungsausgleich, Transparenz
- Analyse des Elterngeldes als Instrument der Familienpolitik
- Vergleich des deutschen Elterngeldes mit internationalen Modellen
- Bewertung der Erfolgsaussichten des Elterngeldes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den demografischen Wandel in Deutschland und die Notwendigkeit familienpolitischer Maßnahmen. Kapitel 2 definiert die allgemeinen Ziele der Familienpolitik (quantitative und qualitative Nachhaltigkeit, Leistungsausgleich, Transparenz) und die im Koalitionsvertrag festgelegten Ziele. Kapitel 3 präsentiert die Eckpunkte des neuen Elterngeldes, seine beabsichtigten Wirkungen, und den Vergleich mit anderen Fördermodellen. Kapitel 4 beleuchtet internationale Erfahrungen im Vergleich zu Deutschland. Kapitel 5 untersucht die Erfolgschancen des Elterngeldes im Hinblick auf die Erreichung der Koalitionsziele.
Schlüsselwörter
Familienpolitik, Demografischer Wandel, Elterngeld, Erziehungsgeld, Geburtenrate, quantitative Nachhaltigkeit, qualitative Nachhaltigkeit, Chancengleichheit, internationaler Vergleich, Koalitionsvertrag.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptziele des Elterngeldes laut Koalitionsvertrag?
Die Ziele umfassen die finanzielle Absicherung der Eltern nach der Geburt, die Förderung der Chancengleichheit von Mann und Frau sowie die Steigerung der Geburtenrate angesichts des demografischen Wandels.
Wie unterscheidet sich das Elterngeld vom alten Erziehungsgeld?
Das Elterngeld ist eine Einkommensersatzleistung, die sich am vorherigen Verdienst orientiert, während das Erziehungsgeld eine einkommensabhängige Sozialleistung mit meist niedrigeren Pauschalbeträgen war.
Welche Rolle spielt Schweden als Vorbild für das deutsche Elterngeld?
Schweden gilt mit seinem Modell der großzügigen Elternzeit und der hohen Väterbeteiligung als erfolgreiches Beispiel für eine moderne Familienpolitik, die in Deutschland als Orientierung diente.
Fördert das Elterngeld tatsächlich die Chancengleichheit?
Ja, durch Anreize für Väter, ebenfalls Elternzeit zu nehmen, soll die traditionelle Rollenverteilung aufgebrochen und die Rückkehr von Müttern in den Beruf erleichtert werden.
Welche Kritikpunkte gibt es am Elterngeld?
Kritisiert wird oft, dass einkommensstarke Familien stärker profitieren als Geringverdiener und dass monetäre Leistungen allein nicht ausreichen, wenn die Kinderbetreuungsinfrastruktur fehlt.
- Arbeit zitieren
- Maryna Krämer (Autor:in), 2006, Eine finanzwissenschaftliche Analyse des Koalitionsvertrags, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123864