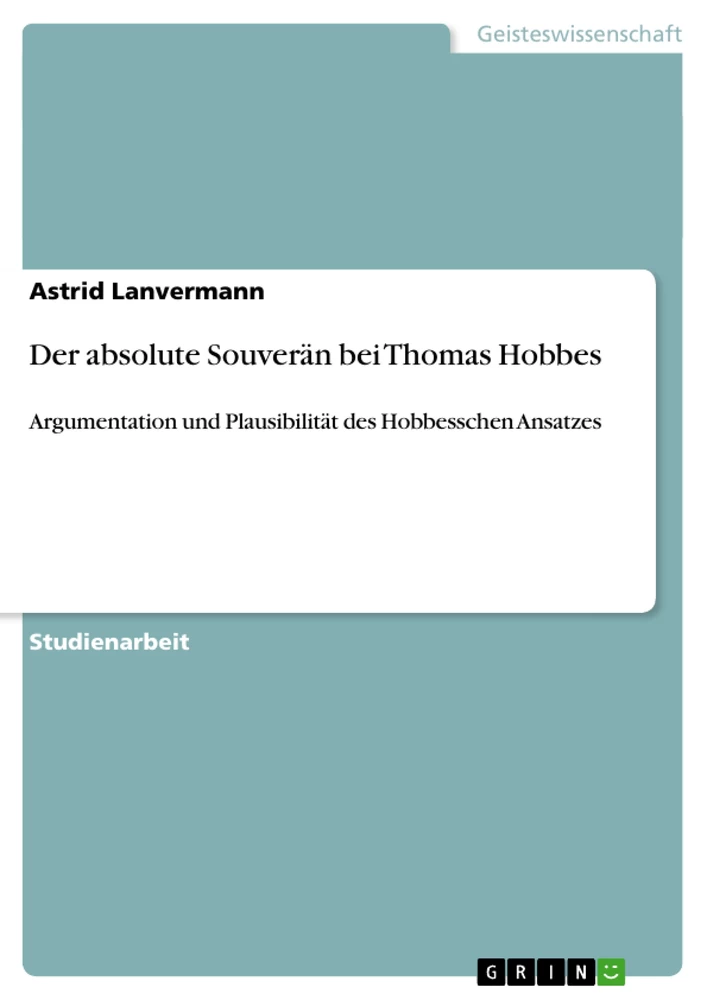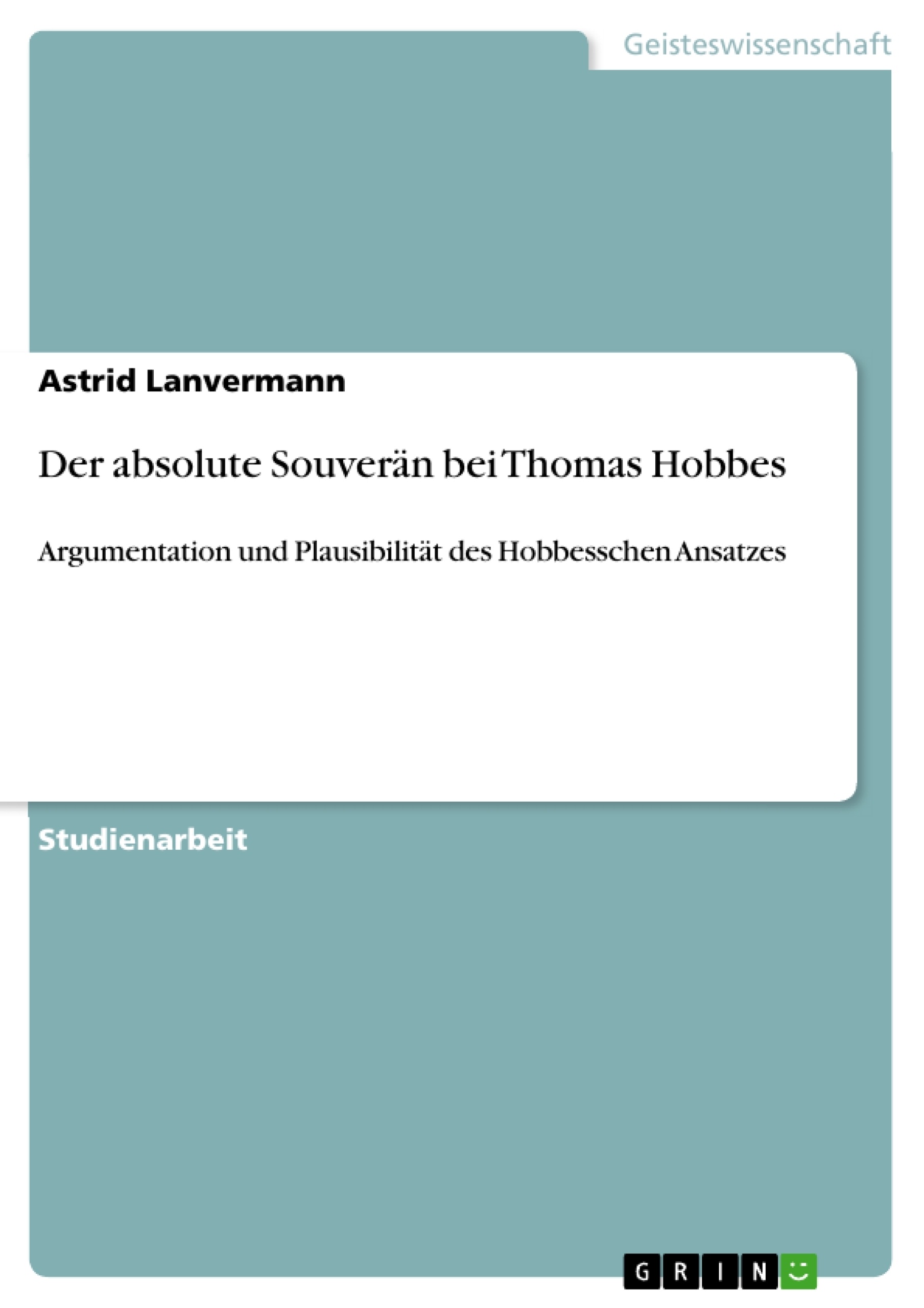Thomas Hobbes (1588-1679) lebte in einer Zeit der politischen und religiösen Unruhen, die in den englischen Bürgerkrieg (1637-1660) gipfelten. Das Miterleben dieses Krieges - obgleich zum Teil nur aus der Distanz - prägte sein Menschenbild und seine politische Philosophie. Sein Ziel war die Schaffung eines Staates, welcher der Anarchie eines derartigen Bürgerkrieges vorbeugen konnte. Er versuchte die realen, unübersichtlichen Bündnisse und ideologischen Zusammenhänge auszublenden, um sich auf den Einzelnen, das Individuum und die Kräfte, die es antreiben, zu besinnen. Diese Methode bezeichnet Herfried Münkler als Dekontextualisierung. Um die Menschen zu verstehen, brauche man nur sich selbst zu beobachten, da allen Individuen ähnliche Leidenschaften zu Eigen seien. Lediglich die Objekte, auf die sich jene Leidenschaften bezögen, seien von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Entsprechend seines Programms behandelt er daher im ersten Teil des Leviathans den Menschen, seine Eigenschaften und Fähigkeiten, ebenso wie seine Leidenschaften, seine Vernunft und deren Werke. Zu diesen Werken zählen auch die natürlichen Gesetze, die in der hobbesschen Theorie jedoch nicht mehr ewig und dauerhaft verpflichtend gelten, sondern nur unter der Voraussetzung, dass durch ihre Erfüllung die Sicherheit des Individuums nicht gefährdet wird. Es handelt sich also weniger um Gesetze als um Normen, da es keine Macht gibt, die sie durchsetzen könnte. Vor allem im dreizehnten Kapitel zeichnet der Philosoph das Bild eines stets zur Gewalt bereiten Menschen, der nur innerhalb eines Staates wahren Frieden und Sicherheit erleben kann, wenngleich Hobbes den Staat an dieser Stelle noch nicht explizit nennt. Erst in den Kapiteln siebzehn und achtzehn versucht er die Einrichtung eines Staates als Solchen, des Souveräns und dessen weitreichender Rechte zu legitimieren. Diese Argumentation wird im Folgenden nachvollzogen und kritisch untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Historische Einordnung
- 2.1.1. Die Situation in England
- 2.1.2. Vorläufer des Hobbesschen Modells
- 2.2. Der Ansatz
- 2.2.1. Die Argumentationsstruktur
- 2.2.1.1. Die Gründe für die Entstehung eines Staates
- 2.2.1.2. Die Entstehung eines Staates
- 2.2.1.3. Die Definition eines Staates
- 2.2.1.4. Die Rechte des Souveräns
- 2.2.2. Die Interpretationsansätze
- 2.2.2.1. Die Charakteristika des Vertrages
- 2.2.2.2. Die Autorisierung des Souveräns
- 2.2.2.3. Die Souveränitätsrechte
- 2.2.2.4. Die Letztinstanzlichkeit
- 2.2.3. Die Kritik am Ansatz
- 2.2.3.1. Die Grenzen der Gehorsamspflicht
- 2.2.3.2. Der Zirkelschluss
- 2.2.1. Die Argumentationsstruktur
- 2.1. Historische Einordnung
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Thomas Hobbes' Konzept des absoluten Souveräns im Leviathan. Ziel ist es, die Argumentationsstruktur und Plausibilität dieses Ansatzes im Kontext der englischen Bürgerkriege zu analysieren. Dabei werden sowohl die historischen Hintergründe als auch die vertragstheoretischen Grundlagen beleuchtet.
- Der Einfluss des englischen Bürgerkriegs auf Hobbes' Philosophie
- Die Argumentationsstruktur von Hobbes' Konzept des absoluten Souveräns
- Die Legitimation und Autorisierung des Souveräns im Vertragstheoretischen Ansatz
- Kritikpunkte an Hobbes' Modell und deren Relevanz
- Die Plausibilität von Hobbes' Ansatz zur Legitimation des Souveräns
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den historischen Kontext, in dem Hobbes' Werk entstand. Sie hebt die Bedeutung des englischen Bürgerkriegs für die Entwicklung von Hobbes' politischer Philosophie hervor und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Entstehung eines Staates, der zukünftige Bürgerkriege verhindern soll. Die Dekontextualisierungsmethode Münklers wird erwähnt, die sich auf das Individuum und dessen Leidenschaften konzentriert, um die Triebkräfte menschlichen Handelns zu verstehen. Hobbes' Fokus auf die Sicherheit des Individuums wird als Ausgangspunkt für seine Theorie der natürlichen Gesetze, die eher Normen als Gesetze sind, herausgestellt.
2.1. Historische Einordnung: Dieses Kapitel liefert den historischen Hintergrund für Hobbes' Werk. Es beschreibt die politische und soziale Situation in England während des Bürgerkriegs, dessen drei Phasen (schottische, englische und irische Rebellion) detailliert dargestellt werden. Der Konflikt zwischen König und Parlament wird beleuchtet, inklusive der Ursachen und des Verlaufs. Die Ereignisse des Bürgerkriegs werden als entscheidender Einflussfaktor für Hobbes' Denken hervorgehoben, insbesondere die Instabilität und die Gewalt, die den Staat bedrohten. Die Rolle des Königs, des Parlaments und Cromwells wird dargelegt und der Einfluss der Restauration der Monarchie wird diskutiert, die einen Kompromiss zwischen König und Parlament bedeutete und das Parlament stärkte.
2.1.1. Die Situation in England: Dieser Abschnitt beschreibt den englischen Bürgerkrieg und seine Auswirkungen auf Hobbes‘ Denken. Der Bürgerkrieg wird als zentrales Ereignis für das Verständnis von Hobbes‘ politischer Philosophie identifiziert, ohne jedoch in detaillierte historische Analysen einzugehen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Instabilität und Gewalt, die Hobbes’ Wunsch nach einem starken Souverän begründete.
2.1.2. Vorläufer des Hobbesschen Modells: Dieser Abschnitt widmet sich den Vorläufern von Hobbes’ Modell, und betont, dass Hobbes’ Ideen nicht im Vakuum entstanden sind, sondern sich auf bereits bestehende politische Konzepte beziehen. Obwohl Details fehlen, legt dieser Teil nahe, dass Hobbes' Theorie im Kontext vorheriger politischer Denker und deren Einfluss auf die Entwicklung seines eigenen Systems zu verstehen ist.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Thomas Hobbes' Konzept des absoluten Souveräns
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert Thomas Hobbes' Konzept des absoluten Souveräns im Leviathan, seine Argumentationsstruktur und Plausibilität im Kontext der englischen Bürgerkriege. Sie beleuchtet die historischen Hintergründe und vertragstheoretischen Grundlagen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss des englischen Bürgerkriegs auf Hobbes' Philosophie, die Argumentationsstruktur seines Konzepts des absoluten Souveräns, die Legitimation und Autorisierung des Souveräns im Vertragstheoretischen Ansatz, Kritikpunkte an Hobbes' Modell und dessen Relevanz, sowie die Plausibilität von Hobbes' Ansatz zur Legitimation des Souveräns.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit verschiedenen Unterkapiteln zur historischen Einordnung (inkl. Situation in England und Vorläufer des Modells), Hobbes' Ansatz (Argumentationsstruktur, Interpretationsansätze und Kritik), und einen Schluss. Der Hauptteil ist detailliert untergliedert, um die Argumentation schrittweise zu analysieren.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext von Hobbes' Werk, die Bedeutung des englischen Bürgerkriegs für seine politische Philosophie und die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Es wird der Fokus auf die Entstehung eines Staates zur Vermeidung zukünftiger Bürgerkriege und die Dekontextualisierungsmethode Münklers erwähnt. Hobbes' Fokus auf die Sicherheit des Individuums und seine Theorie der natürlichen Gesetze (als Normen) werden ebenfalls herausgestellt.
Was beinhaltet die historische Einordnung?
Die historische Einordnung liefert den Hintergrund zu Hobbes' Werk. Sie beschreibt die politische und soziale Situation in England während des Bürgerkriegs (inkl. der drei Phasen: schottische, englische und irische Rebellion), den Konflikt zwischen König und Parlament, sowie die Rolle des Königs, des Parlaments und Cromwells. Der Einfluss der Restauration der Monarchie und der Kompromiss zwischen König und Parlament werden diskutiert.
Was wird in den Unterkapiteln zur "Situation in England" und den "Vorläufern des Hobbesschen Modells" behandelt?
Der Abschnitt "Situation in England" beschreibt den englischen Bürgerkrieg und seine Auswirkungen auf Hobbes' Denken, fokussiert auf Instabilität und Gewalt. Der Abschnitt "Vorläufer des Hobbesschen Modells" behandelt die vorherigen politischen Konzepte, die Hobbes' Theorie beeinflusst haben.
Welche Aspekte von Hobbes' Ansatz werden untersucht?
Hobbes' Ansatz wird hinsichtlich seiner Argumentationsstruktur, verschiedener Interpretationsansätze und Kritikpunkte analysiert. Die Unterkapitel befassen sich mit den Gründen für die Entstehung eines Staates, der Entstehung und Definition eines Staates, den Rechten des Souveräns, den Charakteristika des Vertrages, der Autorisierung des Souveräns, den Souveränitätsrechten, der Letztinstanzlichkeit, den Grenzen der Gehorsamspflicht und dem Zirkelschluss in seiner Argumentation.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Der HTML-Ausschnitt enthält keine Zusammenfassung des Schlusskapitels. Daher kann diese Frage nicht beantwortet werden.)
- Quote paper
- Magistra Artium Astrid Lanvermann (Author), 2003, Der absolute Souverän bei Thomas Hobbes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123868