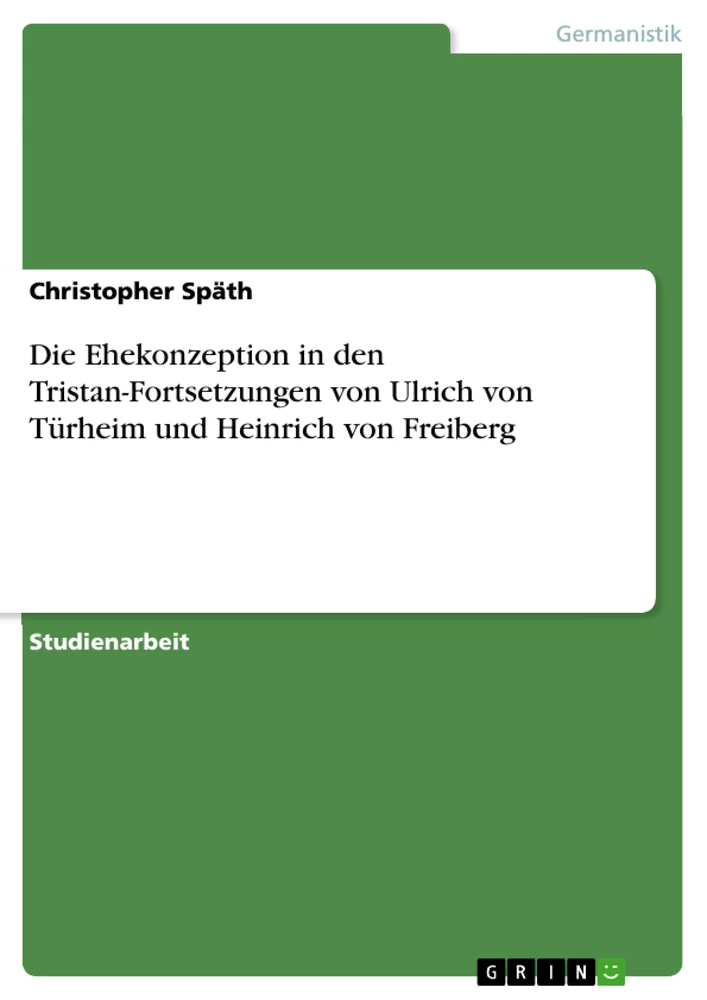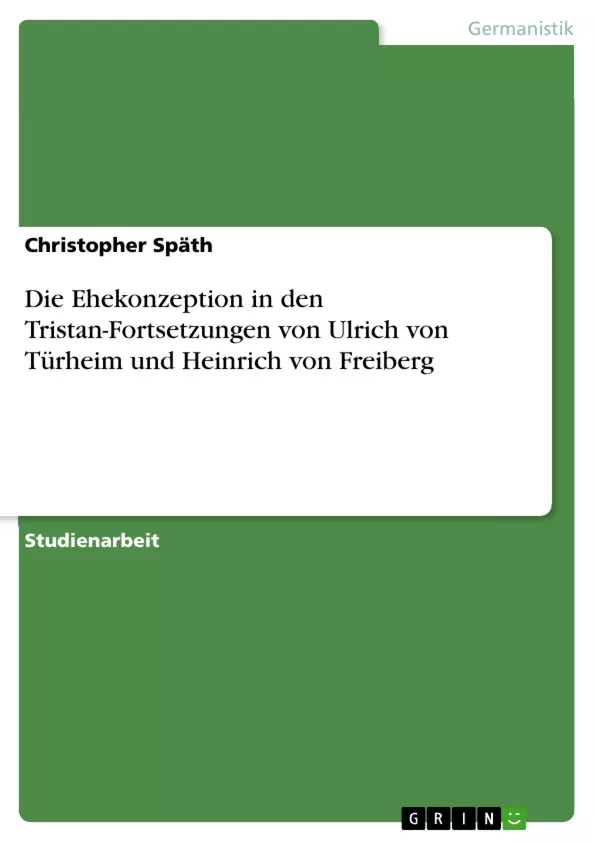In der mittelalterlichen Literatur existieren zwei Fortsetzungen von Gottfried von Straßburgs „Tristan“. Zunächst Ulrich von Türheims „Tristan“, den er vermutlich zwischen 1230 und 1235 dichtete, und Heinrich von Freibergs Werk „Tristan und Isolde“ , das zwischen 1273 und 1278 datiert ist. Beide Fortsetzungen reichen jedoch weder sprachlich noch konzeptionell an die Qualität von Gottfrieds Werk heran. Den Autoren wird daher wenig Wertschätzung entgegen gebracht, weshalb die Forschung die beiden Fortsetzungen eher vernachlässigt hat und somit sehr überschaubar ist.
Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass zumindest bei Ulrich, der als Vorlage auf den „Tristrant“ von Eilhart von Oberge zurückgriff, die Intention zur Fortsetzung von außen gegeben wurde. Er handelte im Auftrag des Schenks Konrad von Winterstetten.
sît ez alsus nû ist komen,
daz in [Gottfried] der tôt hât hin genomen,
sô hân ich mich genomen an,
als ich aller beste kann,
daz ich diz buoch biz an sîn zil
mit sprüchen vollebringen will.
des hât mit vlîze mich gebeten
Kuonrât der schenke von Winterstetten (U. v. 19ff.)
Es ist der Tod Gottfrieds, der Ulrich dazu veranlasst, sich an eine Fortset-zung des Torsos zu wagen. Die Formulierung Ulrichs (U v. 23ff.) ist weit von einer Demutsbekundung vor Gottfried entfernt und Ulrich scheint ein eigenes Verständnis von Gottfrieds „Tristan“ gehabt zu haben, wie Meissburger in seiner Dissertation 1954 nachweisen konnte.
Die zweite Fortsetzung von Gottfrieds Tristan-Torso verfasste Heinrich von Freiberg. Seine Quellen waren neben Eilhart von Oberge auch die Fortsetzung Ulrich von Türheims und auch die Fortsetzung Heinrichs ist ein Auftragswerk.
in Behemlant ist er geborn,
dem ich diz senecliche mer
mit innecliches herzen ger
vol tichten und vol bringen sol.
…
von Luchtenburg ist er genant.
sin nam in eren ist bekannt
und er ist genant Reymunt. (H. v. 62ff.)
Heinrichs Dichtung ist mit 6890 Versen wesentlich umfangreicher als jene Ulrichs, die nur 3731 Verse aufweist. Eindeutige Versuche, eine ausschweifendere und sprachlich mehr durchdachte Fortsetzung zu schaffen, die sich Gottfried zum Vorbild nimmt, sind auszumachen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ehe in der mittelalterlichen Feudalgesellschaft
- Die Ehekonzeption in den Tristan-Fortsetzungen von Ulrich von Türheim und Heinrich von Freiberg
- Werbung
- Hochzeit und Ehevollzug
- Die Bewertung von Gottfrieds Minnekonzeption der außerehelichen Liebe
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ehekonzeptionen in den Tristan-Fortsetzungen von Ulrich von Türheim und Heinrich von Freiberg im Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft. Es wird verglichen, wie beide Autoren die Ehe zwischen Tristan und Isolde darstellen und wie sie sich dabei zu Gottfried von Straßburgs Minnekonzeption verhalten.
- Ehe im mittelalterlichen Feudalwesen
- Vergleich der Ehekonzeptionen bei Ulrich von Türheim und Heinrich von Freiberg
- Einfluss der Kirche auf die Ehe im Mittelalter
- Bewertung von außerehelicher Liebe
- Unterschiede in den Darstellungen der Werbung, Hochzeit und des Ehevollzugs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die beiden Tristan-Fortsetzungen von Ulrich von Türheim und Heinrich von Freiberg vor und benennt die Forschungslücke bezüglich der vergleichenden Analyse ihrer Ehekonzeptionen. Kapitel II beleuchtet die Ehe in der mittelalterlichen Feudalgesellschaft und den geringen Einfluss der Kirche auf die Eheschließung bis ca. 1100. Kapitel III analysiert die unterschiedlichen Darstellungen der Ehe bei Ulrich und Heinrich, beginnend mit der Werbung und gefolgt von Hochzeit und Ehevollzug.
Schlüsselwörter
Tristan, Isolde, mittelalterliche Ehe, Ulrich von Türheim, Heinrich von Freiberg, Gottfried von Straßburg, Minne, Feudalgesellschaft, Kirche, außereheliche Liebe, Ehevollzug, christliche Moral.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Autoren der Tristan-Fortsetzungen?
Die beiden bedeutendsten Fortsetzungen von Gottfrieds von Straßburg „Tristan“-Torso stammen von Ulrich von Türheim (ca. 1230–1235) und Heinrich von Freiberg (ca. 1273–1278).
Warum wurden diese Fortsetzungen verfasst?
Beide Werke entstanden als Auftragswerke, um das unvollendete Werk von Gottfried von Straßburg abzuschließen. Ulrich schrieb im Auftrag von Konrad von Winterstetten, Heinrich für einen Gönner namens Reymunt von Luchtenburg.
Was ist das zentrale Thema dieser Untersuchung?
Die Arbeit analysiert die Ehekonzeptionen in den Fortsetzungen im Kontext der mittelalterlichen Feudalgesellschaft und vergleicht sie mit Gottfrieds Minnekonzeption.
Wie unterschieden sich die Werke im Umfang?
Heinrich von Freibergs Dichtung ist mit 6890 Versen deutlich umfangreicher und sprachlich ambitionierter als die Fortsetzung von Ulrich von Türheim, die nur 3731 Verse umfasst.
Welche Rolle spielt die Kirche in der Ehekonzeption?
Die Arbeit beleuchtet den geringen Einfluss der Kirche auf die Eheschließung bis etwa zum Jahr 1100 und wie sich christliche Moralvorstellungen später in der Literatur widerspiegelten.
- Citation du texte
- Christopher Späth (Auteur), 2008, Die Ehekonzeption in den Tristan-Fortsetzungen von Ulrich von Türheim und Heinrich von Freiberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123916