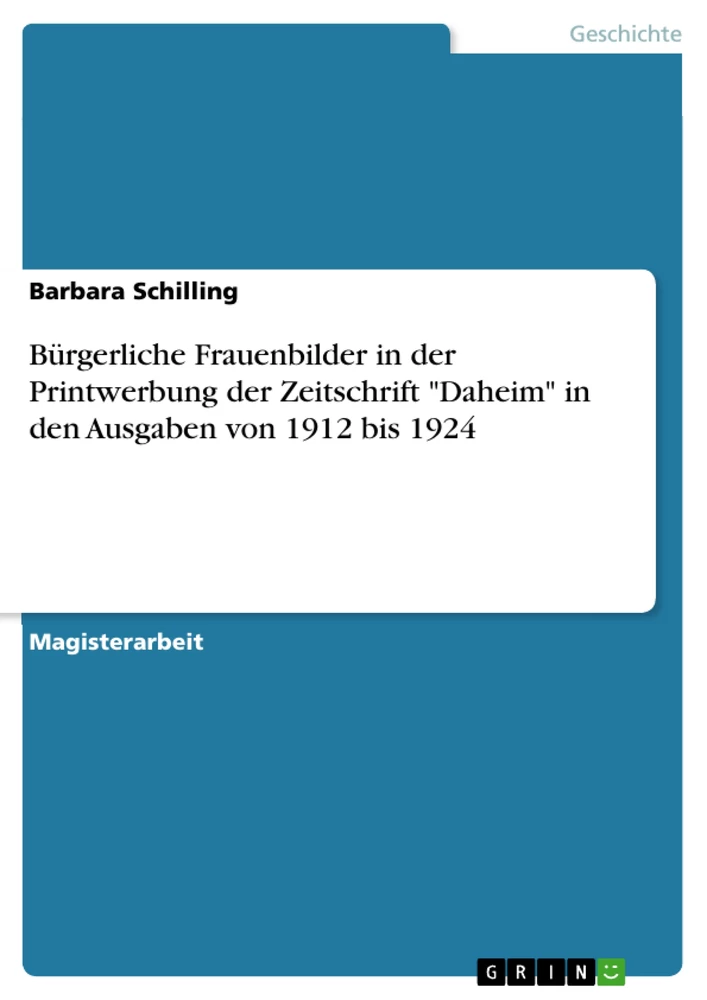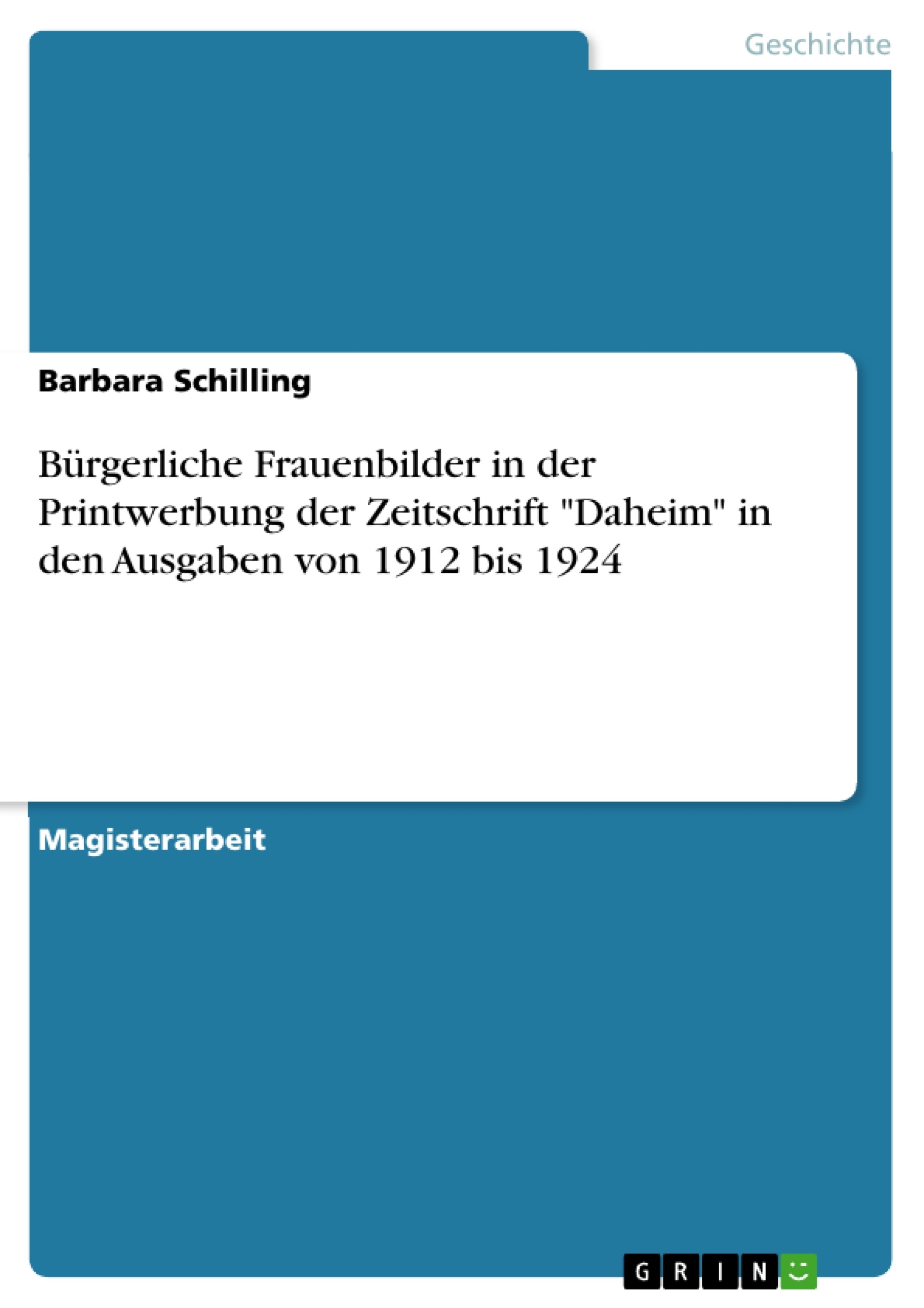Die kulturwissenschaftliche Bedeutung der Werbung ist ein weites Feld ...
Eine Funktion der Werbung, ein Nebenprodukt ihrer ökonomischen Komponenten, ist die
verzerrte Darstellung von gesellschaftlichen Werten einer Zeit. Ideale und Rollenzuweisungen
werden aufgegriffen, potenziert und lassen häufig einen überhöhten Personentypus entstehen.
In der folgenden Arbeit soll der Wandel des bürgerlichen Frauenbildes in der deutschen
Gesellschaft und Werbung vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg näher betrachtet
werden, wobei historische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, ästhetische und politische
Aspekte zu berücksichtigen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Bürgertum zu Beginn des 20. Jahrhunderts
- 2.1. Das bürgerliche Frauenbild - zwischen Tradition und Moderne
- 2.2. Gesellschaftliche Ideale: Mutter und Hausfrau
- 2.3. Traum und Trieb: Femme fatale, Heilige und Hure
- 3. Was ist Werbung?
- 3.1. Geschichte der Werbung
- 3.2. Allgemeinstrategische und ökonomische Aspekte – neue Bedürfnisstrukturen
- 3.3. Werbepsychologie – die Frau als Werbende und Umworbene
- 3.4. Werbeästhetik – die visualisierte Botschaft von Frauen an Frauen
- 4. Die Frauenbilder in den Werbeanzeigen in der Zeitschrift Daheim
- 4.1. 1912 bis 1914
- 4.1.1. Veränderungen in der gesellschaftlichen Situation: Industrialisierung und Berufstätigkeit
- 4.1.2. Die Frau als Umworbene und als Werbende: bürgerliche Ideale
- 4.1.3. Weibliche Konsumbedürfnisse im Wandel: „Die Eva von heute!“
- 4.1.3.1. Ernährung/ Gesundheit
- 4.1.3.2. Schönheit/ Hygiene
- 4.1.3.3. „Praktisches/ Elektrisches“
- 4.2. 1914 bis 1918
- 4.2.1. Veränderungen in der gesellschaftlichen Situation: Kriegsjahre
- 4.2.2. Die Frau als Umworbene und als Werbende: Die „Daheimgebliebene“
- 4.2.3. Weibliche Konsumbedürfnisse im Wandel: Ausnahmesituation
- 4.2.3.1. Ernährung/ Gesundheit
- 4.2.3.2. Schönheit/ Hygiene
- 4.2.3.3. „Praktisches/ Elektrisches“
- 4.3. 1918 bis 1924
- 4.3.1. Veränderungen in der gesellschaftlichen Situation: Nachkriegsjahre zwischen Mangel und Aufschwung
- 4.3.2. Die Frau als Umworbene und als Werbende: Die alte und die „Neue Frau“
- 4.3.3. Weibliche Konsumbedürfnisse im Wandel: Entwicklungen und Werbestrategien
- 4.3.3.1. Ernährung/ Gesundheit
- 4.3.3.2. Schönheit/ Hygiene
- 4.3.3.3. „Praktisches/ Elektrisches“
- 4.1. 1912 bis 1914
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Wandel des bürgerlichen Frauenbildes in der deutschen Gesellschaft und Printwerbung der Zeitschrift „Daheim“ zwischen 1912 und 1924. Die Arbeit analysiert die Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen (Industrialisierung, Kriege, soziale Veränderungen) und der Darstellung von Frauen in der Werbung, berücksichtigt dabei historische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, ästhetische und politische Aspekte.
- Das bürgerliche Frauenbild zu Beginn des 20. Jahrhunderts
- Die Entwicklung der Werbung in Deutschland im untersuchten Zeitraum
- Die Darstellung von Frauen als Konsumentinnen und Werbefiguren
- Der Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Frauenbilder in der Werbung
- Die Konstruktion von Geschlecht und Körper in der Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Fokus auf Frauenbilder in der Werbung der Zeitschrift „Daheim“. Kapitel 2 beleuchtet das bürgerliche Frauenbild zu Beginn des 20. Jahrhunderts, seine Widersprüche und die unterschiedlichen Idealvorstellungen. Kapitel 3 definiert Werbung und gibt einen Überblick über deren Geschichte und psychologische sowie ästhetische Aspekte. Kapitel 4 analysiert die Frauenbilder in den Anzeigen der Zeitschrift „Daheim“ in drei Zeitabschnitten: vor dem Ersten Weltkrieg, während des Krieges und in der Nachkriegszeit bis 1924. Dabei werden die jeweiligen gesellschaftlichen Veränderungen und deren Auswirkungen auf das Konsumverhalten und die Darstellung von Frauen in der Werbung untersucht.
Schlüsselwörter
Bürgerliches Frauenbild, Printwerbung, Zeitschrift Daheim, Werbungspsychologie, Werbeästhetik, Industrialisierung, Erster Weltkrieg, Konsumverhalten, Geschlechterrollen, „Neue Frau“, Mutterbild, Femme fatale.
Häufig gestellte Fragen
Welche Zeitschrift wird in dieser Studie untersucht?
Die Magisterarbeit analysiert Werbeanzeigen in der bürgerlichen Zeitschrift „Daheim“.
Welcher Zeitraum wird abgedeckt?
Die Untersuchung umfasst die Jahre 1912 bis 1924, also die Zeit vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg.
Wie veränderte sich das Frauenbild durch den Ersten Weltkrieg?
Das Bild wandelte sich von der traditionellen Hausfrau und Mutter hin zur „Daheimgebliebenen“, die neue Aufgaben übernahm, und schließlich zur „Neuen Frau“ der Nachkriegszeit.
Was sind die Schwerpunkte der Werbeanalyse?
Die Arbeit untersucht Konsumbedürfnisse in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Schönheit, Hygiene sowie technische Neuerungen im Haushalt.
Welche Rolle spielt die Werbeästhetik in der Arbeit?
Sie analysiert die visualisierten Botschaften, die gesellschaftliche Ideale wie die „Femme fatale“ oder die „Heilige“ aufgriffen und potenzierten.
- Quote paper
- Barbara Schilling (Author), 2008, Bürgerliche Frauenbilder in der Printwerbung der Zeitschrift "Daheim" in den Ausgaben von 1912 bis 1924, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123935