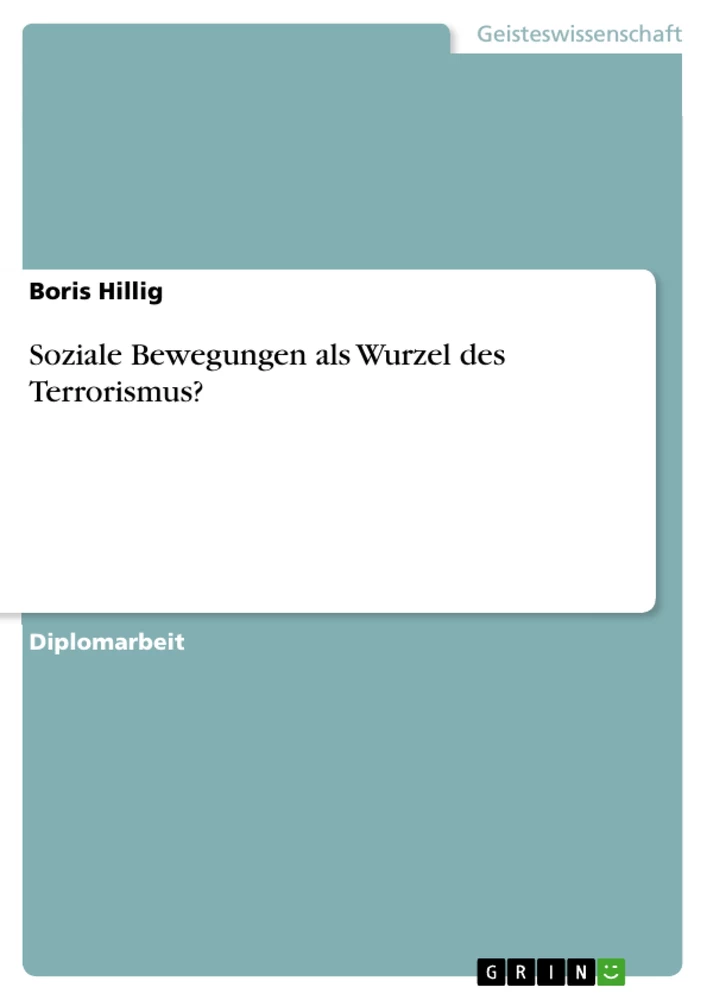Was genau ist eine soziale Bewegung? Die so genannten 68er-Bewegungen? Faschistische Bewegungen? Gibt es demnach linke und rechte soziale Bewegungen? Wo ist der Unterschied zwischen Protesten, Aufständen, Warnstreiks, Demonstrationen, Mobs, Revolutionen, Volksunruhen und sozialen Bewegungen? Waren oder sind die weltweiten Friedensdemonstrationen dieses Jahres gegen den Irak-Krieg eine soziale Bewegung? Welches sind die Entstehungsgründe? Wer ist der Initiator bzw. die Initiatoren? Wer nimmt an einer sozialen Bewegung teil und warum (oder warum nicht)? Wie erfolgen die Rekrutierung und die Mobilisierung der Mitglieder einer sozialen Bewegung? Folgt die gesamte Bewegung einem einheitlichen und nur einem Kollektivgedanken? Wovon hängt der Erfolg der sozialen Bewegung ab? Ist es so, wie Saint-Simons behauptet, nämlich dass die soziale Bewegung vom Kampf zwischen der produktiven und der nicht-produktiven Klasse in Gang gehalten wird? Welchen Einfluss haben die Gesellschaft, die Politik auf soziale Bewegungen?
Auch wenn der Grundstein der sozialen Bewegung wohl schon in der Französischen Revolution gelegt wurde (´mouvement social´), so hat sich die Soziologie der sozialen Bewegung – die Bewegungsforschung – erst innerhalb der letzten gut zwanzig Jahre als eigenständiger Forschungsbereich entwickelt und etabliert. Doch hat Lorenz von Stein bereits 1921 angemerkt, „(…) daß für den wichtigsten Teil Europas die politische Reform und Revolution zu Ende ist; die soziale ist an ihre Stelle getreten, und überragt alle Bewegungen der Völker mit ihrer furchtbaren Gewalt und ihren ernsten Zweifeln.“ Auch wenn ich die Meinung von Lorenz von Stein bezüglich der Bedeutungslosigkeit politischer Reformen nicht teile, so weist dieses Zitat doch auf die potenzielle Kraft und Bedeutung einer sozialen Bewegung hin, welche ihr spätestens zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zugewiesen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Terminologische Begriffe und wichtige Staatsaufgaben
- 2.1 Kollektiv und kollektives Handeln
- 2.2 Zum Begriff Konflikt
- 2.3 Das Verhältnis von Recht, Macht, Gewalt und Herrschaft
- 2.4 Die Schutzaufgaben des Staates
- 3 Zum Begriff des Terrorismus
- 3.1 Definition des Terminus Terrorismus
- 3.2 Abgrenzung des Terrorismus zu verwandten Erscheinungsformen
- 3.2.1 Terrorismus, Krieg und Kriminalität
- 3.2.2 Terrorismus und Guerilla
- 3.3 Formen von Terrorismus
- 3.3.1 Repressiver Terrorismus
- 3.3.2 Revoltierender Terrorismus
- 3.3.3 Internationaler Terrorismus
- 4 Die soziale Bewegung
- 4.1 Definition des Terminus soziale Bewegung
- 4.2 Ursachen der sozialen Bewegung
- 4.2.1 Einführung
- 4.2.2 Strukturanalytischer Ansatz
- 4.2.3 Sozialpsychologischer Ansatz
- 4.2.4 Interaktionistischer Ansatz
- 4.3 Ziele der sozialen Bewegung
- 4.4 Typologisierung der sozialen Bewegung
- 4.4.1 Formen von sozialen Bewegungen
- 4.4.2 Beispiele sozialer Bewegungen
- 4.4.2.1 Beispiel Hattinger ArbeiterInnenbewegung
- 4.4.2.2 Die deutsche Student Innenbewegung und die APO
- 4.5 Die Entwicklungsstadien einer sozialen Bewegung sowie ihre elementaren Begleiterscheinungen
- 4.5.1 Die soziale Bewegung und ihr gesellschaftlicher Kontext
- 4.5.2 Der Ursprung einer beginnenden Bewegung
- 4.5.3 Die Rekrutierung neuer Mitglieder und die Mobilisierung der Bewegung
- 4.5.4 Entwicklungsstadien der sozialen Bewegung
- 4.5.5 Soziale Bewegungen und die Rolle der Medien
- 5 Zur Interaktion zwischen der Dynamik kollektiver Aktionen und dem Auftreten terroristischer Vereinigungen
- 5.1 Das Ende der Bewegung – oder – Die Reaktion des Staates
- 5.2 Die soziale Bewegung auf dem Weg zur terroristischen Vereinigung?
- 5.2.1 Ausgangsbasis
- 5.2.2 Institutionalisierung von Forderungen
- 5.2.3 Verschiedene Erklärungsebenen für den Wandel gewaltloser Bewegungs-teilnehmerInnen zum gewaltbereiten Militanten
- 5.2.3.1 Erklärungsansatz der makro-sozialen Ebene
- 5.2.3.2 Erklärungsansatz der meso-sozialen Ebene
- 5.2.3.2.1 Theoretische Grundlagen: Begrenzte Regelverletzung, Provokation, Überreaktion und Beschleunigungsfaktoren
- 5.2.3.2.2 Empirie: Die Ereignisse des 2. Junis
- 5.2.3.2.3 Institutionalisierung des Terrorismus
- 5.2.3.3 Erklärungsansatz der mikro-sozialen Ebene
- 5.2.3.3.1 Die Theorie des Karriere-Modells
- 5.2.3.3.2 Empirische Belege zur politischen Gewaltbereitschaft
- 5.2.3.3.3 Das Karriere-Modell in empirischer Anwendung auf einzelne RAF-Gründungsmitglieder
- 5.2.3.3.3.1 Ausgangsbasis
- 5.2.3.3.3.2 Ulrike Meinhof
- 5.2.3.3.3.3 Gudrun Ensslin und Andreas Baader
- 5.2.4 Entstehungshintergründe diverser terroristischer Vereinigungen
- 5.2.4.1 Deutschland: Revolutionäre Zellen
- 5.2.4.2 Deutschland: Otte-Gruppe
- 5.2.4.3 Spanien: Die baskische ETA
- 5.2.4.4 Italien: Rote Brigaden
- 5.2.4.5 Korsika: Front de libération nationale de la Corse
- 5.2.4.6 Russland: Narodnaja Wolja
- 5.2.4.7 Islamismus - eine soziale Bewegung?
- 5.2.4.8 Kaschmir: Jammu und Kashmir Liberation Front
- 5.2.4.9 USA: Terrorismus und Black-Power-Movement
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Terrorismus
- Ursachen und Ziele von sozialen Bewegungen
- Entwicklungsstadien von sozialen Bewegungen
- Die Rolle des Staates in der Reaktion auf soziale Bewegungen
- Der Wandel von gewaltlosen Bewegungs-teilnehmerInnen zum gewaltbereiten Militanten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen sozialen Bewegungen und dem Auftreten von Terrorismus. Sie befasst sich mit der Frage, ob und wie soziale Bewegungen eine Wurzel für Terrorismus darstellen können. Die Arbeit analysiert die Ursachen, Ziele und Entwicklungsstadien von sozialen Bewegungen und untersucht, unter welchen Bedingungen sie sich in terroristische Vereinigungen verwandeln können.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Problemstellung der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung des Themas. Es werden die Forschungsfragen und die Methodik der Arbeit vorgestellt.
Kapitel 2: Terminologische Begriffe und wichtige Staatsaufgaben
Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Kollektiv, Konflikt und Gewalt. Es untersucht das Verhältnis von Recht, Macht und Herrschaft und analysiert die Schutzaufgaben des Staates.
Kapitel 3: Zum Begriff des Terrorismus
Dieses Kapitel definiert den Begriff Terrorismus und grenzt ihn von verwandten Erscheinungsformen wie Krieg und Kriminalität ab. Es beschreibt verschiedene Formen von Terrorismus, wie repressiven, revoltierenden und internationalen Terrorismus.
Kapitel 4: Die soziale Bewegung
Dieses Kapitel definiert den Begriff der sozialen Bewegung und untersucht ihre Ursachen, Ziele und Typologisierung. Es analysiert die Entwicklungsstadien einer sozialen Bewegung und die Rolle der Medien.
Kapitel 5: Zur Interaktion zwischen der Dynamik kollektiver Aktionen und dem Auftreten terroristischer Vereinigungen
Dieses Kapitel analysiert die Interaktion zwischen sozialen Bewegungen und dem Auftreten von Terrorismus. Es untersucht, unter welchen Bedingungen eine soziale Bewegung sich in eine terroristische Vereinigung verwandeln kann. Es werden verschiedene Erklärungsansätze auf der makro-, meso- und mikro-sozialen Ebene vorgestellt und anhand von Beispielen illustriert.
Schlüsselwörter
Soziale Bewegungen, Terrorismus, Gewalt, Konflikt, Staat, Recht, Herrschaft, Kollektiv, Typologisierung, Ursachen, Ziele, Entwicklungsstadien, Medien, Interaktion, Makro-soziale Ebene, Meso-soziale Ebene, Mikro-soziale Ebene, Karriere-Modell, Terroristische Vereinigungen, RAF, ETA, Rote Brigaden, Islamismus.
Häufig gestellte Fragen
Können soziale Bewegungen eine Wurzel für Terrorismus sein?
Die Arbeit untersucht, unter welchen Bedingungen sich Teile einer sozialen Bewegung radikalisieren und in terroristische Vereinigungen verwandeln können.
Was ist der Unterschied zwischen Terrorismus und Guerilla?
Die Arbeit bietet eine terminologische Abgrenzung zwischen verschiedenen Formen politischer Gewalt, wobei Terrorismus oft auf psychologische Wirkung in der Zivilbevölkerung zielt.
Was erklärt das „Karriere-Modell“ in der Terrorismusforschung?
Es beschreibt den stufenweisen Wandel einzelner Personen von gewaltlosen Teilnehmern einer Bewegung hin zu gewaltbereiten Militanten, wie z.B. bei Mitgliedern der RAF.
Welche Rolle spielen staatliche Reaktionen auf Protestbewegungen?
Überreaktionen des Staates oder die Unterdrückung von Forderungen können als Beschleunigungsfaktoren für die Radikalisierung einer sozialen Bewegung wirken.
Welche Beispiele für terroristische Gruppen werden analysiert?
Die Arbeit betrachtet unter anderem die RAF (Deutschland), die ETA (Spanien), die Roten Brigaden (Italien) und den Islamismus als mögliche soziale Bewegung.
- Citar trabajo
- Boris Hillig (Autor), 2003, Soziale Bewegungen als Wurzel des Terrorismus?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1239859