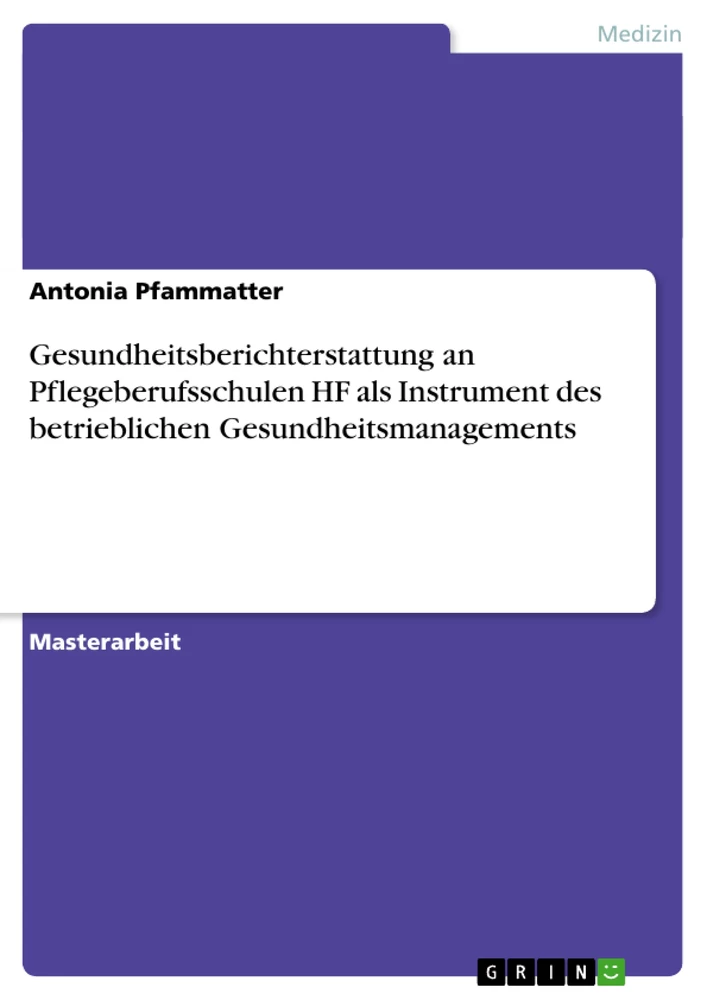Gegenstände der vorliegenden Untersuchung sind die Ressourcen und Belastungen berufstätiger
Frauen an einer Höheren Fachschule (HF) Pflege, im Rahmen betrieblicher
Gesundheitsförderung. Dazu wurde eine Befragung von 58 Mitarbeiterinnen an einer Berner
Pflegefachschule, sowie acht Einzelinterviews mit oberösterreichischen Lehrerinnen der
Krankenpflege durchgeführt.
Hintergrund und Studienziele
Die politische Situation im Kanton Bern erzeugt zum Zeitpunkt der Erhebung Unsicherheit und
Ohnmachtsgefühle. Der Lehrkörper äussert an Lehrerinnenforen und gesamtschulischen Foren
immer wieder das Bedürfnis, der derzeitigen hohen Fluktuation im Lehrkörper entgegen zu
wirken. Auch auf Führungsebene ergaben sich personelle Veränderungen, zum Teil ausgelöst
durch die zu erwartenden Konsequenzen der strategischen Ziele der Erziehungsdirektion.
Mit der Arbeit wird eine von möglichen flankierenden Massnahmen zur Gesundheitserhaltung
und zur gesundheitsfördernden Arbeitsgestaltung / Kultur aufgezeigt. Durch das Bündeln von
gesundheitsrelevanten Ressourcen der MA besteht die Chance, diese im Alltag geschickt
einzusetzen. Ein Einbringen und Nutzen von vorhandenen Ressourcen soll den Mitarbeiterinnen
helfen, in diesem dynamischen Veränderungsprozess gesund zu blieben. Im Zentrum der Arbeit
steht das Erstellen eines innerbetrieblichen, Gesundheitsberichtes. Der Gesundheitsbericht soll
dazu dienen, potentielle Gesundheitsressourcen aber auch Risiken Beschäftigter systematisch zu
erfassen und darzustellen. Mit dem Gesundheitsbericht soll es möglich sein,
Gesundheitsressourcen zielgerichtet einzusetzen aber auch Gesundheitsrisiken frühzeitig und
zielgerichtet entgegen zu wirken.
Methode.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Thema der Arbeit
- 1.2 Das Ziel der Arbeit
- 1.3 Zur Gliederung der Arbeit
- 2. Ausgangslage
- 2.1 Bedarf
- 2.2 Bedürfnisse
- II Theoriebezug
- 3. Der Gesundheitsbegriff
- 3.1 Gesundheitsverhalten (Health behaviour)
- 3.2 Salutogenetisches Gesundheitsmodell
- 3.3 Ressourcen am Arbeitsplatz
- 4. Betriebliche Gesundheitsförderung
- 4.1 Die Luxemburger Deklaration als Grundlage der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 4.2 Die Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in Klein- und Mittelunternehmen
- 4.3 Ziele der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 4.3.1 Prozesse der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 4.3.2 Massnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 4.4 Wirksamkeit und Nutzen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 4.5 Evaluation Betrieblicher Gesundheitsförderung
- 4.6 Anforderungen im Erwerbsleben
- 4.7 Unterschiedliche Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern
- 5. Gesundheitsförderung durch Organisationsentwicklung
- 5.1 Veränderungen in der Organisation gestalten
- 5.2 Organisationsentwicklung durch Partizipation der MA
- 5.3 Phasen in einem Veränderungsprozess
- 5.4 Umgang mit Widerstand während der OE
- 6. Bedeutung und Ziele des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- 6.1 Investition in das Humankapital
- 6.2 Der Settingansatz
- 6.3 Strategien und Instrumente des Gesundheitsmanagements
- 6.4 Spezifisches zum Setting Pflegefachschule HF (CH)
- 7. Gesundheitsberichterstattung
- 7.1 Definition, Zweck und Ziele der Gesundheitsberichterstattung
- 7.2 Gesundheitsbericht der EU
- 7.3 Gesundheitsberichte aus A/CH
- 7.4 Aspekte des dritten Gesundheitsberichtes des Kanton Bern 2006
- 7.5 Betriebliche Gesundheitsberichte
- 7.6 Gesundheitsbericht zum Lehrerberuf und psychische Gesundheit in der Schweiz
- 3. Der Gesundheitsbegriff
- III Erhebung
- 8. Erhebung betreffend Gesundheitsverhalten und -ressourcen bei zwei relevanten Zielgruppen
- 8.1 Grundzüge der Aktivierenden Befragung
- 8.1.1 Beispiel einer Aktivierenden Befragung
- 8.1.2 Begründung zur Methodenwahl der aktivierenden Befragung
- 8.1.3 Aktivierende Befragung als Forschungsstrategie im Setting Pflegefachschule
- 8.2 Begründung zum Setting Pflegeberufschule
- 8.3 Begründung zur Wahl Oberösterreich als Vergleichswert
- 8.1 Grundzüge der Aktivierenden Befragung
- 9. Ziel der Erhebung
- 9.1 Forschungsfragen
- 9.2 Sample 1 schriftliche Mitarbeiterinnenbefragung (MAB, CH)
- 9.3 Sample 2 Interviews (A)
- 9.4 Begründung zur Randomisierung der Fokusgruppe (CH)
- 10. Durchführung der Erhebung
- 10.1 Deskription/Ergebnisse der Erhebung der Mitarbeiterinnen (CH)
- 10.2 Kategorien und Items zur Deskription und Interpretation der MAB (CH)
- 10.2.1 Deskription / Interpretation der MAB Kategorie 1
- 10.2.2 Deskription / Interpretation der MAB Kategorie 2
- 10.2.3 Deskription / Interpretation der MAB Kategorie 3
- 10.2.4 Deskription / Interpretation der MAB Kategorie 4
- 10.2.5 Deskription / Interpretation der MAB Kategorie 5
- 10.2.6 Deskription / Interpretation der MAB Kategorie 6
- 10.2.7 Deskription / Interpretation der MAB Kategorie 7
- 10.2.8 Deskription / Interpretation der MAB Kategorie 8
- 10.3 Durchführung der Fokusgruppeninterviews 1 und 2 (CH)
- 10.3.1 Ergebnis Fokusgruppeninterview 1 (CH)
- 10.3.2 Ergebnis Fokusgruppeninterview 2 (CH)
- 10.4 Durchführung und Ergebnisse der Interviews (A)
- 11. Allgemeiner Bericht anhand von Reflexionskriterien
- 11.1 Ist-Analyse als betrieblicher Gesundheitsbericht der Berner Pflegefachschule
- 11.2 Vergleichende Schlussfolgerungen CH und A
- 11.3 Beschreibung des OE-Prozess der Berner Schule bis Juni 2008
- 11.4 Konsequenzen für das Gesundheitsmanagement in der Pflegeberufsschule HF
- 12. Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellungen der Arbeit
- 13. Danksagung
- 8. Erhebung betreffend Gesundheitsverhalten und -ressourcen bei zwei relevanten Zielgruppen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Eignung von Gesundheitsberichterstattung an Pflegeberufsschulen als Instrument des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ziel ist es, den Bedarf an und die Möglichkeiten einer solchen Berichterstattung zu analysieren und daraus Empfehlungen für die Praxis abzuleiten.
- Betriebliches Gesundheitsmanagement in Pflegeberufsschulen
- Gesundheitsberichterstattung als Instrument der Organisationsentwicklung
- Analyse des Gesundheitsverhaltens und der Ressourcen von Pflegekräften
- Vergleichende Betrachtung zwischen der Schweiz und Österreich
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Ausgangslage, den Bedarf und die Bedürfnisse im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements in Pflegeberufsschulen. Der Theorieteil (Kapitel 3-7) behandelt den Gesundheitsbegriff, betriebliche Gesundheitsförderung, Organisationsentwicklung und verschiedene Ansätze der Gesundheitsberichterstattung. Kapitel 8 beschreibt die Methodik der durchgeführten Erhebung, welche in Kapitel 10 detailliert dargestellt wird. Kapitel 11 präsentiert eine Ist-Analyse und vergleicht die Ergebnisse aus der Schweiz und Österreich.
Schlüsselwörter
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gesundheitsberichterstattung, Pflegeberufsschulen, Organisationsentwicklung, Gesundheitsverhalten, Ressourcen, Schweiz, Österreich, Aktivierende Befragung, Mitarbeiterbefragung, Fokusgruppeninterviews.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Gesundheitsberichterstattung an Pflegeberufsschulen?
Ziel ist es, Gesundheitsressourcen und -risiken der Mitarbeiterinnen systematisch zu erfassen, um gezielte Maßnahmen zur Gesundheitsförderung abzuleiten.
Was beinhaltet das salutogenetische Gesundheitsmodell?
Es konzentriert sich auf Faktoren, die Gesundheit erhalten und fördern, anstatt nur nach den Ursachen von Krankheiten zu suchen.
Was versteht man unter einer „Aktivierenden Befragung“?
Dies ist eine Methode, bei der die Befragten nicht nur Daten liefern, sondern durch den Prozess zur aktiven Teilnahme an Veränderungen motiviert werden.
Gibt es Unterschiede zwischen der Schweiz und Österreich im Pflegebereich?
Die Arbeit führt vergleichende Schlussfolgerungen zwischen Bern (CH) und Oberösterreich (A) hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und Ressourcen durch.
Wie hängen Organisationsentwicklung und Gesundheit zusammen?
Gesundheitsförderung durch Organisationsentwicklung nutzt Partizipation, um Veränderungen gesundheitsverträglich zu gestalten und Widerstände abzubauen.
- Citation du texte
- MA/ MAS / RN Antonia Pfammatter (Auteur), 2008, Gesundheitsberichterstattung an Pflegeberufsschulen HF als Instrument des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124191